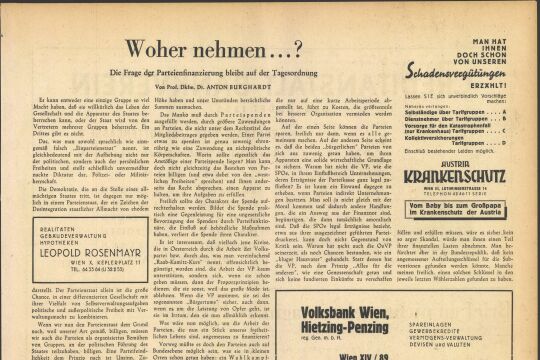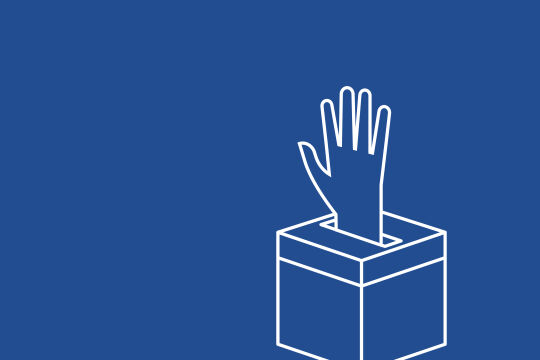Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wir brauchen kein Regierungskartell
Seit Bernd Schilcher in der FURCHE (7/1985) das „Schweizer Modell” für Österreich forderte, reißt die Diskussion darüber nicht mehr ab. A. Pelinka meldet Vorbehalte an.
Seit Bernd Schilcher in der FURCHE (7/1985) das „Schweizer Modell” für Österreich forderte, reißt die Diskussion darüber nicht mehr ab. A. Pelinka meldet Vorbehalte an.
Sozialpartnerschaft und Zwei-einhalb-Parteien-System, Große Koalition oder absolute Mehrheit einer Großpartei — das waren die Wesensmerkmale der „Zweiten Republik” bis 1983. Doch schon in der Endphase dieser Ära kam einiges in Bewegung.
Die Volksabstimmung über die Inbetriebnahme des Atomkraft-
Werkes Zwentendorf zeigte plötzlich die Grenzen der Sozialpartnerschaft, brachte ein Element der Unberechenbarkeit und der plebiszitären Opposition ins politische Spiel.
Eine Antwort, die nun wiederum — vor allem von bestimmten Teilen der ÖVP - ins Spiel gebracht wird, ist die Übernahme des Schweizer Regierungssystems für Österreich. Eine verfassungsmäßig verankerte Allparteienregierung und der Ausbau der direktdemokratischen Einrichtungen soll die Antwort auf die Beweglichkeit sein.
Die offenbar nicht ausgesprochene Annahme, die hinter diesen Vorschlägen steht, ist, daß die abnehmende Berechenbarkeit und Stabilität des politischen Systems grundsätzlich von Nachteil ist.
Für das „Schweizer Modell” kann angeführt werden, daß in der Realität des parlamentarischen Systems auch in Österreich das Gegenüber von Parlament und Regierung nur dem Schein nach stattfindet, daß das Parlament vielmehr von seiner Mehrheit, die mit der Regierung eng verbunden ist, gesteuert wird.
Wenn schon Parlament und Regierung nicht wirklich getrennt sind, dann könnte die Regierung gleichsam als Parlamentsausschuß alle Parteien umfassen; dann könnte die Konzeption einer parlamentarischen Opposition über Bord geworfen werden.
Zweifellos gibt es rund um die Diskussion des Schweizer Modells ein begründetes Für und Wider. Es fallen jedoch zwei Dinge auf, die eine Ideologiekritik dieses Vorschlages erlauben:
# Es ist immer die zweitstärkste Partei, die für solche Vorschläge anfällig ist. Bis 1966, zuletzt auf dem außerordentlichen Parteitag dieses Jahres durch Bruno Krei-sky vertreten, waren in der SPÖ die Stimmen besonders stark, die in einer permanenten Großen Koalition die bestmögliche Verwirklichung der Demokratie in Österreich sahen.
Ab 1970 wechselte dieses Gedankengut in die Reihen der ÖVP — so wurde das Schweizer Modell schon rund um die Nationalratswahl 1975 von der Volkspartei in die politische Diskussion wieder eingebracht.
• Das Konzept einer Allparteienregierung wird jetzt zu einem Zeitpunkt wieder in die Debatte geworfen, als ein offenbar steigender Anteil vor allem junger Wähler aus dem Parteienstaat, nicht aber aus der- Demokratie auszieht.
Das Schweizer Modell will den Parteienstaat verfassungsrechtlich zementieren und eine parlamentarische Betätigung nur in Form einer Mitarbeit an einem Regierungskartell erlauben. Auf diese Weise wird der Unterschied zwischen etablierten und nicht etablierten politischen Gruppierungen theoretisch aufgehoben, werden nicht konventionelle politische Strömungen zwangsetabliert und zwangskartelliert.
Die Mängel der österreichischen Demokratie nach 1945 waren der Preis für den Ausbau eben dieser Demokratie:
Um nach dem Erlebnis des Bürgerkrieges, der halbfaschistischen Diktatur ab 1934 und des Nationalsozialismus zwischen den die Republik wiedergründenden Parteien Vertrauen herzustellen, wurde ein System der Machtteilung geschaffen und wechselseitig garantiert.
Die positiven Folgen werden oft genug erwähnt — die negativen Folgen waren eine Zuordnung fast der gesamten österreichischen Gesellschaft an das System des Proporzes der beiden großen politisch-weltanschaulichen Lager.
Politischer Konflikt in der Form, die in westlichen Demokratien an sich üblich ist, fand kaum statt; der Parlamentarismus führte eine Schattenexistenz; der demokratische Grundwert oppositionellen Verhaltens konnte nicht einsichtig gemacht werden, da Opposition zunächst auf Kommunisten und ehemalige Nation nalsozialisten beschränkt schien.
Und nun, da oppositionelles Verhalten in einer immer breiteren Öffentlichkeit immer positiver eingeschätzt wird, soll Opposition verfassungsrechtlich gleichsam verboten werden, soll oppositionelles Verhalten in eine Allparteienregierung hineingezwungen werden.
Eine solche Antwort ist ganz gewiß nicht geeignet, die kritischen Teile der jungen Generation zu überzeugen, denen die österreichische Demokratie zu wenig demokratisch ist.
Bleibt das Argument des Ausbaues direkter Demokratie. Zweifellos kann vieles erreicht werden, wenn den direkt Betroffenen mehr Möglichkeiten der unmittelbaren Entscheidung eingeräumt werden.
Aber die direkte Demokratie ist kein Allheilmittel. Die Schweiz demonstriert, daß Plebiszite vor allem dann erfolgreich sind, wenn gesellschaftliche Großgruppen ihre Kraft hinter ein solches Vorhaben stellen; und die Schweiz zeigt auch, daß die direkte Demokratie vor allem ein Instrument der Verhinderung ist.
Mehr Konfliktkultur
Nicht zufällig kann die direkte Demokratie in der Schweiz dafür verantwortlich gemacht werden, daß abweichendes Verhalten in unserem westlichen Nachbarland auf wenig Verständnis stößt — siehe das Fehlen eines Zivildienstes; daß Vorurteile gegen Frauen und Ausländer politisch besonders stark zum Tragen kommen—siehe die zögernde Einführung des Frauenstimmrechtes und die rechtliche Stellung von Gastarbeitern.
Das Modell der Allparteienregierung bringt zwar vielleicht der einen oder anderen Partei gewisse Vorteile; es bringt jedoch der österreichischen Demokratie eindeutig mehr Nachteile.
Österreich, das ohnehin ein historisch begründetes Defizit an Neinsager-Kultur hat, soll nun um das Erlebnis einer Aufwertung oppositionellen Verhaltens, soll um den heftigen Schritt einer Intensivierung innerer Konflikte gebracht werden.
Die österreichische Demokratie braucht nicht die verfassungsrechtlich garantierte Regierungsbeteiligung der FPÖ oder auch einer grün-alternativen Partei. Die österreichische Demokratie braucht die Gewöhnung an die Tatsache, daß demokratisches Verhalten Konfliktverhalten ist; daß demokratische Kultur Konfliktkultur ist.
Der Autor ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!