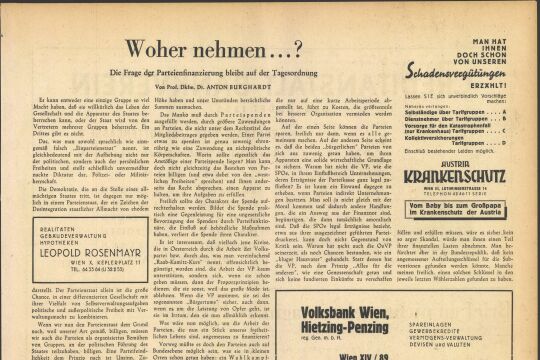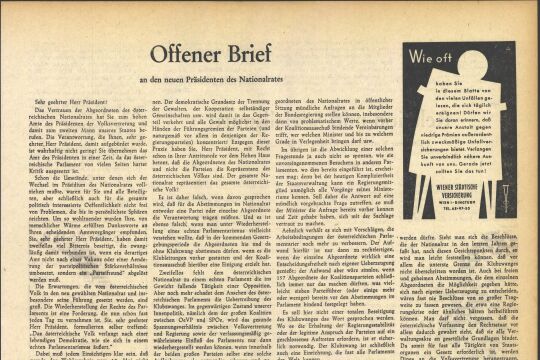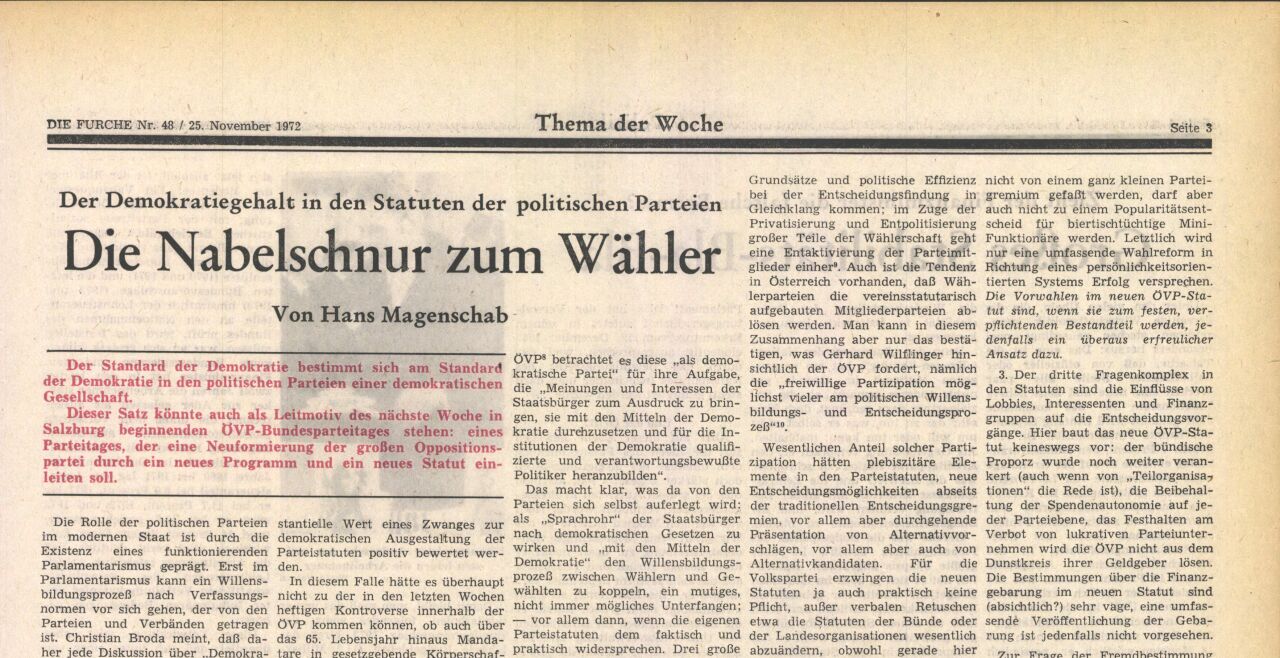
Die Nabelschnur zum Wähler
Der Standard der Demokratie bestimmt sich am Standard der Demokratie in den politischen Parteien einer demokratischen Gesellschaft. Dieser Satz könnte auch als Leitmotiv des nächste Woche in Salzburg beginnenden ÖVP-Bundesparteitages stehen: eines Parteitages, der eine Neuformierung der großen Oppositionspartei durch ein neues Programm und ein neues Statut einleiten soll.
Der Standard der Demokratie bestimmt sich am Standard der Demokratie in den politischen Parteien einer demokratischen Gesellschaft. Dieser Satz könnte auch als Leitmotiv des nächste Woche in Salzburg beginnenden ÖVP-Bundesparteitages stehen: eines Parteitages, der eine Neuformierung der großen Oppositionspartei durch ein neues Programm und ein neues Statut einleiten soll.
Die Rolle der politischen Parteien im modernen Staat ist durch die Existenz eines funktionierenden Parlamentarismus geprägt. Erst im Parlamentarismus kann ein Willensbildungsprozeß nach Verfassungsnormen vor sich gehen, der von den Parteien und Verbänden getragen ist. Christian Broda meint, daß daher jede Diskussion über „Demokratiereform“ nur dann sinnvoll ist, wenn sie eine allgemeine Verbesserung des Funktionierens aller demokratischen Einrichtungen einschließt1.
Nun nennt die österreichische Bundesverfassung nicht die Parteien als Träger von politischer Gewalt, ja verzichtet auf ihre ausdrückliche Erwähnung hinsichtlich der Legislative und Exekutive.
Über die Problematik existiert eine umfassende wissenschaftliche Literatur, deren konkreteste Ausformung die Forderung nach einem Parteiengesetz ist. Der Staatsrechtler Rene Marcic hat am lautesten diesen Ruf von Seiten der Wissenschaft erhoben, weil „wer Macht trägt, von der Verfassung als Machtträger installiert werden soll“2.
Die Bundesregierung hat im März 1965 erstmals 'auch «rien - Bericht über' die-' ReehtsauffasSühg“ betreffend die Stellung der politischen Parteien vorgelegt3. Konsequenzen aus diesem Bericht wurden vom Parlament bislang keine gezogen.
Anders als die österreichische Bundesverfassung hat das erst nach 1945 entstandene Grundgesetz der Bundesrepublik sehr wohl die Existenz von politischen Parteien anerkannt und ihrer Rolle Rechnung getragen. Der Grundgedanke aber war vor allem auch, sicherzustellen, daß die innere Ordnung der Parteien demokratischen Grundsätzen entspricht (Art. 21 GG).
Auf dieser Grundlage baut das Parteiengesetz4 der Bundesrepublik auf, das konkrete Ordnungsvorschriften über die Parteistatuten enthält — nämlich dem Grundsatz der „inneren demokratischen Ordnung“ zu entsprechen. Unter anderem:
• Parteitage müssen mindestens jedes zweite Jahr stattfinden; der Vorstand ist jeweils verpflichtet, einen Tätigkeitsbericht abzugeben.
• Delegationen in Vorstände, Vertreterversammlungen, Schiedsgerichte haben zwingend durch Wahlen zu erfolgen. Wahlen in qualifizierte Gremien sind grundsätzlich geheim.
• Auch Minderheiten in Parteiorganen ist zu ermöglichen, daß sie „Vorschläge ausreichend zur Erörterung bringen können“ (§ 15 Abs. 3).
• Über die Parteifinanzierung ist öffentlich Rechenschaft abzulegen; ein Prüfungsbericht ist beim Präsidenten des Bundestages einzureichen; Spender von Geldern über einer gewissen Höhe sind zwingend mit Namen und Betragshöhe anzugeben.
Nun sind solche Ordnungsvorschriften in Österreich niemals in öffentlicher Erörterung gestanden; vieles spricht dafür, daß die Parteien auch aus Scheu vor solcher Transparenz nicht gerne von Parteiengesetzen sprechen.
Aber selbst ohne Wertung der Zweckmäßigkeit eines solchen Parteiengesetzes für Österreich und seiner Effektivität (die Spendenöffentlichkeit etwa zwingt ja geradezu zur Verschleierung) muß doch der substantielle Wert eines Zwanges zur demokratischen Ausgestaltung der Parteistatuten positiv bewertet werden.
In diesem Falle hätte es überhaupt nicht zu der in den letzten Wochen heftigen Kontroverse innerhalb der ÖVP kommen können, ob auch über das 65. Lebensjahr hinaus Mandatare in gesetzgebende Körperschaften entsandt werden können. Wäre ein Zwang zur Konformität der Parteistatuten mit der Verfassung der Republik Österreich gegeben, dann wäre die Verfassungswidrigkeit einer solchen Bestimmung evident geworden: der Art. 26 Abs. 4 B-VG. bestimmt nämlich ausdrücklich, daß es keine Altersklausel für öffentliche Mandatare gibt. Es muß daher auch mit der genannten Verfassungsbestimmung in Sinnwiderspruch stehend angesehen werden, wenn das Statut der SPÖ5 in § 52 eine faktische Einschränkung der Wählbarkeit von mehr als 65jährigen festgelegt ist; das gleiche gilt für den nunmehrigen ÖVP-Statutenentwurf, der im § 35 das jedem Staatsbürger verfassungsgesetzlich verbriefte passive Wahlrecht jedenfalls formal einschränkt.
So ist auch einiges zur „Philosophie“ des bestehenden SPÖ- und des vorgeschlagenen ÖVP-Statutes zu sagen. Immerhin besagt der Art. 1 der österreichischen Bundesverfassung, daß das Recht der demokratischen Republik „vom Volk“ ausgeht. Diese Absichts- und Ordnungsvorstellung sollte daher bei der inneren Ordnung des Parteienwesens zumindest dem Sinn nach Berücksichtigung finden, das aber würde bedeuten, daß der Wählerschaft
— nicht nur den Parteimitgliedern
— bei politischen Entscheidungen, die die Parteien treffen, immerhin noch ein gewisser Spielraum bleibt. Die Methode der innerparteilichen Willensbildung sollte primär nach Prinzipien der Mehrheitsentscheidung zur Anwendung kommen.
Nun gestalten die Parteien de facto am stärksten den politischen Prozeß; sind willensbildend tätig und sie „verwalten“ Macht auch über Menschen, die keiner Parteiorganisation angehören. Wer aber Macht ausübt, muß sich der Kontrolle unterziehen — denn erst die Kontrolle sichert den Bestand der Demokratie: le pouvoir arrete le pouvoir
— weshalb'die Kontrolle der Parteien unerläßlich ist: und sie garantiert nur eine wache Öffentlichkeit, mit der sich politische Parteien auf das intensivste — und selbstverständlichste — auseinandersetzen müssen.
Deshalb darf die Kontrolle der Parteien nicht nur eine innerparteiliche Angeleqenhe.it sein — weshalb Parteiöffentlidhkeit Veröffentlichung voraussetzt“.
Man muß fordern, daß diesem Gesichtspunkt auch in den Statuten der österreichischen Parteien stärker als bisher Rechnung getragen wird. Wenn über Normen und Zwänge beraten wird, haben die Normadressaten ein Recht zur Information — und vice versa sich Gehör zu verschaffen.
Das Programm der SPÖ7 spricht das „Heimatgefühl des Menschen in der Demokratie“ an und will dieses durch die Grundsätze der verantwortlichen Mitarbeit, der Selbstverwaltung und der Mitbestimmung stärken.
Im neuen Programmentwurf der
ÖVP8 betrachtet es diese „als demokratische Partei“ für ihre Aufgabe, die „Meinungen und Interessen der Staatsbürger zum Ausdruck zu bringen, sie mit den Mitteln der Demokratie durchzusetzen und für die Institutionen der Demokratie qualifizierte und verantwortungsbewußte Politiker heranzubilden“.
Das macht klar, was da von den Parteien sich selbst auferlegt wird: als „Sprachrohr“ der Staatsbürger nach demokratischen Gesetzen zu wirken und „mit den Mitteln der Demokratie“ den Willensbildungsprozeß zwischen Wählern und Gewählten zu koppeln, ein mutiges, nicht immer mögliches Unterfangen; — vor allem dann, wenn die eigenen Parteistatuten dem faktisch und praktisch widersprechen. Drei große Fragengruppen stehen dabei im Vordergrund:
1. Entspricht der Entscheidungsvorgang innerhalb den Parteien demokratischen Grundgesetzen und ist die vielzitierte Nabelschnur zum Wähler gewahrt?
Die SPÖ-Statuten (aus dem Jahre 1968) verstehen sich in Verfolgung des Prinzips der repräsentativen Demokratie. Die Partei verwalten und in der Partei bestimmen ausdrücklich nur Mitglieder mit. Die Zusammensetzung des Parteitages und des Bundesparteivorstandes bestimmt sich einzig und allein nach der Zahl der Parteimitglieder, wobei die Zahlung der Mitgliedsbeiträge für Entsendungsquoten ausschlaggebend ist.
Anders die ÖVP: für die Delegation der Länder am Bundesparteitag ist die Zahl der Wählerstimmen (der letzten Nationalratswahlen) im betreffenden Bundesland ausschlaggebend (§ 14, Abs. 1 lit. f des Entwurfes). In der Bundesparteileitung gilt dieser Grundsatz allerdings wieder nicht.
Nun steht die Willensbildung in politischen Parteien stets unter dem Druck technischer Zwänge: Entscheidungen sollen schnell, koordinativ, sachlich fundiert sein. Demokratische Prozesse der Willensbildung sind oft langsam, spiegeln eine Interessenvielfalt wider und weisen nicht die Handschrift von Sachexperten auf. So laufen Entscheidungen auf ganz kleine Gremien — ja oft auf den Parteichef zu.
Im SPÖ-Statut hat der Parteivorsitzende an sich nur eirt Vorsitzrecht in Gremien und ein Vertretungsrecht nach außen zu erfüllen. Die ÖVP-Statuten sollen dem Parteiobmann auch das Recht einräumen, Richtlinien zu erteilen und ein „erfolgreiches Zusammenwirken aller in der ÖVP vereinten Kräfte zu sichern“ (§ 27, Abs. 3).
Die Grundsatzproblematik besteht darin, inwieweit demokratische
Grundsätze und politische Effizienz bei der Entscheidungsfindung in Gleichklang kommen; im Zuge der Privatisierung und Entpolitisierung großer Teile der Wählerschaft geht eine Entaktivierung der Parteimitglieder einher“. Auch ist die Tendenz in Österreich vorhanden, daß Wählerparteien die vereinsstatutarisch aufgebauten Mitgliederparteien ablösen werden. Man kann in diesem Zusammenhang aber nur das bestätigen, was Gerhard Wilflinger hinsichtlich der ÖVP fordert, nämlich die „freiwillige Partizipation möglichst vieler am politischen Willens-bildungs- und Entscheidungspro-zeß“10.
Wesentlichen Anteil solcher Partizipation hätten plebiszitäre Elemente in den Parteistatuten, neue Entscheidungsmöglichkeiten abseits der traditionellen Entscheidungsgremien, vor allem aber durchgehende Präsentation von Altemativvor-schlägen, vor allem aber auch von Alternativkandidaten. Für die Volkspartei erzwingen die neuen Statuten ja auch praktisch keine Pflicht, außer verbalen Retuschen etwa die Statuten der Bünde oder der Landesorganisationen wesentlich abzuändern, obwohl gerade hier neue Formen demokratischer Ausgestaltung möglich wären.
Jedenfalls sieht das neue Statut der ÖVP praktisch nur den Status quo vor, wonach die ÖVP-Mitglieder faktisch bündische Mitglieder sind — obwohl sich die überwiegende Mehrheit von ihnen der Gesamtpartei und ihrer Politik verbunden und verpflichtet fühlt.
2. Der zweite große Fragenkomplex, der uns in diesem Zusammenhang in den Statuten beschäftigt, ist die Frage nach den Grundsätzen der Kandidatenermittlung.
Die SPÖ kennt das sogenannte Bundesprinzipuum, wonach 20 Prozent aller Plätze auf Kandidatenlisten vom Bundesparteivorstand zu benennen sind; in der ÖVP können von der Bundesparteileitung lediglich für 5 Prozent der Kandidatenlisten Vorschläge an die Länder gemacht werden — die Landesparteileitungen beschließen aber autonom über die wirklich entscheidende Reihung der Kandidaten.
Die SPÖ kennt eine Altersklausel, von der ausnahmsweise mit Zweidrittelmehrheit abgegangen werden darf, die ÖVP zusätzlich eine Zweidrittelmehrheit bei Wiederwahl dreimal hintereinander (§ 25, Abs. 1).
Das eigentliche Problem für die demokratische Relevanz besteht freilich im Spannungsverhältnis zwischen sachkundigen, „technokratischen“ Kandidaten, die eine Partei etwa als Experten in der Legislative braucht und jenen, die auf eine Zustimmung oder berufliche Bindung von Mitgliedern und Wählern bauen können. So stehen sich zwei Parlamentsmodelle gegenüber: das elitäre Technokratenparlament und das repräsentativere Haus der „Volksvertreter“. Zunehmender Sachzwang und der Trend zu Wählerparteien wird aber hier zu einem Neuüberdenken der Situation führen: die autonome Entscheidung, wer ins Parlament einzieht, darf einerseits nicht von einem ganz kleinen Parteigremium gefaßt werden, darf aber auch nicht zu einem Popularitätsentscheid für biertischtüchtige Mini-Funktionäre werden. Letztlich wird nur eine umfassende Wahlreform in Richtung eines persönlichkeitsorien-tierten Systems Erfolg versprechen. Die Vorwahlen im neuen ÖVP-Sta-tut sind, wenn sie zum festen, verpflichtenden Bestandteil werden, jedenfalls ein überaus erfreulicher Ansatz dazu.
3. Der dritte Fragenkomplex in den Statuten sind die Einflüsse von Lobbies, Interessenten und Finanzgruppen auf die Entscheidungsvorgänge. Hier baut das neue ÖVP-Sta-tut keineswegs vor: der bündische Proporz wurde noch weiter verankert (auch wenn von „Teilorganisa? tionen“ die Rede ist), die Beibehaltung der Spendenautonomie auf jeder Parteiebene, das Festhalten am Verbot von lukrativen Parteiunternehmen wird die ÖVP nicht aus dem Dunstkreis ihrer Geldgeber lösen. Die Bestimmungen über die Finanzgebarung im neuen Statut sind (absichtlich?) sehr vage, eine umfassende Veröffentlichung der Gebarung ist jedenfalls nicht vorgesehen.
Zur Frage der Fremdbestimmung politischer Willensbildungsprozesse gehört aber ohne Zweifel auch die Problematik des Klubzwangs11. Die im SPÖ-Statut verankerte Verpflichtung des Kandidaten, schriftlich die Partei zu ermächtigen, „in seinem Namen alle auf das Mandat bezüglichen Erklärungen abzugeben“
(§ 52, Abs. 3), steht in krassem Widerspruch zur Bundesverfassung, die im Art. 56 B-VG. ausdrücklich festhält, daß Parlamentarier „bei der Ausübung dieses Berufes an keinen Auftrag gebunden“ sind. (Zuletzt hat der Verfassungsgerichtshof auch im Falle Olah in dieser Richtung entschieden.)
Gerade an solchen wunden Punkten der Verfassungswirklichkeit aber erweist sich die Offenheit einer Gesellschaft für einen besseren demokratischen Standard. Hier wäre es Aufgabe und Funktion von Statuten, nicht nur programmatische Leerformeln zur Demokratie abzugeben, sondern in der konkreten Ausgestaltung des innerparteilichen Lebens Demokratie praktisch zu verwirklichen.
Bert Brecht meint: Alle Gewalt geht vom Volke aus. Aber wo geht sie hin?