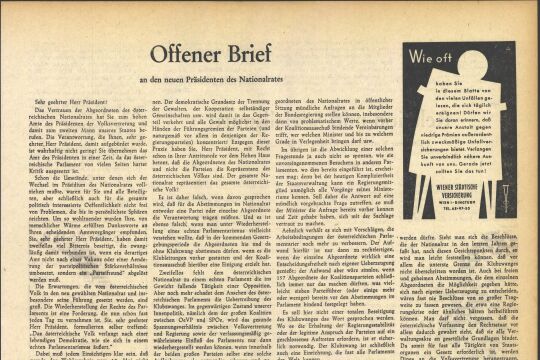„Noch niemals ist bei uns so viel von Reformen gesprochen worden.“ Mit diesem auch für Österreich gültigen Satz beginnt ein Aufsatz, den ein konservatives Mitglied des deutschen Bundestages kürzlich veröffentlichte (Olaf von Wrangel, „Die Zeit“, vorn 30. Mai 1969).
Nicht zulässig wäre hingegen die Behauptung, daß noch niemals so viele Reformtaten gesetzt wurden, wie in der Gegenwart. Ganz im Gegenteil.
Und dies hat zur Folge, daß das Mißverhältnis zwischen Reformworten und Reformtaten immer eklatanter wird. Während konservative Gemüter daraus den Schluß ziehen, man solle mit Worten etwas zurückhaltender sein, meinen andere — zu denen auch der Schreiber dieser Zeilen zählt —, man müsse endlich auch Taten folgen lassen. Dies alles gilt nicht nur für den Bereich der Demokratiereform, aber auch für diesen.
Im Hinblick auf die intensive Derno- kr a tiereform -.Diskussion und die Fülle der Reformvorschläge ist die Frage naheliegend: Woran scheiterten eigentlich die Ansätze für eine echte Demokratiereform?
In einer Diskussion auf Hochschulboden wunde diese Frage kürzlich von studentischer Seite mit der Antwort vom Tisch gefegt: „Diejenigen, die Reformen wollen, haben nicht die Kraft dazu; diejenigen, die die Kraft haben, wollen die Reformen nicht.“
Aber, obwohl die Divergenz zwischen Können und Wollen zugegebenermaßen bei allen Reformprojekten eine beachtliche Rolle spielt, liegen die Dinge hier nicht so einfach. Gerade in. letzter Zeit haben nicht etwa nur Außenseiter, sondern Spitzenfunktionäre der politischen Parteien der Öffentlichkeit Reformideen vorgetragen.
Der Klubobmann und Generalsekretär der ÖVP, Dr. Withalm, tat dies in einer vielbeachteten Rede vor dem. Bundesparteirat der ÖVP um 7. März 1969: Er stellte dabei den Gedanken einer Einschränkung der parlamentarischen Immunität, die Einführung VOTĮVorzugsstimmen im Rahmen des bestehenden Wahlrechtes, die Einführung einer Altersgrenze im Parteistatut der ÖVP, die Klärung der Rechtsstellung der politischen Parteien, die Institution des befristeten Mandats und die Frage der Pölitikerbesteuerung zur Diskussion.
Die Abgeordneten Dr. Broda und Leopold Gratz, zwei ganz hervorragende Kenner des österreichischen Parlamentarismus, haben gleichfalls ein Konzept vorgelegt und sich außerdem der Mühe einer Konkretisierung der meisten ihrer Vorschläge unterzogen.
Die Schwerpunkte ihres Programms sind:
Änderung des Wahlrechtes im Sinne einer Verbindung von Persönlich- keits- und Listenwahlrecht, ähnlich dem bundesdeutschen Wahlrecht;
Einführung permanenter Sessionen irh Nationalrat;
Schaffung von parlamentarischen Kommissionen;
Verbesserung der Geschäftsordnung des Nationalrates;
Verstärkung der Mitwirkung des Nationalrates an der Vollziehung;
Erweiterung der parlamentarischen Kontrollrechte;
Stärkung des Bundesrates;
Wahl eines Parlamentsbeauftragten für Verwaltungsreform und eines Anwaltes des öffentlichen Rechtes durch die Bundesversammlung usw. Obwohl ich die Vorschläge von Broda und Gratz — mit Ausnahme des letzten Punktes — durchwegs bejahe und auch die Anliegen von Dr. Withalm für sehr diskussionswert hailte, bin ich gezwungen, mir eine Kontrollfrage zu stellen:
Nehmen wir einen Augenblick an, es gelänge oder es wäre bereits gelungen, beide Programme zu realisieren; Zweifellos hätte man dann einige „Steine des Anstoßes“ aus den Augen der öffentlichen Meinung geräumt (Vorschläge Withalm) und den Aktionsradius der parlamentarischen Arbeit erweitert (Vorschläge Broda — Gratz). Aber ist man damit zu den eigentlichen Kernfragen der Demokratie und der Demokratiereform vorgestoßen?
Funktioniert etwa die Demokratie in Deutschland, wo es das hier skizzierte Wahlrecht, wo es eine starke Zweite Kammer, einen Parlamentsbeauftragten und ein Parteigesetz bereits gibt, besser als bei uns?
Oder beginnen die eigentlichen Probleme der Demokratisierung nicht erst dort, wo die Möglichkeiten institutioneller Reformen bereits erschöpft sind?
Das demokratische Prinzip kann unter den verschiedensten institutionellen Formen gedeihen; eines ist allen diesen Institutionen jedenfalls gemeinsam: die Problematik einer einwandfreien egalitären Willensbildung. Ob die Institution nun Parteivorstand, Bundesparteileitung oder Zentralkomitee heißt, ob es sich um den Vorstand einer Jugendorganisation, die Bischofskonferenz, das Professorenkollegium einer Hochschule oder um eine Parlamentsfraktion handelt: sie alle haben mit dem Problem formell gleicher, in Wirklichkeit jedoch ungleicher Machtverteilung durch Machtkonzentration und Tendenzen zur Oligarchie zu kämpfen. Weil diese abgestufte Einflußnahme, dieses Entscheidungsgefälle sich um so stärker ausprägt, je größer ein Gremium ist (auf einem Parteitag stärker als in einem Parteivorstand, in einer Sektionsvollsammlung mehr als in einem Sektionsausschuß), darum ist die plebiszitäre Willensbildung der Manipulation am meisten ausgesetzt.
Die repräsentative Demokratie reduziert die Manipulierbarkeit plebiszitärer Entscheidungen durch deren Übertragung auf ein Gremium von durch Wahl legitimierten Vertretern.
Sie bezahlt diesen Vorteil mit einer im Modell keineswegs vorhergesehenen Undurchsichtigkeit der Entscheidungskriterien und des Entscheidungsmechanismus sowie mit der Problematik des Wahlaktes als solchen.
Häufig läßt sich nicht einmal der Ort der Willensbildung einwandfrei feststellen: Die Entscheidung, die 40-Stunden-Woche am 1. Jänner 1975 einzuführen, wird voraussichtlich letzten Endes im Bundesgesetzblatt verlautbart werden. Aber wo ist die Entscheidung wirklich gefallen: im Parlament, in der Regierung, durch das Volksbegehren, zwischen den Sozialpartnern oder in den Parteien?
Die bewußte Bekämpfung von Oligarchie- und Konzentrationstendenzen in allen Bereichen und auf allen Ebenen kollegialer Willensbildung sowie die Durchschaubarkeit dieser Willensbildung gehören daher zu den Grundvoraussetzungen für demokratisch einwandfreie Entscheidungen.
Dieser Gesichtspunkt erscheint mir jedenfalls größere Bedeutung zu haben als jede — überspitzt formuliert — „institutionelle Kosmetik“. Dies übrigens auch aus der Überlegung heraus, daß das bestehende Demokratiemodell, das seit fünf Jahrzehnten im wesentlichen (und von Unterbrechungen abgesehen) unverändert geblieben ist, heute mit vielfach größeren Machtkonzentrationen, aber auch Manipulationsmöglichkeiten konfrontiert ist als zur Zeit seiner Konzipierung. Es muß daher die Radikalität der Reformen mit der Radikalität dieser Machtkonzentra- fionen zumindest Schritt halten, wenn das „demokratische Niveau“ in unserer Gesellschaft nicht insgesamt absinken soll.
An diesem Punkt stellt sich auch die Methodenfrage: Demokratisierung durch Reform der Institutionen oder — umgekehrt — Reform der Institutionen als logisches Produkt einer vorangegangenen Basisdemokratisierung?
Ohne die Sekundärwirkungen von echten institutionellen Reformen ge- ringzuachten — vor allem, wenn es sich um strategisch wichtige Institutionen handelt —, dürfen wir unsere Augen vor einem überaus instruktiven Exempel nicht verschließen:
Vor dem sehr plastischen Anschauungsunterricht an den Hochschulen, wo nicht etwa eine aus eigenen Kräften erfolgte Reform der Institutionen eine Veränderung des geistigen Klimas hervorgerufen hat, sondern wo — ganz im Gegenteil — ein neuer und fester Wille zur Demokratisierung und zur Mitbestimmung auch im Rahmen der bestehenden Institutionen grundlegende Verände-
rungen hervorgerufen hat: Dieses unübersehbare Faktum verlangt nach Berücksichtigung und nach theoretischer Durchdringung.
Im Bereich des Parlamentarismus und der Parlamentsreform muß noch auf ein Sonderproblem verwiesen werden: auf das Spannungsverhält- nis zwischen maximaler Demokratisierung und maximaler Effizienz der parlamentarischen Arbeit.
Viele Vorschläge, die in Konzepten für eine Parlamentsreform, für eine Stärkung des Parlaments enthalten sind, können nur schwer mit der Forderung nach Demokratisierung vereinbart werden: Die Forderung nach einer Verlängerung der Gesetzgebungsperiode, um große gesetzgeberische Vorhaben ohne Zeitdruck beraten zu können, reduziert die Chance der Wähler auf Sanktionen gegenüber den Gewählten.
Die verstärkte Einflußnahme zentraler Parteiinstanzen auf die Kandidatenauswahl im Sinne einer ausgewogenen und kompetenten Zusammensetzung des Nationalrat es reduziert die Einflußnahme der Wähler auf die Gewählten.
Eine stark entwickelte Arbeitsteilung in den parlamentarischen Fraktionen fördert die Spezialkenntnisse der Abgeordneten auf bestimmten Sachgebieten, fördert aber gleichzeitig die Entwicklung vom Volksvertreter zum Legislativexperten, dessen Entscheidungen und Ratschläge nicht nur für seine Wähler, sondern auch für einen wachsenden Teil seiner Fraktionskollegen unüberprüfbar werden.
Nebenwirkung: Der heißumstrittene sogenannte . Klubzwang verliert immer mehr an Bedeutung und macht einem komplizierten System des Sich-giegenseitigen-Verlassens auf die zuständigen Experten der Fraktion Platz.
Das hier angedeutete Spannungsverhältnis zwischen Effizienz und De- mokratiepostulaten kann — wenn überhaupt — nur auf einer höheren Ebene gelöst werden:
Auf der Ebene einer intensivierten Anteilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten, einem verstärkten demokratischen Engagement, so daß auch der „Profl-Parlamentarier“, der es an Sachkenntnissen und Qualifikation, aber auch an Zeiteinsatz mit den Professionals der Bürokratie und der Interessenvertretungen aufnehmen kenn, dennoch nicht in Gefahr gerät, sich völlig von Kontrolle und demokratisch-kollegialer Willensbildung zu emanzipieren.
Aus dem vorstehend Gesagten ergibt sich m. E. die Schlußfolgerung, daß institutionelle Reformen, die zur Zeit im Vordergrund der Diskussion stehen, auf zwei Ebenen gesehen werden können. Entweder es handelt sich um geringfügige Verbesserungen bestehender Institutionen, die im wesentlichen dem reibungslosen Funktionieren oder einer gewissen Stärkung eben dieser Institutionen dienen. Solche Verbesserungen — so begrüßenswert sie im Ein- zelfali sein mögen — als „Demokratiereform“ zu bezeichnen, ist eindeutig zu hoch gegriffen und bedeutet Quantität mit Qualität verwechseln.
Oder es handelt sich um tiefgreifende Reformen, die in der Lage sind, Eigengesetalichkeiten zu entwickeln und Sekundärwirkungen hervorzurufen, wie dies zum Beispiel bei Änderungen in der Parteistruktur, bei der Kandidatenauswahl oder auch auf dem Sektor der wirtschaftlichen Mitbestimmung der Fall wäre. Solche Änderungen werden wahrwahrscheinlich nicht Ausgangspunkt, sondern nur End- oder Zwischenprodukt von echtem Demokratiewillen und vor allem echter „Demokratiecourage“ sein.
In der als Bonmot gedachten Definition „Demokratie ist angewandte Zivilcourage“ steckt nämlich ein großes Stück Wahrheit.
Somit bleibt auf lange Sicht die Frage, ob die Demokratie in unserem
Land den konstatierten Tendenzen zur Verfestigung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse noch Einhalt gebieten kann oder ob sie aus eigener Kraft zu echten Reformen nicht mehr fähig ist.
Auch wenn die gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse in den modernen Industrieländern erstmals in der Geschichte derart sind, daß sie scheinbar keine Basis für revolutio-
näre Veränderungen bilden, soll man sich hüten, die eben gestellte Frage vorschnell zu beantworten.
Kann das Demokratieproblem nicht evolutionär gelöst werden, dann wäre die bestehende pluralistische, postkapitalistische Gesellschaftsordnung jedenfalls nicht die erste, die das, was sie an evolutionären Reformen schuldig geblieben ist, in Form von revolutionären Umwälzungen oder zumindest Erschütterungen zurückzahlen muß, weil sie nicht über den Schatten der in ihr vorherrschenden Interessen springen konnte.
Dr. Heinz Fischer ist Sekretär des SPÖ-Abgeordnetenklubs im Natio nalrat. In zahlreichen Beiträgen — vor allem im theoretischen Organ der SPÖ, der „Zukunft“ — beschäftigte er sich bereits mit Fragen des Parlamentarismus.