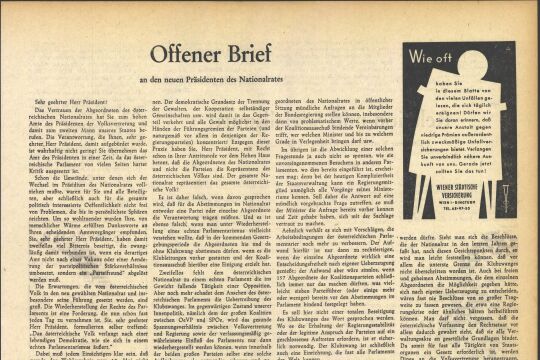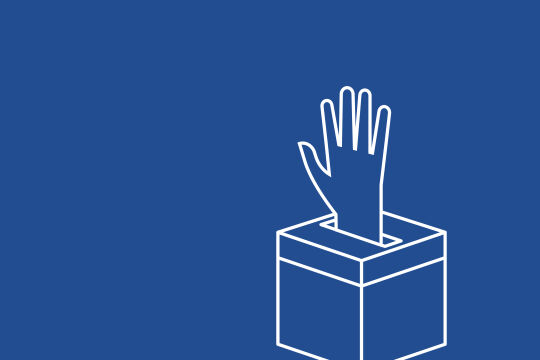"Das Unbehagen mit dem Parlamentarismus entspringt in erster Linie einem Parlamentsverständnis, in dem das Verfassungsdenken der konstitutionellen Monarchie auch noch nach einem Dreivierteljahrhundert parlamentarischer Demokratie weiterlebt."
Trotz Schelte vom Finanzminister: Sommerpause im Parlament. Zuvor aber noch ein Resümee.
Das Ende des Parlamentsjahres ist Anlass für Zwischenbilanzen: Der Parlamentspräsident gibt eindrucksvolle Daten über das Ausmaß der parlamentarischen Aktivitäten der vergangenen Session bekannt. News kürt auf Basis der gehaltenen Parlamentsreden die angeblich fleißigsten und faulsten Abgeordneten. Die parlamentarischen Steuermänner der Koalition, Khol und Westenthaler, zeichnen das Bild einer eindrucksvollen Reformbilanz, die Oppositionsparteien wiederum sehen dies genau umgekehrt.
Es wäre aufschlussreich, die ritualisierten parlamentarischen Debatten von Theaterkritikern rezensieren zu lassen. Aber auch Politikexperten erhielten in der vergangenen Parlamentswoche einen guten Überblick über die Verfasstheit von Regierung wie Opposition: Obwohl zahlreiche Schwachstellen der Regierung auf der Hand lagen und in den Medien ausführlich thematisiert wurden (Gaugg, Abfangjäger, Stadlers Geschichtsrevisionismus), gelang es der Opposition nur selten, der Regierung auf parlamentarischem Terrain eine Niederlage zuzufügen. Der SPÖ ist deutlich anzusehen, dass die Fähigkeit, Regierungsarbeit effektvoll und erfolgreich zu kritisieren, im letzten Wahljahr 1999 noch kein zentrales Kriterium für die Kandidatenauswahl gewesen war. Hinter der Klub- und Parteispitze findet sich zwar eine große Zahl an robusten Wahlkreisbetreuern, aber nur eine Minderheit an zugleich routinierten wie inhaltlich versierten und angriffigen Rednern. Diese mussten sich zudem bei zahlreichen Sachfragen vorhalten lassen, was die SPÖ früher selbst vertreten bzw. im gescheiterten Koalitionsabkommen 2000 akzeptiert hatte.
Dass die Grünen in sämtlichen Umfragen markant über ihrem Wahlergebnis von 1999 liegen, lässt sich auch anhand ihres parlamentarischen Auftretens nachvollziehen (die Grünen waren im Nationalrat immer in Opposition, haben diese Rolle also gut gelernt). Bei den Regierungsparteien wurde (zuletzt in der Stadler-Debatte) erneut deutlich, dass der Sprengsatz, an dem diese Koalition scheitern könnte, weniger im Parlament oder unter den Regierungsmitgliedern als im unsichtbaren Gast aus Kärnten zu suchen ist.
Wer war fleißig, wer war faul?
Während News das Image von den zahlreichen faulen und manchen fleißigen Politikern bedient, dokumentiert die Parlamentsstatistik ein beeindruckendes Aktivitätsniveau. Doch diese Zahlen sind nur bedingt aussagekräftig, weil der Großteil der politischen Arbeit der Abgeordneten nicht in den Plenardebatten und Ausschusssitzungen stattfindet: Debatten im Klub und Fraktionssitzungen im Vorfeld der Ausschüsse, Kontaktpflege mit Interessenvertretern, noch mehr aber Termine in diversen Parteigliederungen (essentiell zur Pflege der parteiinternen Hausmacht), Veranstaltungen und Bürgerkontakte sowie Interventionen bei öffentlichen Stellen sind sehr viel zeitaufwendiger als die im engen Sinne parlamentarische Arbeit. Auch im Plenum wortkarge Hinterbänkler sind somit im Regelfall alles andere als "faul". Aber wie bewertet das Publikum, die Wählerschaft, die Qualität des Dargebotenen?
Das Image des Parlaments ist seit jeher zwiespältig: So ergab eine Ende 1997 durchgeführte Repräsentativumfrage, dass zwar 88 Prozent der Befragten die Tätigkeit des Parlaments für wichtig erachteten, aber nur 38 Prozent meinten, der Nationalrat habe so viel Einfluss, wie es in einer Demokratie zweckmäßig sei. 40 Prozent der Befragten wollten eine stärkere Eigenständigkeit gegenüber der Regierung, 32 Prozent hingegen wünschten eine bessere Kooperation. 46 Prozent hatten von der Arbeit des Nationalrats einen guten Eindruck, bei 50 Prozent war dieser Eindruck schlecht. Die Qualität der Debatten wurde von je einem Viertel der Befragten als sehr gut/gut bzw. genügend/nicht genügend beurteilt. Und während sich 85 Prozent für die offene Austragung von Interessenkonflikten aussprachen, bemängelten zugleich 80 Prozent die "Streitereien" und den "Hick-Hack" im Hohen Haus.
Wenig Platz für freies Mandat
Dieses Unbehagen mit dem Zustand des Parlamentarismus entspringt mehreren Wurzeln. Die erste ist ein Parlamentsverständnis, in dem das Verfassungsdenken der konstitutionellen Monarchie (als Parlament und Regierung relativ unabhängig nebeneinander standen, weil die Regierung nur vom Vertrauen des Monarchen abhängig war) auch noch nach einem Dreivierteljahrhundert parlamentarischer Demokratie weiter lebt. Seit die Regierung vom Vertrauen der Mehrheit der Abgeordneten abhängig ist, rekrutiert sie sich vor allem aus deren Spitzenfunktionären. Regierung und Mehrheitsparteien bilden in solchen parlamentarischen Systemen notwendigerweise eine politische Aktionseinheit mit gemeinsamen Zielen. Für ein freies Mandat der Abgeordneten ist hier wenig Platz. Als Kontrollor der Regierung bleibt nur die Opposition über. Diese Überlagerung der Gewaltentrennung zwischen Regierung und Parlament ist aber kein Strukturdefekt, sondern das Funktionsprinzip und Erfolgsgeheimnis parlamentarischer Systeme.
Schwer vereinbar ist die Verfassungswirklichkeit parlamentarischer Systeme aber auch mit dem in der politischen Bildung vermittelten Leitbild von Demokratie als Identität von Herrschern und Beherrschten. Diesem folgend hätten die Abgeordneten möglichst direkt den Willen ihrer Wählerschaft umzusetzen. In der Praxis kann ein solches imperatives Mandat aber eigentlich nur von den Parteien eingefordert werden, was wiederum unter dem Schimpfwort "Klubzwang" häufig kritisiert wird. Gerade die Parteienkritik ist ein Fixpunkt in der öffentlichen Debatte.
Genug Anlass für Ärger
Ein drittes Motiv für Ärgernisse besteht in parteipolitischen Antipathien: Koalitionsregierungen können notwendigerweise nur mittels Kompromissen regieren; Anhänger der Regierungsparteien werden sich zudem immer über Oppositionspolitiker ärgern und vice versa. Dies schafft mannigfache Anlässe für Ärger mit der Regierung und folglich auch mit dem Parlament.
Viertens wird das Parlament zwar gern als "Gesetzgeber" bezeichnet. In der Praxis ist Gesetzgebung aber in allen modernen Demokratien ein breiter Prozess der politischen Entscheidungsfindung, an dem neben fachlich spezialisierten Abgeordneten vor allem Regierung und Verwaltung sowie Interessenverbände maßgeblich beteiligt sind und in dem das Parlament nur bei der endgültigen Festlegung der Gesetzestexte privilegiert ist. Nicht zufällig gilt es daher in Österreich als schwerwiegender Vorwurf, wenn die Parlamentsmehrheit über gesellschaftliche Interessen ohne ernsthafte Verhandlungen oder Kompromissbereitschaft einfach "drüberfährt".
Was aber kann ein Parlament wirklich leisten? Bei Wahlen sollten generell politische Alternativen zur Auswahl stehen, die politisch umgesetzt werden können. Das Parlament muss daher gemeinsam mit der Regierung ein Primat der Politik gegenüber Eigeninteressen der Verwaltung sicherstellen. Die grundsätzlichen Leitbilder der Regierungspolitik sollten aus dem Parlament kommen. Dies gilt besonders dort, wo es nicht um kleine Gesetzesanpassungen, sondern um wirtschafts- und gesellschaftspolitische Gestaltung geht. Dass die Details der Gesetzesformulierung von Verwaltungsbeamten besorgt werden, spielt daneben nur eine untergeordnete Rolle. Die konträren politischen Entwürfe der Parteien sollten im Parlament deutlich artikuliert werden. Weiters sollen Abgeordnete die Interessen ihres Wahlkreises oder ihrer sozialen Großgruppen in den politischen Prozess einbringen, also die Verbindung zwischen Exekutive und Bevölkerung herstellen. Nicht zuletzt sollte die Opposition wirksame Mittel in der Hand haben, um die Regierung zu kontrollieren.
Allgemeines fürs Fernsehen
Dem Nationalrat erfüllt diese Aufgaben durchaus passabel. Die Bedeutung spezialisierter Abgeordneter hat bei der Formulierung von Gesetzen sogar zugenommen. Während der großen Koalition ab 1987 ging allerdings für viele Wähler die Unterscheidbarkeit zwischen den Großparteien verloren. Deswegen konnte besonders die FPÖ seit den frühen neunziger Jahren das Parlament immer perfekter als Bühne für eine radikale Oppositionspolitik nutzen. Seit Februar 2000 wiederum wurden Debatten zwischen Regierung und Opposition noch häufiger als zuvor auf parlamentarischer Bühne geführt, da auch die Regierungsspitze selbst dieses Forum gerne wählt.
Parlamentarische Debatten, die vom ORF live übertragen werden, bilden allerdings häufig nur den rituellen Abschluss öffentlicher Debatten. Vor allem bei wichtigeren Gesetzen ist das Thema zuvor schon ausführlich in der Medienöffentlichkeit diskutiert worden. Folglich wird in den Debattenbeiträgen eher eine allgemeine Abrechnung mit der Gegenseite an Stelle einer detaillierten Diskussion der Vorlage versucht. Letztere würde beim Publikum mangels Hintergrundwissen meist ohnehin nur Unverständnis auslösen. So bleibt es während der Fernsehübertragungen meist beim öffentlichkeitswirksamen Schlagabtausch. Ohne die Warnung freilich, nicht alles für bare Münze zu nehmen und dem Ratschlag, das Dargebotene doch eher mit den Augen eines Theaterkritikers zu verfolgen.
Der Autor ist Politologe und Lektor an der Uni Wien sowie Verfasser zahlreicher Publikationen, zuletzt: "Politik in der kleinen Einheit. Wien, Innere Stadt", Braumüller-Verlag 2002.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!