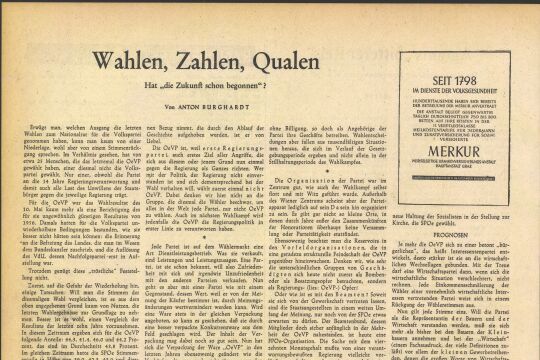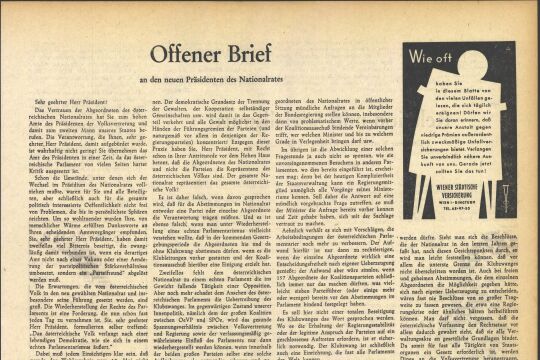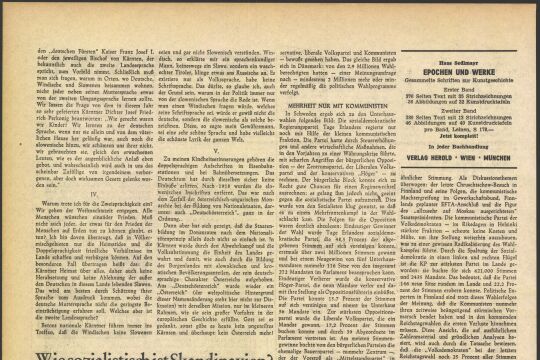Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Reform im zweiten Anlauf
Nach den gescheiterten Bemühungen um eine Wahlrechtsreform in der vergangenen Legislaturperiode unternimmt die Koalition jetzt einen zweiten Anlauf. Im Koalitionsabkommen für die XVIII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates heißt es dazu: „Die beiden Regierungsparteien bekennen sich zu einer grundlegenden Reform des österreichischen Wahlrechts. Die-
se Reform muß insbesondere folgenden Anforderungen entsprechen:
1. Durch wesentlich kleinere Wahlkreise soll der persönliche Kontakt zwischen Wählern und Gewählten verbessert werden.
2. Durch ein ausgebautes Vorzugsstimmensystem soll der Wähler verstärkten Einfluß auf die tatsächliche Zusammensetzung des Nationalrates haben.
3. Die Mandatsvergabe soll auf drei Ebenen erfolgen und zwar:
• auf der Ebene der Wahlbezirke mit regionalen Faktoren im Vordergrund,
• auf der Ebene der Bundesländer als historisch gewachsene Einheiten des politischen Systems und
• auf einer gesamtösterreichischen Ebene, nämlich einer Bundesliste, die es den wahlwerbenden Parteien ermöglicht, besondere Erfordernisse bei der Zusammensetzung einer Parlamentsfraktion (Experten, Frauen, Minderheiten et cetera) zu berücksichtigen."
Dann folgen weitere Hinweise auf Einzelheiten des geplanten Wahlrechtes, unter anderem eine Vier-Prozent-Klausel.
Warum ein zweiter Anlauf, wenn man die Ziele des Koalitionsabkommens vom Jänner 1987 auf dem Gebiet des Wahlrechtes nicht verwirklichen konnte?
Wird das Koalitionsabkommen in diesem Punkt nicht neuerlich un-verwirklicht bleiben?
Das österreichische Wahlrecht ist im Prinzip 70 Jahre alt. Kaum ein Parlament in Europa - das Britische Unterhaus ausgenommen -wird nach einem siebzig Jahre alten Wahlrecht gewählt. Die Wahlrechtsreform von 1970 kann nicht als substantielle Veränderung unseres Wahlsystems bezeichnet werden; sie mußte - mangels Zustimmung der ÖVP - die verfassungsrechtlichen Bestimmungen unverändert belassen und sich auf einfach gesetzliche Korrekturen beschränken. Das Wahlrecht wurde zwar ein bißchen „gerechter" - das heißt, die Verteilung der Mandate entspricht seither in höherem Maße der Verteilung der Wählerstimmen - aber es wurde nicht besser und es änderte sich nichts am System.
Das im Koalitionspakt von 1987 enthaltene Wahlrechtsmodell mit 100 (statt derzeit neun) Wahlkreisen, in denen jeweils der Kandidat mit den meisten Stimmen als gewählt gilt, während der Rest der Mandate für den sogenannten Proportionalausgleich verwendet werden sollte, um dem Grundgedanken des Verhältniswahlrechtes Rechnung zu tragen, wäre eine echte Neuerung geweseij; es hätte echte Vorteile gebracht (kleinereWahl-kreise personenbezogene Wahl Werbung, auch eine stärker personenbezogene Verantwortung des Abgeordneten) aber auch einige Nachteile, wie zum Beispiel die Tatsache, daß bestimmte Regionen fast ausschließlich von SPÖ-Mandata-ren, andere Regionen ebenso vorwiegend von ÖVP-Mandataren im Parlament vertreten gewesen wären; außerdem hätte es zum Phänomen der sogenannten Überhangmandate kommen können, das
heißt, daß auf die mit Abstand stärkste Partei in einer bestimmten Region mehr Direktmandate entfallen, als ihr nach dem Prinzip der Verhältniswahl zukommen würden, sodaß ein „Vorgriff" auf den Topf der Bundesrestmandate zugunsten eines Bundeslandes gemacht werden muß, oder die Zahl von 183 Mandaten überschritten werden müßte, um das System der Verhältniswahl nicht zu verletzen.
In Summe schienen mir aber die Vorteile dieses Systems gegenüber dem Nachteil deutlich zu überwiegen. Daher war bei den Koalitionsverhandlungen 1990 ernsthaft zu jrüfen, ob man einen zweiten Anlauf für das gleiche Reformmodell nehmen sollte. Es muß an dieser Stelle hinzugefügt werden, daß auch die ÖVP, die das Hundertwahlkreisemodell in der zweiten Hälfte der vorigen Legislaturperiode mehr
oder weniger offiziell verworfen hatte, bei den jüngsten Koalitionsverhandlungen zu nochmaligen ernsthaften Gesprächen über dieses Modell bereit war.
Daß man sich nach mehreren Verhandlungsrunden schließlich doch einvernehmlich auf das eingangs skizzierte neue Modell mit knapp 50 Wahlkreisen einigen konnte, hatte vor allem folgende Gründe.
1. Es erschien nicht sehr elegant und glaubwürdig, ein Wahlrechtsmodell, das man im Jänner 1987 in das damalige Koalitionsabkommen geschrieben hatte, dann aber nicht verwirklichen konnte/wollte, im Dezember 1990 mehr oder weniger unverändert neuerlich zum Inhalt eines Koalitionsabkommens zu machen, ohne die Frage beantworten zu können, warum eigentlich die Chance zur Verwirklichung dieses Modells jetzt größer sein sollte als vor vier Jahren.
2. Das Problem der sogenannten Überhangmandate, das oben kurz erwähnt wurde, ist umso gravierender, je größer der Vorsprung der stärksten Partei vor der zweitstärksten Partei ist; da sich dieser Vorsprung bei der letzten Nationalratswahl deutlich vergrößert hat, ist auch dieses Problem gravierender geworden.
3. Die Einflußnahme des Wählers auf die Entscheidung, wer einen Wahlkreis im Nationalrat vertreten soll, reduziert sich beim Wahl-rechtmit 100 Einerwahlkreisen auf eine Entscheidung zwischen je ei-
nem von jeder wahlwerbenden Partei präsentierten Kandidaten; will man eine gewisse Personenauswahl auch innerhalb der Kandidaten einer wahlwerbenden Partei ermöglichen, dann muß man eine Mehrzahl von Kandidaten im Rahmen einer kleinen Kandidatenliste anbieten und ein funktionsfähiges System der Auswahlmöglichkeit durch Vorzugsstimmen oder durch Reihen und Streichen hinzufügen.
Der letzte und schwierige Teil der Verhandlungen über die Wahlrechtsreform im Rahmen der Koalitionsgespräche konzentrierte sich auch auf die Ausgestaltung und Funktionsweise eines Systems an Vorzugsstimmen.
Die vorstehend genannten drei Punkte waren die wesentlichen Überlegungen, die dazu geführt haben, daß dem Wahlrechtsvorschlag der Koalitionsparteien ein dreistu-
figes Modell zugrundeliegt, wo zunächst in etwa fünfzig Wahlbezirken jede Partei eine kleine Liste von etwa vier bis acht Kandidaten anbietet, wobei ein Vorzugsstimmensystem dafür sorgt, daß nicht nur der Erstgereihte Chancen hat, gewählt zu werden; in diesen fünfzig Wahlbezirken werden vermutlich etwa 90 bis 100 Bezirksmandate vergeben, wobei auch die zweitstärkste Partei - und in einzelnen Wahlkreisen vielleicht auch die drittstärkste Partei - die Chance hat, in adäquater Weise Bezirksmandate zu erhalten.
Rund 60 Mandate werden dann von „Landeslisten", die mit den Bundesländern identisch sind, vergeben, und ein Rest von etwa 25 bis 30 Mandaten wird von einer gesamtösterreichischen Bundesliste zur Vergebung gelangen, wobei diese Bundesliste vom Standpunkt des Wahlsystems die Aufgabe hat, das Prinzip der Proportionalität sicherzustellen, vom Standpunkt der einzelnen wahlwerbenden Parteien aber vor allem die Aufgabe hat, sogenannte „Bundesnotwendigkeiten" zu erfüllen. Es muß darauf hingewiesen werden, daß der Anteil der „Bundesmandate" bei den kleinen Parteien, proportional gesehen, größer sein wird als bei den großen Parteien - als Spiegelbild der Tatsache, daß die direkten Bezirksmandate vor allem von den stimmenstärksten Parteien erobert werden können.
Eine Vier-Prozent-Klausel soll
dafür sorgen, daß das Prinzip des Verhältniswahlrechtes nicht bis zur restlosen Zersplitterung in Klein-und Kleinstparteien führt.
Der Zeitplan sieht bekanntlich so aus, daß sich die Koalitionsparteien verpflichtet haben, ein Wahlgesetz auf der Basis dieser Prinzipien bis Mitte Juni im Nationalrat einzubringen. Diese Vorlage könnte daher noch vor dem Sommer dem zuständigen Ausschuß zugewiesen werden, sodaß ab Herbst 1991 die parlamentarischen Beratungen über diese Materie beginnen können.
Auch wenn dieser Darstellung hinzugefügt werden muß, daß natürlich so mancher Teufel und so manches Teufelchen noch im Detail stecken wird und daß man auch gegen dieses Modell die eine oder andere Einwendung formulieren kann, weil es letztlich überhaupt kein Wahlrecht gibt, das nur Vorteile und keine Nachteile hat, so scheint dies doch ein Modell zu sein, dem man einige wichtige Pluspunkte nicht absprechen kann:
• Es bringt deutlich kleinere Wahlkreise beziehungsweise Wahlbezirke und verbessert damit die Kontaktmöglichkeiten zwischen Wählern und Gewählten;
• Es bringt zusätzliche Einflußmöglichkeiten des Wählers auf die tatsächliche Zusammensetzung des Nationalrates, weil zum jetzigen Vorzugsstimmensystem auf Landesebene (das sich als nicht sehr wirksam erwiesen hat) ein stärkeres Vorzugsstimmensystem auf Wahlbezirksebene hinzukommt.
• Es beseitigt einige arithmetische Ungereimtheiten und Anomalien des jetzigen Wahlrechtes.
Auf der anderen Seite - und dies soll als Einwand gegen allzu radikale Wahlrechtsvorschläge nicht unterschätzt werden - zwingt es die wahlwerbenden Parteien und die parlamentarischen Fraktionen nicht zu einer Selbstamputation in einem Ausmaß, daß die Realisierungschancen eines solchen Vorschlages neuerlich unter 50 Prozent sinken. Daher läßt sich das Wahlrechtsmodell auf den Punkt gebracht wie folgt zusammenfassen: besser als das bisherige System und obendrein realisierbar.
Der Autor ist Erster Präsident des Nationalrates. Eine erste Analyse zum Thema wurde in FURCHE 50/1990 veröffentlicht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!