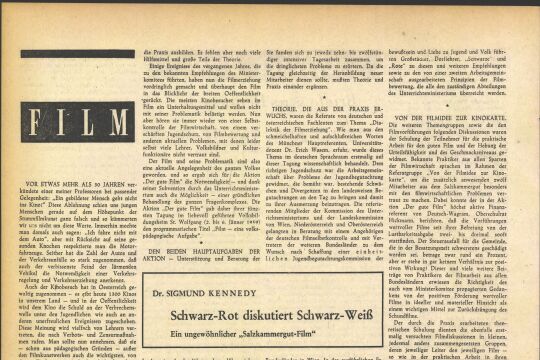Wann nicht der Traumjob immer paßt
Arbeit, sagen Wirtschaftspsychologen, ist primär das, was sich jeder darunter vorstellt. Klischees und falsche Ideale lassen sich durch gezielte Maßnahmen abbauen.
Arbeit, sagen Wirtschaftspsychologen, ist primär das, was sich jeder darunter vorstellt. Klischees und falsche Ideale lassen sich durch gezielte Maßnahmen abbauen.
Eltern raten ihren Sprößlingen oft, die Schul- oder Studienzeit zu genießen. Der Ernst des Lebens beginne ohnehin früh genug. Oder sie sollen ihre Ausbildung möglichst rasch durchlaufen, um bald Geld zu verdienen. Im Beruf finde man dann schon genug Zeit für Hobbys oder was sonst in der Freizeit Spaß macht.
Das ist ein Trugschluß. Als Anwärter für den Sprung in das Arbeitsleben kann man nicht früh genug beginnen, sich mit der Berufsweit wenigstens einmal theoretisch auseinanderzusetzen. Jeder, der in absehbarer Zeit die Berufswahl zu treffen hat, sollte sich zuerst fragen, was Arbeit für ihn überhaupt bedeutet. Ist sie beispielsweise
• bloße Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu bestreiten?
• finanzielle Voraussetzung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung?
• Mittel zur Selbstverwirklichung?
• Übernahme einer gesellschaftlichen Verpflichtung, weil „Nichts-Tun“ derzeit von der Gesellschaft (noch) negativ beurteilt wird?
• Gelegenheit, Kontakte mit anderen Menschen zu knüpfen?
Demoskopische Untersuchungen in Österreich und der Bundesrepublik Deutschland haben gezeigt, daß sich bei der Einschätzung von Berufsbildern die Befragten vielfach an Klischees und Idealen orientieren.
Bei der Frage, was das Wichtigste im Beruf ist, setzten die meisten - vom Beruf sneuling bis zum Arbeitsprofi - das Kriterium „sinnvolle Tätigkeit“ an die erste Stelle. Für diese Entscheidung hat Otmar Pichler vom Institut für Personalentwicklung an der Wirtschaftsuniversität Wien eine schlichte Erklärung. „Einen interessanten Beruf hat man aus Prestigegründen einfach zu wollen. Wer gibt schon gerne zu, daß er für sein Leben gerne Buchhalter wäre oder Beamter? Einen ruhigen, durchaus nicht abwechslungsreichen Job haben mochte?“
Der erste Schritt zur Laufbahnplanung ist somit eine gezielte Stärken-Schwächen-Analyse, um die eigenen positiven Eigenschaften und Unzulänglichkeiten herauszukristallisieren. Nachdenken über sich selbst ermöglicht es, die Grundzüge seines Charakters besser kennenzulernen. Man kommt mit sich selbst besser zurecht. Wer sich über seine grundlegende Wesensart ein Leben lang etwas vormacht, sät permanent inneres Konfliktpotential.
Eine Möglichkeit der Selbstbeschreibung ist eine — beliebig verlängerbare - Check-Liste (siehe Kasten). Da diese Uberprüfung natürlich keine Psychoanalyse ist, sieht sich jeder durch die eigene Brille. Um nicht selektiv wahrzunehmen, ist es ratsam, diese Auflistung anderen Menschen wie Freunden, Bekannten, dem Ehepartner (die nicht immer nur zum Ausjammern „benutzt“ werden sollten) zum Gegentest vorzulegen.
Mit diesem Gegenüber - wer immer es ist - sollte möglichst ohne drohenden, vorwurfsvollen oder strafenden Unterton über die Ergebnisse diskutiert werden können.
So wird vielleicht festgestellt, daß man gerne gute Eigenschaften hervorhebt, Unzulänglichkeiten jedoch herunterspielt. Oder bemerkt, daß man durch die Erziehung darauf getrimmt wurde, bescheiden zu sein, Positives lieber nicht allzusehr hervorzuheben. Es stellt sich vielleicht auch heraus, wie gut manche Fähigkeiten ausgeprägt sind, die bisher gar nicht als wichtig empfunden wurden. Vermißt aber andererseits Talente, die andere haben, die man als erfolgreich im Beruf einschätzt.
Natürlich wird es Unterschiede zwischen der Selbst- und der Fremdeinschätzung geben. Sie lassen sich auch gar nicht vermeiden. Wichtig ist, nicht nur Schwächen aufzureißen oder nur die Stärken zu betonen. Da kann die Liste mitunter recht lang werden. Das verführt dazu, unnötig viele Energien dafür zu verwenden, solche Unzulänglichkeiten auszubügeln, nur um sich der Idealvorstellung seiner selbst anzunähern.
Eine weitere Möglichkeit, selbstbewußter zu werden, ist die Analyse des bisherigen Werdeganges. Wie intensiv kann man sich an prägnante Ereignisse, an Schnittstellen erinnern? Die Wahl des Schultyps zum Beispiel, oder der Studienrichtung. Wer war an solchen Entscheidungen maßgeblich beteiligt? Wurde man oft von den Eltern, den Lehrern „gezwungen“, etwas zu tun? Gab es Entscheidungsalternativen, und warum wurden sie nicht mitberücksichtigt?
Das Zentrum für Berufsplanung an der Wiener Wirtschaftsuniversität arbeitet beispielsweise im Rahmen eines Seminars mit intuitiven Methoden und versetzt dabei die Studenten in einen meditativen Zustand. Derartige Analysen und neue Methoden werden jedoch kaum von öffentlichen Bildungsinstitutionen wie Volkshochschulen angeboten. Es gibt sie durchwegs nur für Führungskräfte oder Manager. (Solche Seminare veranstalten die Grazer Akademie für Führungskräfte, das Managementinstitut der Industrie oder die Gesellschaft für Personalentwicklung in Wien.)
Aber solche Rückblenden kann man durchaus auf unkonventionelle Art selbst machen. Durch Aufzeichnungen und Notizen im stillen Kämmerlein, durch Gespräche mit den vorhin erwähnten Freunden und Bekannten.
Meist läßt sich bei der Durchsicht des bisherigen Lebens auch ein roter Faden an Verhaltensweisen, Eigenschaften, Situationen herausdestillieren. Daraus ergeben sich Schlußfolgerungen über Eigenschaften wie Entschluß- und Entscheidungsfreude, Durchsetzungsvermögen, Fremdbestimmung, Wahrnehmung von Alternativen usw. Die Auswertung solcher Daten und Erkenntnisse ermöglicht in der Folge die Zeichnung eines Berufe^ den man gerne ausüben möchte. Einen Beruf, der nicht nur auf der fachlichen Ausbildung beruht. Das heimische Aus- und Weiterbüdungssystem zielt noch immer auf den fachlichen Bereich ab, schenkt der Persönlichkeitsbildung nicht die nötige Aufmerksamkeit. Schüler, Lehrlinge, Studenten werden dadurch auf bestimmte Berufsfelder „eingeschossen“, ohne die Alternativen wenigstens theoretisch kennengelernt zu haben.
Aber Arbeit, so sagen die Wirtschaftspsychologen, ist primär das, was jeder sich persönlich darunter vorstellt. Die jeweilige Einschätzung einer Berufsgruppe oder eines „Traumjobs“ wird in der Regel durch die Eltern, die Schule, Erfahrungen von Freunden oder Bekannten vorgeprägt.
Solche vorgegebenen oder vermittelten Darstellungen von Berufen verführen nicht selten zu Schablonen, Denkdogmen oder stereotypen Ansichten. Solche werden sichtbar, wenn Meinungsforscher nach den besonders achtenswerten und schönen Berufen fragen.
Ärzte oder Rechtsanwälte genießen solchen Untersuchungen zufolge ein besonders hohes soziales Ansehen. Förster zu sein, wird derzeit wieder als besonders „schön“ eingeschätzt. Wenig Nimbus genießen hingegen beispielsweise Politiker oder Journalisten. Sie werden zwar als unverzichtbar erachtet, aber als nicht sehr glaubwürdig eingestuft. Dem Technikerstand wird ebenfalls kein sehr wichtiger Beitrag für die Gesellschaft zugebilligt.
Bei einer Untersuchung des Linzer Institutes für Markt- und Sozialanalysen (IMAS) waren von 6.700 Befragten nur acht Prozent der Ansicht, in einem verstaatlichten Betrieb würden an die Mitarbeiter besonders hohe geistige Ansprüche gestellt. 62 Prozent sahen hingegen die Banken und Versicherungen als wahre Intelligenztest-Anstalten an.
Daß solche Überlegungen und Vorurteile bei jungen Leuten wirklich eine Rolle spielen, wird nicht nur via Zustrom zu bestimmten Studienrichtungen sichtbar. Daher ein Tip: Sich selbst einmal vor Augen zu halten, welche Kenntnisse von Berufsgruppen man unreflektiert und unkritisch auch so übernommen hat.
Hat man nun ein ungefähres Bild über jene Fähigkeiten gezeichnet, die schon bisher die eigene Persönlichkeit ausgemacht haben beziehungsweise wie man sich im Augenblick einschätzt, sollten Umsetzungsmöglichkeiten ausgeforscht werden. Das Schema „Eignung kontra Anforderung“ (siehe Kasten) ist dabei ein nützlicher Wegweiser.
Nähere Informationen über Berufsbilder und -formen können bei den Arbeitsämtern der jeweiligen Bundesländer oder den Berufsberatungsstellen des Sozialministeriums eingeholt werden. Gute Informationsquellen über gesuchte Berufe, Arbeitsmöglichkeiten, Trends sind die Wirtschaftsteile der Tages- und Wochenzeitungen, einschlägige Bücher und Magazine oder Veranstaltungen.
Die beste Informationsquelle sind natürlich „gestandene Praktiker“, die in irgendeiner Weise mit dem angepeilten Beruf zu tun haben oder zumindest Informationen bieten können. Solche Informationen lassen sich sicherlich bei Bekannten der Eltern, der Freunde oder des Lehrers einholen. Sie wissen möglicherweise Bescheid über Chancen, im gewünschten Berufszweig auch tatsächlich Fuß fassen zu können. Geben Auskunft über die Anforderungen und Aufstellungen in der Praxis. Wissen, wie sind die Arbeitszeiten in der Branche geregelt, was sagen Wirtschaftsforscher über Zukunft und Sicherheit von Berufsgruppen, welche Trends zeichnen sich ab?
Eines ist aber klar: Informationen sind auf jeden Fall eine Holschuld. Ungefragt werden sie kaum jemandem zu Füßen gelegt.
Aber schon durch die gedankliche, auf theoretische Möglichkeiten abgestellte Beschäftigung mit seiner zukünftigen Laufbahn und die möglichen Alternativen bekommt ein potentieller Berufs-einsteiger das Gespür dafür, was sich am Arbeitsmarkt tut oder tun wird. Entscheidend ist das permanente Interesse als der Mechanismus, der immer wieder mobilisiert und aktiviert.
Sieht man durch solche Gespräche und Analysen klarer, was ein Beruf konkret bedeutet, ist eine Prioritätensetzung der nächste wichtige Schritt. Stichworte dafür sind:
• Prestige und sozialer Status;
• Gehaltsentwicklung;
• Sicherheit des Arbeitsplatzes;
• Arbeitsbedingungen (starre Arbeitszeiten, Großraumbüros, Teamarbeit);
• Führungsstil und Umgang mit Mitarbeitern;
• Leistungsanerkennung;
• Möglichkeiten, etwas Neues zu lernen;
• Anpassungsdruck an den Arbeitsplatz (Krawattenzwang);
• Bewertung und Einbeziehung der Privatsphäre;
• Reisemöglichkeiten oder -Verpflichtungen;
• Bezug zum Produkt, zur Dienstleistung.
Diese Stichworte können beliebig verlängert werden. Eine Zerlegung in mögliche Alternativen lohnt sich ebenfalls, um sich selbst besser einzuschätzen.
Ein Beispiel zum Stichwort „Reisetätigkeit“: Will man
• stets am selben Ort arbeiten, weil ein Haus im Grünen und die Gründung einer Familie fixer Bestandteil der Lebensplanung sind?
• das Unternehmen nicht, aber intern gerne Abteilungen wechseln?
• dauernd unterwegs sein, „aus dem Koffer leben“?
Oder das Beispiel zum Stichwort „Beziehung zum Produkt oder zur Dienstleistung“:
Durch den Wertewandel stellen besonders junge Menschen höhere ethisch-moralische Ansprüche an sich und andere.
Wer ins Berufsleben einsteigt, sollte bedenken, daß solche Einstellungen mitunter zu Konflikten mit sich, dem Chef, den Mitarbeitern führen können. Die Frage muß man sich stellen, ob Werte, für die man beispielsweise als Student oder Schüler vehement gekämpft hat, für das Berufsleben auch zentrale Bedeutung haben. Als erklärter Waffengegner wird kaum jemand in einen waffenproduzierenden Industriezweig einsteigen. Aber die Chance, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo man ein „Schweinegeld“ verdienen kann, obwohl man diesen Betrieb stets als Luft-verpester angeprangert hat, wird die Entscheidung schon schwerer machen.
Eine angehende Chemikerin kann beispielsweise durchaus in die Lage kommen, im Laufe ihrer Karriere einen Tierversuch durchführen zu müssen. Etwas, das sie im Grunde ihres Herzens immer zutiefst abgelehnt hat...
Solche Wert- und Prioritätenverschiebungen werden heute kaum von Personalchefs oder Unternehmern bei der Erstellung ihrer Anforderungsprofile berücksichtigt. Die routinemäßigen Tests dienen noch immer der Feststellung von individuellen Merkmalen wie Intelligenz, schnellem Denken, Logik, handwerklichem Geschick und dergleichen. Das so gewonnene Bild eines Bewerbers soll dann (mit einer gewissen Toleranzgrenze) einem vorgegebenen Idealbild entsprechen.
Ein weiterer Schritt, sozusagen der Farbtupfer in der grauen Masse von Mitkonkurrenten im Wettbewerb um einen Job zu sein, ist „mehr können als müssen“.