
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der geprügelte Arbeitnehmer
Wirtschaftsleute glauben zunehmend, ohne Menschenbild auszukommen. Sie brauchen keine philosophischen Spintisierereien, sie haben die Kostenrechnung. Sie haben es mit einem rationalen Geschäft zu tun. Freilich hat man irgendwann auch wahrgenommen, daß die Arbeitsplatzzufriedenheit wichtig sein mag und durch Motivierungsverfahren gesteigert werden kann. In den Broschüren, in denen man sich in den letzten Jahren noch die Köpfe über „Unternehmenskultur" zerbrochen hat, findet das Vokabular noch Verwendung. Dort steht dann: „Unser größtes Kapital sind unsere Arbeitskräfte."
Im Alltag heißt „größtes Kapital" freilich oft nur noch: Unsere Arbeitskräfte sind teuer. Und immer öfter heißt es nur noch: Wir müssen Arbeitnehmer feuern. Wegen der Krise. Wegen der Konkurrenz. Wegen Europa. Wegen der Globalisierung. Wegen der Lohnnebenkosten.
Wir wissen, daß es Unternehmer nicht leicht haben. Das gilt aber immer mehr auch für die Arbeitnehmer oderjene,die es werden wollen. Ihnen wird eine herausfordernde, aber chancenreiche Zukunft vor Augen gehalten: Jeder werde mehrere Jobs haben. Er werde sie mehrmals im Leben wechseln müssen. Er werde in einem permanenten Ausbildungsprozeß stehen. Ohne breite Qualifikation gehe nichts. Er werde sich den wirtschaftlichen Entwicklungen flexibel anpassen müssen. Am besten ist er jung, hochqualifiziert, alleinstehend und mobil, um den Anforderungen zu genügen.
In der „schönen neuen Arbeitswelt" ist alles hinderlich, was einen von der Arbeit ablenkt. Das wäre die Lösung, um die Effizienz und die Konkurrenzfähigkeit zu steigern; aber ist es nicht vielmehr das Problem? Man vergißt die erwähnte Frage nach dem Menschenbild: ob diese vorhergesagte Arbeitswelt überhaupt machbar ist - und auch: ob sie eigentlich effizient sein kann. Wir sind dabei, uns daran zu gewöhnen, alles, was uns als „effizient" und „flexibel", „innovativ" und „dynamisch" gepriesen wird, zu bejubeln. Fraglich ist aber, ob die betroffenen Menschen mit jener Rundum-Flexibilität, die ihnen in solchen Voraussagen anempfohlen wird, zufrieden leben können.
Wie wird denn der „Mitarbeiter" der Zukunft beschrieben? Er wird, so heißt es, hochqualifiziert sein, fachlich erstklassig ausgewiesen. Er wird aber durch den dynamischen Wandel aller Verhältnisse mehrmals umlernen, ja seinen Job des öfteren wechseln müssen. Wie geht denn das zusammen? Werden die Menschen die erlesenen und dennoch breitangelegten Qualifikationen so schnell erwerben, und das gleich in mehreren Berufen nacheinander?
Sie werden Spezialisten sein, die für ihren Arbeitsbereich selbständig und selbstbewußt, eigenständig statt fremdbestimmt entscheiden können; aber sie müssen auch bereit sein, immer Neues anzugehen. Wo bleibt da der Stolz auf den Beruf, auf die Kenntnisse, auf die bisherigen Leistungen, wenn man jederzeit bereit ist, alles hinzuwerfen und etwas ganz anderes zu beginnen? Welche Vorstellung persönlicher Identität steckt dahinter?
Die Arbeitnehmer werden mobil, jederzeit überall einsetzbar sein müssen. Aber das heißt auch, daß sie jederzeit willens sein müssen, ihr soziales Umfeld, ihre Freunde, ihre Verwandten, ihren Lebenszusammenhang aufzugeben, im Dienste der Karriere, des Wirtschaftswachstum oder des allgemeinen Fortschritts.
Der Soziologe Ulrich Beck hat mit Recht gesagt, daß die Logik des Arbeitsmarktes zum anhanglosen, ehelosen, jedenfalls familienlosen Menschen drängt; nur dann ist er jederzeit fungibel für die Bedürfnisse eines Konkurrenzgeschehens, das ja, nicht wahr, immer härter wird und den ganzen Menschen erfordert. Aber können sozial degenerierte workaho-lics, Arbeitsroboter, die außerhalb ihres Berufs nichts mehr kennen, genau das leisten, was man von ihnen will? Sind sie „kooperationsfähig" und „teamfähig" im Betrieb, wenn sie außerhalb des Betriebs soziale Krüppel sind? Können sie die „gestalterischen Anforderungen" der Zukunftsarbeit erfüllen, wenn sie außerhalb des Betriebes „blind" sind? Können sie Höchstleistungen erbringen, wenn ihnen ihre Familie egal ist und deshalb in die Brüche geht? Wenn sie jede Sorge für Eltern abgestreift haben und Freunde für überflüssig halten?
Was sind das für Menschen, die man sich da vorstellt? Menschen, die auf eine Sache ungemein stolz, aber jederzeit bereit sind, sie fallen zu lassen. Menschen, die ununterbrochen kreativ sein sollen, deren Persönlichkeit aber vom Unternehmen aufgesogen wurde. Menschen, die zu ihren Freunden nicht loyal sind, auf deren Loyalität aber das Unternehmen in jeder Lage bauen können soll.
Aber vielleicht ist die Sache mit Autonomie, Kreativität und Loyalität ohnehin bereits überholt. Zwar wurde gerade noch die neue Arbeitswelt als eine geschildert, in der die Arbeitnehmer selbständig arbeiten, Verantwortung übernehmen und mitdenken müssen. Von der Dezentralisierung von Entscheidungen war da die Rede, von Reflexivität und Selbstbewußtsein der Mitarbeiter, von ihrer Ausdrucksfähigkeit und Konfliktlösungsfähigkeit, von ihrer Einbeziehung in die Unternehmensentwicklung.
Aber der Alltag ist anders: Die Unternehmen selbst setzen zunehmend nicht mehr auf Loyalität, sondern auf Angst. Der Druck steigt, und die Belohnungen werden magerer. Arbeitnehmer gelten als Kostenfaktor und nicht mehr.
Ein amerikanischer Firmenberater, Frederick F. Reichheld, spricht in seinem Buch über den „Loyalty Effect" von einer Vertrauenskrise in der amerikanischen Wirtschaft. Der Durchschnittsverbleib eines Beschäftigten bei einem Unternehmen in den USA sei drei Jahre, in Deutschland und Japan dagegen zehn Jahre; das ergebe katastrophale Lernkurven. Unsicherheit kann teuer sein: Angst motiviert kurzfristig, zieht aber auf Dauer sinkende Moral und sinkende Produktivität mit sich. Wenn der Prozeß einmal ins Laufen gekommen ist, ist er schwer zu stoppen: Die Besten gehen davon. Die Schlechteren ziehen die Köpfe ein. Mißtrauen macht sich breit. Jeder sucht sich unentbehrlich zu machen, ein Monopol aufzubauen, und verwehrt die Weitergabe von Informationen. Jeder bedient sich, wo es geht. Ein leistungsfähiger Betrieb aber zeichnet sich nicht dadurch aus, daß keiner auffallen will.
Die Entwicklungen klaffen immer weiter auseinander: die funktionellen Erfordernisse der neuen Organisationsgestaltung auf der einen, die Alltagspraxis auf der anderen Seite.
Man schwafelt davon, daß jeder Mitarbeiter ein „Intrapre-neur" sein soll, aber man beginnt sie zu prügeln wie lange nicht. Doch Loyalität ist eine Ressource, mit der man pfleglich umgehen muß. Man wird sie in Zukunft brauchen. Und sie läßt sich nicht so leicht herstellen oder einkaufen, wenn man sie benötigt.
Es möge beachtet werden: Wir haben hier nicht von Menschlichkeit, von Arbeitnehmerrechten, von sozialen Verpflichtungen des Eigentums oder anderen ethischen Prinzipien gesprochen. Wir haben nicht an der Frage herumgemäkelt, was mit jenen geschieht, die nicht so jung, so hochqualifiziert, so alleinstehend und so mobil sind - ob es etwa reicht, sie mit ein paar Zahlungen ruhigzustellen. Da mögen sich zusätzliche Argumente finden.
Hier war nur davon die Rede, daß die gegenwärtigen Ef-fizienzsteigerungs- oder Kostenminderungsstrategien in der Ineffizienz landen — oder gar scheitern - könnten. An eben dieser vertrackten Geschichte mit dem Menschenbild (siehe Seite 12).
Der Autor ist
Professorfür Kultursoziologie an der Universität Graz.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!



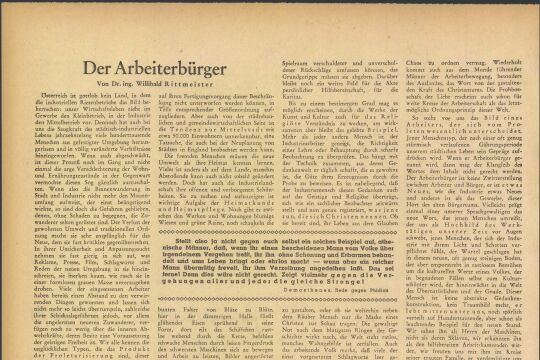

















































































.png)











