
Wettbewerb ja — „Leistungspeitsche“ nein
Wohl kaum ein Begriff, kaum eine Wertvorstellung ist in den letzten Jahren so ins Zwielicht geraten wie das Wort „Leistung“. Leistungsprinzip und Leistungsmotivation, Leistungswille und Leistungsverweigerung, Leistungsgesellschaft und Leistungsgerechtigkeit, Leistungsdruck und Leistungsterror — diese widersprüchlichen Worte verdeutlichen schlaglichtartig die Situation.
Wohl kaum ein Begriff, kaum eine Wertvorstellung ist in den letzten Jahren so ins Zwielicht geraten wie das Wort „Leistung“. Leistungsprinzip und Leistungsmotivation, Leistungswille und Leistungsverweigerung, Leistungsgesellschaft und Leistungsgerechtigkeit, Leistungsdruck und Leistungsterror — diese widersprüchlichen Worte verdeutlichen schlaglichtartig die Situation.
Jene, die allzu schnell und bisweilen aus vordergründigem und nicht immer uneigennützigem Interesse unsere gegenwärtige Leistunsgesellschaft vorbehaltlos bejahen, berufen sich gerne auf das bisweilen arg strapazierte' Wort Mirabeaus, der vor über 200 Jahren sagte: „Es gibt nur drei Methoden, um leben zu können: betteln, stehlen oder etwas leisten.“ Daß aber Leistungen zu Mirabeaus Zeiten, also unter feudalen Verhältnissen, etwas essentiell anderes war als Leistung in unserer hochtechnisierten und durchrationalisierten kapitalistischen Erwerbswirtschaft, wird dabei vergessen.
Zwischen Wirtschaft und Gesellschaft unserer Tage und jener der Feudalzeit besteht nämlich ein grundlegender Unterschied. Wenn heute, meist etwas unreflektiert, gesagt wird, wir lebten in einer „modernen Industriegesellschaft“, so verbirgt sich dahinter nicht nur der augenscheinliche Tatbestand, daß die Güter in früher unvorstellbarer Menge mit revolutionären technischen Methoden und unter gänzlich anderen sozialen Bedingungen als noch vor 200 Jahren erzeugt und verteilt werden. Hinter diesem Phänomen steht vielmehr auch die entscheidende Tatsache, daß sich das Verhältnis der Menschen, vor allem in WesteuroDa und Nordamerika, zu den wirtschaftlichen Gütern und zur Wirtschaft schlechthin grundlegend gewandelt hat.
Der Beginn des industriellen Zeitalters ist mit dem gewaltigen Aufstieg und Siegeszug der Naturwissenschaften allein nicht hinreichend zu erklären, denn damit läßt sich die Frage nicht schlüssig beantworten, warum der moderne Mensch, anders als seine Vorfahren, wissenschaftliche Kenntnisse systematisch für ökonomische Zwecke ausnutzt. Entscheidendes Agens nicht weniger naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und darauf aufbauender Erfindungen ist zwar auch — aber eben nicht nur — der faustische Drang, Unbekanntes zu entdecken und Verborgenes zu begreifen, sondern gleichermaßen der wirtschaftliche Nutzen, den man sich hiervon verspricht. Hier handelt es sich um ein geistiges Phänomen.
Semantisch gesehen, werden die Dinge vielleicht noch deutlicher. Das ursprünglich Positive, das Otium, die Muße also, genießt heute, anders als früher, nur geringen Stellenwert, während das ursprünglich Negative, das Negotium, das Geschäft, in der Rangfolge obenan steht. Dem Einwand, wir besäßen mehr Freizeit denn je, ist entgegenzuhalten, daß Freizeit nicht gleich Muße ist. Wirkliche Muße erfordert Kontemplation. Recht verstanden, soll sie schöpfensehe Pause sein, nichts aber hat sie mit Inaktivität und passivem Hedo-nismus zu tun, mit Verhaltensweisen, die im urageistigen Verzehr von immer mehr Konsumgütern das Äquivalent für die vollbrachte ökonomische Leistung erblicken.
Konsumkritik, wie sie sich heute vielfach artikuliert, stellt zweifellos eine Art von Erziehungsdiktatur dar, durch die eine selbsternannte Avantgarde uns bevormunden und beglücken möchte. Aber hier geht es weniger um Konsumkritik als um Kritik dessen, was am besten mit Konsumentenmentalität umschrieben wird.
Die wirtschaftliche Leistung, im wesentlichen also die Berufsarbeit, hat für viele Menschen unserer Generation Züge angenommen, die nicht unproblematisch sind. Unsere ebenso komplexe wie komplizierte Berufswelt erfordert immer höher spezialisierte Experten, die imstande sind, stets kleiner werdende Fachbereiche zu verstehen. Dem normal oder durchschnittlich gebildeten Menschen bleiben immer weitere Bereiche der hochtechnisierten und durchrationalisierten Wirtschaftswelt erkenntnismäßig verschlossen. Gleichzeitig wird aber im Namen eben dieses techno-ökonomischen Systems immer differenziertere und intensivere Leistung eefordert. Noch keine Epoche der Menschheitsgeschichte hatte eine auch nur annähernd vergleichbare Wissensexplosion zu verzeichnen wie unsere Zeit, noch nie zuvor waren Menschen einer derartigen Fülle von Informationen und Reizen ausgesetzt, was zur Folge hat, daß Berufsund Privatleben ständig unter offenem oder latentem Streß stehen.
Diese verwirrende Vielfalt differenzierter Anforderungen hat, gepaart mit dem vielfach aus Nicht-verstehen resultierenden Unbehagen gegenüber dem techno-ökonomi-schen System, dazu geführt, daß immer mehr Menschen sich in ihrer Anpassungsfähigkeit überfordert fühlen. In dieser permanenten Überforderung läßt sich eine wichtige Quelle des vielzitierten Unbehagens an der Leistung oder am Leistungsdruck erkennen, weniger aber in der beruflich abgeforderten Einzelleistung.
Indirekt scheint das auch aus der Tatsache hervorzugehen, daß die Leistungsanforderung an den einzelnen in der Wirtschaft heute viel geringer ist als früher. Hierzu nur ein Beispiel: In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mußten jährlich zwischen 4000 und 4500 Arbeitsstunden abgeleistet werden, heute dagegen beläuft sich die tarifvertraglich vereinbarte Arbeitszeit auf etwa 1900 Stunden pro Jahr. 1850 mußte man noch 85 Stunden in der Woche arbeiten, heute sind es nur noch halb so viele, nämlich 40. Vergleicht man noch zusätzlich zu dieser rein quantitativen Betrachtung die Ausstattung des Arbeitsplatzes von damals mit jener von heute und bedenkt man die vielerlei sozialen und hygienischen Einrichtungen, die unsere Großväter noch als utopisch bezeichnet hätten, so könnte man sagen, daß der Leistungsdruck quantitativ und in gewissem Umfang auch qualitativ spürbar geringer geworden ist.
Aber eben nur in gewissem Umfang. Denn die Leistungsintensität hat teilweise enorm zugenommen, sie droht, den Menschen weitgehend zu absorbieren; dies um so eher, als der Zeitgeist vielfach dazu neigt, den Menschen vorwiegend nach seiner beruflichen Leistung und dem damit verbundenen materiellen Erfolg zu beurteilen. Wir können vor der Gefahr die Augen nicht verschließen, daß diese Art von Leistung in gewissem Umfang zum Maßstab des Lebens schlechthin geworden ist, und zwar auch im existentiellen Bereich. In einer nicht verabschiedeten Vorlage der gemeinsamen Synode der Bistümer in der deutschen Bundesrepublik heißt es hierzu: „Je mehr aber Leistung ausschließlich am Einkommen gemessen wird, an dem, was man, sich leisten kann, folgt auch die menschliche Wertschätzung und die Bewertung des anderen, der Beziehungen untereinander, zunehmend materiellen Marktgesetzen. Die menschlichen Beziehungen werden mehr und mehr versachlicht und verdinglicht.“ Das mae in manchen naläoliberalen Ohren hart klingen, muß aber deswegen noch lange nicht falsch sein.
Der zu Recht berühmte Nationalökonom Josef Schumpeter hat den Begriff der „schöpferischen Zerstörung“ geprägt. Er meinte damit das Prinzip, demzufolge nicht mehr wettbewerbsfähige und nicht mehr leistungsfähige Betriebe zugunsten ökonomisch effizienterer Firmen liquidiert werden müßten. Wenn aber Mittelstandsbetriebe durch Konzerne, kleinbäuerliche Anwesen durch Farmen, Einzelhandelsgeschäfte durch Supermärkte und Handwerker durch Wegwerfproduktion „schöpferisch zerstört“ und damit eliminiert werden, dann mag das zwar in den Augen des Homo eoconomicus sinnvoll, weil wachstumsfördernd sein, aber der menschliche Aspekt einer Leistungsgesellschaft, die sich solchen Prinzipien verpflichtet glaubt, muß doch mit einem sehr großen Fragezeichen versehen werden.
Was folgt aus alledem? Es wäre ein Unding, jenen kindlich-naiven Gemütern zu folgen, die die leistungsfreie Gesellschaft fordern. Es gibt — wenn auch nicht unbedingt a priori, so doch zumindest empirisch gesehen — nun einmal keinen auch nur annähernd so wirksamen Antrieb für den individuellen und kollektiven Fortschritt wie das Leistungsprinzip. Man darf nur die Konsequenzen dieser Tatsache nicht aus dem Auge verlieren. Sie heißen: Leistung ist ohne soziale Differenzierung nicht möglich. Denn selbst eine idealtypische absolute Chancengleichheit kann niemals Gleichheit der Menschen sein, weil genutzte Chancen zu Leistungen führen und damit zwangsläufig zu Leistungsunterschieden. Genutzte Chancen führen zu neuer Konkurrenz, neuem Konflikt und auch neuer Selbstbehauptung. Sie verdeutlichen damit die Ungleichheit d r Menschen. Hier Ist es“ Aufgabe des sozialen Rechts- und Kulturstaates, solche Ungleichheit mit sichernden Maßnahmen ausgleichender Gerechtigkeit erträglich zu machen. Nicht der harte Wettbewerb als solcher darf die Politik bestimmen, sondern das Ermöglichen eines Wettbewerbs, der die Leistung fördert, aber einen gerechten Ausgleich für jene schafft, die ihre Chance nicht nutzen konnten. Eine „Leistungspeitsche“ kann und darf nicht ein politisches Ziel sein. Aber ein Untergraben des Leistungswillens ist eine menschliche, nationale und weltwirtschaftliche Dummheit.
Ein Laisser-faire im Leistungsbereich würde zwangsläufig zu einem kulturfeindlichen Sozialdarwinismus führen. Die Schlußfolgerung kann daher nur lauten: Leistung ja, aber sie muß technisch transparent, ökonomisch modernisiert und menschlich sublimiert sein. Letzteres gilt auch für den Bildungsbereich. Die Schule darf nicht zu einer Institution herabsinken, die nur theoretisches Wissen vermittelt, sie soll auch musische, künstlerische und soziale Begabung wecken und fördern.
Hingegen ist der törichte Versuch, den Leistungsdruck durch soziale Nivellierung zu mildern, zum Scheitern verurteilt, weil hiedurch unsere Leistungsgesellschaft nämlich nicht die fraglos erforderliche anthropologische Dimension erhält. Das Ergebnis wäre nur Leistungsunwillen und am Ende Leistungsverweigerung. Durch mehr Gleichheit läßt sich weder die Freiheit vermehren,' wie manche 'Sozialromantiker oder Sozialrevolutionäre glauben, noch sind Fortschritte im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich zu erzielen. Totale Gleichheit beraubt die Menschen des Ansporns zur Leistung, weil Vorbilder und Belohnung fehlen.Leistung muß wieder transparent werden, der einzelne. Mensch, ob Arbeiter oder Angestellter, ob in Industrie, Handel oder Verwaltung tätig, muß wissen, wozu und wofür er arbeitet und etwas leistet. Wenn unsere Wirtschaft in ihren Zusammenhängen und Abläufen auch schwer zu durchschauen und nicht ohne weiteres verständlich ist, so muß doch sowohl während der Ausbildung als auch im Berufsleben selbst darauf hingewirkt werden, daß den Menschen diese Sachverhalte nahegebracht werden und ihr Verständnis hiefür geweckt wird. Wir brauchen nicht Freiheit von der Arbeit, sondern infolge besseren Verständnisses Freiheit in der Arbeit.
Leistungsmotiv darf nicht nur der individuelle Egoismus sein, denn man leistet doch gerade im Ordnungssystem der sozialen Marktwirtschaft für andere, die diese Leistung honorieren. Damit sehen wir uns freilich schon wieder einem Vorwurf ausgesetzt, dem Vorwurf von der „Fremdbestimmung des Menschen“. Natürlich wird der Mensch in einer arbeitsteiligen Wirtschaft immer auch fremdbestimmt sein, das ist ebensowenig zu ändern wie der Egoismus jedes einzelnen. Es geht vielmehr darum, Auswüchse nach der einen oder anderen Seite zu verhindern. An die Stelle eines übersteigerten Individualismus und eines überdrehten wohlfahrtsstaatlichen Kollektivismus muß -wieder die Personalität des Menschen, muß wieder seine soziale Verpflichtung treten. Mit einer so verstandenen Leistung, aber auch nur mit ihr, besitzen wir die Chance, die Probleme der Zukunft ihres lähmenden Anscheins der Unlösbar-keit zu entkleiden.



































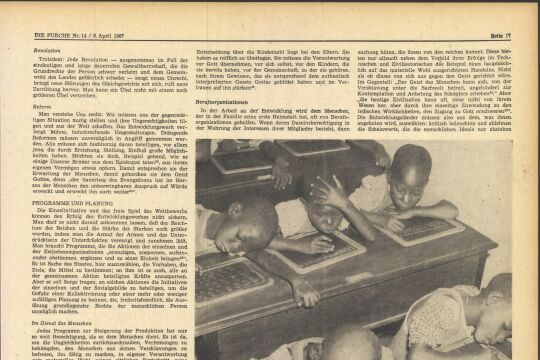

























































.png)






