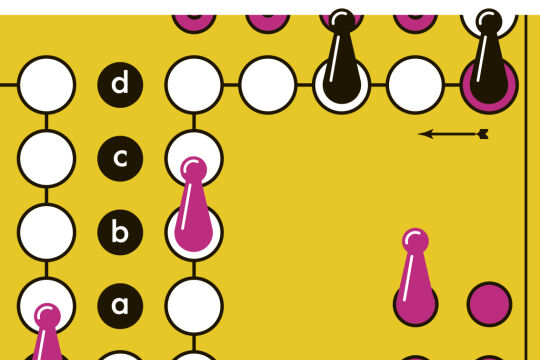Die Feinde der Marktwirtschaft
Die Marktwirtschaft ist schuld daran, daß unsere Welt so kalt und herzlos ist, heißt es oft (siehe auch Furche 27/1995). Schuld an dieser irrigen Auffassung, meint der Autor des folgenden Beitrages, seien auch die Gesellschaftsromantiker.
Die Marktwirtschaft ist schuld daran, daß unsere Welt so kalt und herzlos ist, heißt es oft (siehe auch Furche 27/1995). Schuld an dieser irrigen Auffassung, meint der Autor des folgenden Beitrages, seien auch die Gesellschaftsromantiker.
In der ganzen Welt hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß die Marktwirtschaft in bezug auf Wirtschaftlichkeit der Alternative der zentralen Planung durch den Staat haushoch überlegen ist. Von China, wo Ministerpräsident Li Peng bereits vor dem achten Nationalen Volkskongreß im März 1992 den seltsamen Begriff „Sozialistische Marktwirtschaft” geprägt hat, bis Argentinien, wo der liberale Staatspräsident Menem trotz einer schmerzhaften Austerity-Politik vor wenigen Monaten einen überwältigenden Wahlsieg errungen hat, von Boris Jelzin über British Labour bis Südafrikas Mandela - die Vorteile des Wettbewerbs in einer freien Wirtschaft werden überall anerkannt. Angesichts dieser Grundstimmung ist es erstaunlich, daß eine effektive Stärkung der marktwirtschaftlichen Grundsätze dennoch nicht erfolgt ist. Warum? Welche Kräfte stellen sich gegen die Bealisierung einer liberalen, Wirtschaftsordnung.
Gesellschaftsromantiker sehen im Markt den Verursacher materieller Not Da sind zunächst die erklärten und in ihrer Badikalität leicht erkennbaren Gegner. Sie stammen sowohl aus dem rechts- wie linksextremen Lager und lehnen konsequenterweise zugleich auch die Parlamentarische Demokratie ab. Sie halten an ökonomischen Vorstellungen fest, die wissenschaftlich bereits vor 70 Jahren von den Volkswirtschaftlern der Wiener Schule wie von Mises, Schumpeter und von Hajek, empirisch durch die Erfahrungen mit der zentralgelenkten Kommandowirtschaft und dem Staatskapitalismus in Osteuropa und in der Dritten Welt widerlegt sind. Unter geordneten, demokratisch bestimmten politischen Verhältnissen sind sie so gut wie chancenlos.
Interessanter ist die Auseinandersetzung mit jenen Gesellschaftsromantikern, die den Markt nicht als ein Ordnungsinstrument des menschlichen Zusammenlebens begreifen, sondern als Verursacher materieller Not durch die von ihm offenbar hervorgerufene Ungerechtigkeit der effektiven Güterverteilung. Die Vertreter dieser Bichtung setzen sich hauptsächlich aus Intellektuellen, wirtschaftswissenschaftlich nicht ausgebildeten Universitätsprofessoren und Mittelschullehrern, Vertretern der Kirchen, Künstlern und auch Journalisten zusammen. Sie agieren hauptsächlich im geistigen Umfeld, haben geringen Einfuß auf das tatsächliche wirtschaftliche Geschehen, sind jedoch imstande, Politiker und Öffentlichkeit zu verunsichern.
Diese Skeptiker verkennen das Wesen des Marktes. Der Markt ist nicht mehr und nicht weniger als ein Mechanismus, der durch eine unübersehbare Vielzahl von Einzelentscheidungen Produktion, Verteilung und Verbrauch regelt. Er ist an sich ebensowenig gut oder böse wie das Gesetz der Schwerkraft. Entscheidend ist, wie man sich dieser Gesetzmäßigkeiten bedient. Man kann die Gravitation dazu benützen, um ein Mühlrad laufen zu lassen oder um einen Menschen mit einem Ziegelstein zu erschlagen.
Marktwirtschaft wie auch Demokratie sind „kalte Mechanismen... Methoden zur Verringerung der Kosten menschlicher Irrtümer” (Balf Dahrendorf). Wichtige menschliche Bedürfnisse - wie soziale Sicherheit, Geborgenheit in der Gemeinschaft, Gerechtigkeit bei Arbeit und Lohn -bleiben unberücksichtigt. Deshalb muß die Marktwirtschaft Ordnungsprinzipien unterworfen sein. So hat zum Beispiel der liberale Philosoph John Bawls Gerechtigkeitsgrundsätze (Gerechtigkeit als Fairneß) entwickelt. Sie lauten:
„1. Jede Person hat ein gleiches Becht auf ein völlig adäquates System gleicher Grundfreiheiten, das mit dem entsprechenden System von Freiheiten für alle vereinbar ist.
2. Gesellschaftliche und ökonomische Ungleichheiten müssen zwei Bedingungen genügen: erstens müssen sie mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit offenstehen, und zweitens müssen sie den größten Vorteil für die am wenigsten begünstigten Mitglieder der Gesellschaft bringen.”
Daß diesen Postulaten sehr oft nur ungenügend Bechnung getragen wird, beeinträchtigt nicht die Wünschbarkeit ihrer Bealisierung.
Eine echte Herausforderung für den Verfechter der Marktwirtschaft bildet die Interessenpolitik, deren Vertreter sich zwar zur Marktwirtschaft bekennen, aber ihre Grundsätze immer dann vergessen, wenn sie in der konkreten wirtschaftspolitischen Entscheidung Zielsetzungen verfolgen, die mit den von ihnen vertretenen Prinzipien in Widerspruch stehen. Die Auseinandersetzung wird hier mit ungleichen Spießen geführt: Wer konkrete wirtschaftliche Ziele verfolgt (etwa in Ausnützung einer marktbeherrschenden Stellung), befindet sich in der öffentlichen Diskussion jedenfalls in einer günstigeren Position als engagierte Vertreter der Marktwirtschaft, die keine geschlossene Lobby besitzen, um die Öffentlichkeit für ihre Werte und das von ihnen verteidigte Gesellschaftssystem zu sensibilisieren.
Die marktwirtschaftliche Ordnungspolitik hat keine institutionalisierten Befürworter. Sie steht nicht selten im Widerspruch zu notwendiger politischer Kompromißbereitschaft.
Wahlchancen, die zu optimieren sind, veranlassen Verantwortungsträger, einen Gegensatz zwischen Wirtschaft und Politik zu konstruieren, wobei dann natürlich das Primat der Politik in den Vordergrund gestellt wird. Dazu kommt, daß Vollblutpolitiker und auch die hohe Beamtenschaft dezentralisierte Marktwirtschaft nicht besonders schätzen, weil sie Eingriffsmöglichkeiten und damit Machtpositionen reduziert. Die Bürokratie ist der Todfeind des Marktes. Die Kritiker der Marktwirtschaft führen als wesentliches Argument immer wieder die Un-vollkommenheit des Marktes an, die zu Fehlentwicklungen führe. So fragt Walter Löh-nert in einem Leserbrief an die furche (27/95), wieso es bei Krediten an Entwicklungsländer zu „unteroptimalen Verwendungen” kommen kann, da doch der Marktwettbewerb angeblich „zum relativ sparsamsten Einsatz der Bessourcen und einer höchstmöglichen Wertsteigerung” zwingt. Lassen wir extreme Einflüsse beiseite. Geben wir zu, daß der Wettbewerb tatsächlich nicht perfekt ist, weil die Zukunft unsicher ist. Nur in den Grundlehrgängen der Nationalökonomie erscheint alles klar und richtig. In Wirklichkeit heißt wirtschaften - gleich in welcher Gesellschaftsordnung - Zukunftserwartungen einschätzen. Wir können uns in einem offenen System nicht nach Gewißheit, sondern nur nach Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit orientieren. Dabei sind Fehler unvermeidbar, auch in der Marktwirtschaft. Diese hat der Zentral wirtschaft lediglich voraus, daß sie sich - wie die Erfahrung dieses Jahrhunderts zeigt - seltener irrt und auch falsche Entscheidungen leichter korrigieren kann.
Wie im angeführten Beispiel fehlgeleiteter Entwicklungshilfe spielen politische Faktoren überall eine große Bolle. Der Marktwirtschaft werden Fehler angelastet, die außerhalb ihres Systems liegen.
Marktwirtschaft grenzt sich nach rechts und links ab. Sie stellt nicht die Ziele der Sozialpolitik, sondern die Mittel in Frage. Dirigismus ist ja gar nicht so sozial und gerecht wie viele denken: Beiche Altmieter leben auf Kosten benachteiligter Neumieter. Soziale Transferleistungen kommen nach dem Gießkannenprinzip auch Mehrfachmillionären zugute. Privilegien werden von der Bürokratie ungeachtet von Verdienst oder Bedürftigkeit verteilt. Wenn es in unserem
Land auch heute noch materielle Not gibt, so ist dies bei einem Anteil der Sozialleistungen am Bruttoinlandsprodukt von 29 Prozent ein Verteilungsproblem bei den sozialen Aufwendungen: Das soziale Netz ist offenbar an den Bändern zu weitmaschig, in der Mitte zu eng geknüpft.
Auch sind wirtschaftliches Denken und Umwelt kein Gegensatz. Wer gegen das Prinzip der Nachhaltigkeit (Vermeidung der Übernutzung der ntürlichen Mitwelt) handelt, verstößt gegen eine elementare Buchhaltungsregel. Er vergißt bei seiner Kalkulation die Abnützung seines Kapitalstocks zu berücksichtigen. Er berechnet seine Produktionskosten falsch, verkauft seine Produkte zu billig. Er glaubt, Gewinne zu erzielen, in Wirklichkeit lebt er von der Substanz und verschleudert seinen Besitz. Nicht zu viel, sondern zu wenig Markt führt zur Vergeudung von Bessourcen (siehe Furche 27).
Dirigismus ist gar nicht so sozial und gerecht, wie viele denken Universitätsprofessor Johannes Scha-sching SJ hat recht, wenn er im Bereich der Sozialkultur (Umwelt, alte Menschen, Kranke, Jugend) einen großen (Nachhol)- Bedarf an Arbeit ortet. Aber bedarf es dazu „neuer Verteilungsmechanismen”, da „wir uns”, wie er schreibt, „auf den Markt nicht verlassen können”? Was fehlt, sind nicht andere Mechanismen, sondern der politische Wille, der neue Prioritäten setzt, indem etwa Umweltprojekte unter Verzicht auf Konsumausgaben wie Urlaubsfernreisen forciert werden. Marktkonforme Maßnahmen sind auch hier dirigistischen Eingriffen vorzuziehen.
Allerdings hängt jede funktionierende Marktwirtschaft von Bedingungen ab, die „jenseits von Angebot und Nachfrage” liegen. Es bedarf bestimmter Wertvorstellungen, die weder der Markt noch das demokratische Gesellschaftssystem schaffen können. So schrieb der liberale Nationalökonom Wilhelm Böpke schon vor Jahrzehnten: „Was nützt aller materieller Wohlstand, wenn wir die Welt gleich -zeitig immer häßlicher, lärmender, gemeiner und langweiliger machen und die Menschen den moralisch-geistigen Grund ihrer Existenz verlieren?
Der Mensch lebt eben nicht von Badios, Autos und Kühlschränken, sondern von der gesamten unverkäuflichen Welt jenseits des Marktes und der Umsatzziffern, von Würde, Schönheit, Poesie, Anmut, Bitterlich-keit, Liebe und Freundschaft, ... von Gemeinschaft, Lebensgebundenheit, Freiheit und Selbstentfaltung.”