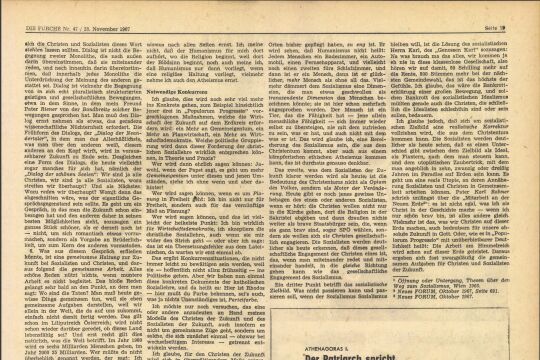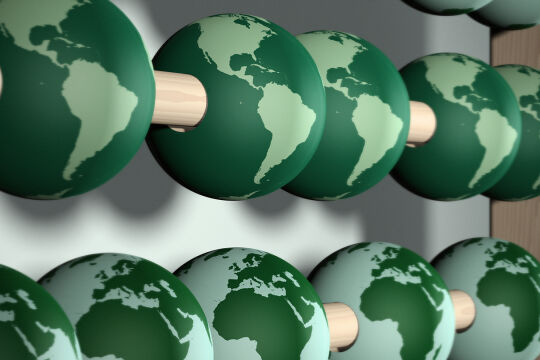Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl im Gespräch über die Ängste vor der Globalisierung, die Bedeutung des wieder vereinigten Europas und die Werte der Unternehmer.
Die Furche: Die Themen Ethik und Globalisierung werden im wirtschaftspolitischen Zusammenhang kontrovers diskutiert. Inwieweit ist Ethik durch den globalen Standortwettbewerb Ihrer Ansicht nach bedroht?
Christoph Leitl: Ethik ist immer bedroht. Ethik beginnt ja im Kleinen, beim einzelnen Menschen, in der kleine Gemeinschaft. Und je weiter das hinaufgeht, desto größer die Auswirkungen des Handelns und somit auch die Verantwortung, die damit verbunden ist. Die Globalisierung flößt vielen Menschen Angst ein. Man muss fragen, warum diese Angst besteht. Denn an sich ist ja Globalisierung etwas sehr Positives, wenn man darunter das organisatorische, technologische und kommunikative Zusammenrücken der Welt versteht, weil es die Möglichkeit gibt, in einer partnerschaftlich arbeitsteiligen, untereinander verbundenen und interagierenden Welt zu leben und damit Unterschiedlichkeiten zu reduzieren, Feindbilder abzubauen und damit Toleranz und die Basis für den Frieden zu verstärken.
Die Furche: Warum ist dann die Angst vor der Globalisierung so groß?
Leitl: Es gibt die Institutionen nicht, die dieses positive Bild vertreten. Derzeit dreht sich alles nur um Warenaustausch, Finanztransaktionen, Verlagerungen von Dienstleistungen, Kosten- und Standortwettbewerb. Soziale Sicherungssysteme werden in Frage gestellt. Daher müssen wir versuchen, gegenteilige Antworten zu geben. Wir müssen die Globalisierung mit einem Wertesystem ausstatten und ihr einen Steuerungsrahmen geben.
Die Furche: Im Zusammenhang mit der EU-Erweiterung wurden solche Ängste vor allem im Hinblick auf den Arbeitsmarkt laut...
Leitl: Die Wiedervereinigung Europas ist eine insgesamt akzeptierte Tatsache. Die Solidargemeinschaft Europa tritt wieder in Aktion. Sie ist ein Instrument, mit dem wir die Globalisierung durch gemeinsame Stärke besser bewältigen und den Stellenwert Europas in diesem Prozess der Globalisierung erhöhen wollen. Denn von Asien und von Amerika geht etwas aus, wo man sich fragen muss, wie begegnen wir dem in Europa und welche Vernetzungen sind in andere Länder der Welt, die noch nicht zu den Playern gehören, wie Lateinamerika, Afrika, Ozeanien, Südasien, möglich, wie geht man mit diesen um, wie kann man sie einbinden. Da fehlen Institutionen, ein ordnungspolitischer Rahmen, dem sich alle miteinander verbunden fühlen. Wir versuchen mangels eines solchen Rahmens gewisse Grundwerte der Wirtschaft, etwa die soziale Verantwortlichkeit, zu stärken. Denn das, was in einem anderen Teil der Welt passiert, ist uns nicht egal. Es kann uns zum Beispiel nicht gleichgültig sein, wenn ein Kontinent wie Afrika vor unseren Augen versinkt. Es gibt nur eine insgesamt positive Entwicklung. Wenn nur ein Teil negativ ist, ist leider auch der Saldo insgesamt negativ.
Die Furche: Noch einmal zur Erweiterung: Sind die mögliche Zuwanderung billiger Arbeitskräfte und die Abwanderung von Unternehmen nichts weiter als Negativszenarien selbst ernannter Unheilspropheten?
Leitl: Zum einen gibt es siebenjährige Übergangsfristen für den Arbeitsmarkt, die die Wirtschaft vielleicht anders gewollt hätte, aber aus gesamtpolitischer Sicht haben wir diese Frist unterstützt, denn man muss die Ängste der Bürger ernst nehmen. Und zum anderen befinden sich unsere Nachbarn in einer wirtschaftlichen Boom-Situation durch EU-Förderungen und hohe Wachstumsraten. Wo sehen Sie denn seit der Erweiterung den Ansturm der Ausländer? Ich sehe nicht, dass sie uns über die Grenzen entgegenströmen. Wir werden bald nicht mehr Angst haben vor zu viel, sondern vor zu wenig Zuwanderung. Denn die anderen Länder haben die gleiche demografische Entwicklung wie wir. Auch die anderen haben Probleme, qualifizierte Facharbeiter zu finden. Wer heute in Slowenien einen qualifizierten Facharbeiter sucht, muss dasselbe zahlen wie in der Südsteiermark. Die Dinge ebnen sich ein, und das ist gut so.
Die Furche: In der EU, wie sie vor der bislang letzten Erweiterung war, führte das Modell der sozialen Marktwirtschaft zum Erfolg. Dem gegenüber steht das angelsächsische oder US-Modell, an dem sich etliche der neu zur EU gekommenen Länder stärker orientieren. Wie wird es sich auswirken, dass jetzt zwei verschiedene Wirtschaftskulturen innerhalb der EU aufeinander treffen?
Leitl: Ich stelle das bei meinen Kontakten in den Erweiterungsländern nicht fest, sondern dort sind die Dinge, die ich eben gesagt habe, allgemein akzeptiert. Dass von Seiten der Wirtschaftspolitik in unseren Nachbarländern gesagt wird, man müsse mit den Unternehmenssteuern hinunter, dafür mit den indirekten Steuern hinauf und damit die Bevölkerung stärker belasten, das kann durchaus auch eine Strategie sein, die ja auch Irland gegangen ist, das ursprünglich das Sorgenkind Europas war. Heute ist es ein Musterschüler. Man schaut dadurch zuerst, dass Investoren ins Land kommen. Dadurch wird Beschäftigung geschaffen, dann gibt es zusätzliche Steuereinnahmen, und dann kann man auch den privaten Lebensstandard erhöhen. Das ist eine wirtschaftspolitische Strategie, die hat mit angelsächsischem Wirtschaften nichts zu tun. Die grundsätzliche Werteverbundenheit in Europa eint uns und ist nicht nur die Basis unserer Kultur, sondern auch des heutigen Ist-Zustandes in der EU. Die Erweiterungsländer haben ja eine Umstellung hinter sich, die für uns hier völlig undenkbar ist. Sie haben alle Verhaltensweisen aus dem kommunistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem niederreißen müssen. Das ist ihnen gelungen, hat aber ganz andere ökonomische Verhaltensweisen als unsere erfordert. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, werden sich die wesentlichen Dinge wieder etablieren, einfach durch den kulturellen Background in Europa, aber auch durch andere Wettbewerbsverhaltensweisen als in den USA. Die Betonung des Humankapitals und des ökologisch und sozial richtigen Verhaltens, das sind Positionen, die sind außer Streit, was in den USA so nicht der Fall ist.
Die Furche: 97 Prozent der österreichischen Unternehmer geben an, diese sozialen oder ökologischen Aspekte in ihrem Handeln zu berücksichtigen. In der öffentlichen Wahrnehmung wird den Unternehmern Ethik aber kaum zugetraut. Wie erklären Sie sich das?
Leitl: Ethisches Handeln hat etwas mit einer Grundanständigkeit, aber auch mit einer Grundverantwortung zu tun. Ethisch handelt also die große Zahl an Unternehmen, die brav Steuern zahlt, die ihre Leute ordentlich beschäftigt, ihnen Aus- und Weiterbildung zukommen lässt und die Menschen mit Gütern und Dienstleistungen und darüber hinaus mit menschlicher Ansprache versorgt. Das sind unendlich wertvolle menschliche Kontakte. Wenn die Bauern Landschaftsgärtner sind, sind wir Humangärtner. Das sind alles Bestandteile eines ethischen Verhaltens, aber wenn Sie die Unternehmer fragen, was sie von Wirtschaftsethik halten, werden die meisten sagen: "Gar nichts, ich muss schauen, dass mein Geschäft gut läuft." Das ist kein Widerspruch. Denn wenn man die Unternehmer fragt, ob bestimmte Merkmale der Ethik für sie von Relevanz sind, bekennen sich die Leute in einem erstaunlich hohen Ausmaß dazu. Österreich ist ein unternehmerisch sozial denkendes Land, nur wird das soziale Verhalten nicht an die große Glocke gehängt, sondern praktiziert, zum Beispiel in den vielen Unternehmen, die lieber eine schwierige Periode durchtauchen als bei schlechter Auftragslage ihre Mitarbeiter zu kündigen. Das sind die Unternehmen, die in ihren Nahbereich eingebettet sind, die in der Gemeinde eine wichtige Rolle spielen, die sich bewusst sind, dass ihre unternehmerische Tätigkeit auch ein Beitrag zur allgemeinen Weiterentwicklung ist.
Die Furche: Wie gesagt, die Konsumenten sehen dieses Engagement, jedenfalls einer europaweiten Umfrage zufolge, kaum...
Leitl: Wenn Sie die Leute fragen, ob ein Unternehmen ethisch handelt, ist das eher eine akademisch-intellektuelle Frage, da werden Sie auf der breiten Basis wahrscheinlich nicht viele Antworten bekommen, mit denen Sie etwas anfangen können. Aber wenn Sie fragen, ob die Leute sehen, dass mit Mitarbeitern ordentlich und verantwortungsbewusst umgegangen wird, dass ihre Sorgen und Probleme geteilt werden, dass sie gefördert werden, dass jungen Menschen eine wertvolle Ausbildung zukommt, dann bekommen Sie überwältigende Antworten. Das ist für mich Ethik. Ethik heißt aber nicht eine neue Form von Heiligkeit oder Sündenfreiheit. Es geht darum, dass man eine Grundhaltung der Mitverantwortung gegenüber den Mitmenschen hat, und diese haben unsere Leute und ihre Mitarbeiter.
Die Furche: Das Bewusstsein ist also da, aber offenbar fehlt die Bereitschaft, in den genannten Bereichen weitere Gesetze zu akzeptieren, wie etwa die Diskussionen über die Verringerung der Treibhausgas-Emissionen und über das Recht auf Elternteilzeit zeigten.
Leitl: Gerade bei der Elternteilzeit haben wir gesagt, wir wissen, dass unsere Leute die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für ein wichtiges Gut halten. Aber einfach zu sagen, jemand, der Elternpflichten zu erfüllen hat, hat das Recht auf Teilzeit für sieben Jahre mit Jobsicherung, das wird nicht als hilfreich empfunden. Das wird als staatliche Zwangslenkung empfunden, die jegliche Motivation raubt. Wir haben derzeit etwa 100.000 Teilzeitbeschäftigte in diesen Elternjahrgängen. Wir sind bereit, mit einem Anreizsystem dafür zu sorgen, dass es in den nächsten drei Jahren jeweils zehn Prozent mehr werden. Das war unser Vorschlag. Wenn man den gegenteiligen Weg geht, nehmen wir zuerst einmal die Kleinbetriebe bis zwanzig Leute heraus, weil es dort organisatorisch schwierig ist, bei den größeren Betrieben auch nur dann, wenn es zumutbar ist; dann wird jeder sagen, was muss ich tun, damit mir die fehlende Zumutbarkeit nachgewiesen wird. Man denkt schon negativ. Die Wirtschaftstreibenden sind sehr motivierbar, aber sie lassen sich nicht gern in eine Richtung zwingen.
Die Furche: Was wünschen Sie sich von der Politik für Rahmenbedingungen, um ökonomisches, ökologisches und soziales Handeln am besten verbinden zu können?
Leitl: Wir haben in Österreich zum Glück die große Tradition der Sozialpartnerschaft. Sie ist in den letzten Jahren trotz aller Unkenrufe stärker geworden. Wenn ich mir andere Länder anschaue, die auf harte Konfrontation setzen, und unser Modell, und mir anschaue, dass diese soziale Stabilität bei vielen internationalen Unternehmen ein wichtiger Standortfaktor ist, sind wir mit unserem Modell gut gefahren, und wenn es uns gelingt, dieses Modell in Zukunft weiterzuentwickeln, also Manager des Wandels zu sein, dann wird es auch in Zukunft ein erfolgreiches Modell sein. Das ist eine sehr aktive Sache, nicht bewahren und festhalten. Wer festhält, verliert. Wer verändert, um sich an neue Umgebungen anzupassen, der gewinnt. Das sehe ich als Teil eines österreichischen Erfolgserlebnisses. Überall in Europa, wo man ähnliche Wege geht, hat man Erfolg: Dänemark, Schweden, Finnland, Holland, Irland. Die Länder schneiden im Durchschnitt viel besser ab. Das soll uns motivieren, diesen Weg weiterzugehen und weiterzuentwickeln.
Das Gespräch führten Claudia Feiertag und Rudolf Mitlöhner.