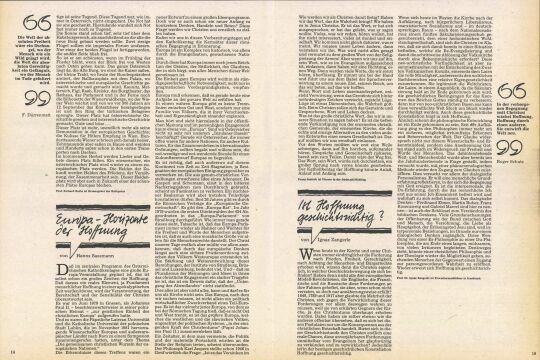"Ein jeder muss jetzt Pflüger werden", hat furche-Gründer Friedrich Funder vor 60 Jahren franz fischler spannt in seiner Rede zur furche-Jubiläumsfeier am 1. Dezember den Bogen von der
Sehr geehrter Herr Bundespräsident Fischer, meine Damen und Herren!
"Ein jeder muss jetzt Pflüger werden", hat Friedrich Funder in seinem ersten Furche-Leitartikel heute genau vor 60 Jahren zugerufen. Ich weiß nicht, ob man deshalb jemanden der mit der Technik des Pflügens vertraut ist zum Festvortrag eingeladen hat, jedenfalls freue ich mich darüber sehr und bedanke mich für diese große Auszeichnung.
Furche = Perek = wühlen
Die Herkunft von Wörtern verrät oft einiges über den Hintergrund einer Sache. Das Wort "Furche" kommt vom indogermanischen "perek", was soviel heißt wie "fragen" oder "wühlen". So gesehen ist Furche mehr noch ein journalistischer Begriff, als ein landwirtschaftlicher. Ihre Zeitung widmet sich seit nunmehr 60 Jahren dem (Hinter)fragen, dem Wühlen und beweist damit, dass die etymologische Verwandtschaft nicht von ungefähr kommt. Sie hat jedenfalls Woche für Woche umgebrochen, durchlüftet, gewendet - um einige andere Begriffe der Pflügersprache zu verwenden - damit das heutige, geistige und politische Österreich keimen und aufgehen konnte.
Die Gründer der Furche wussten, dass es für einen echten Wiederaufbau Österreichs nicht genügt hätte, die Mauern der zerbombten Häuser wieder aufzurichten. Um eine Wiederholung der Schrecken und Verbrechen des Zweiten Weltkriegs unmöglich zu machen, musste man das geistige Feld neu bestellen, neue Furchen ziehen, in denen die Saat für ein neues, einiges und demokratisches Österreich wachsen konnte. Nur so konnte aus dem "Staat, den niemand wollte" (Portisch über das Österreich der Zwischenkriegszeit) ein "Staat, den alle wollen" (Khol über das heutige Österreich) werden. Ein Land, das innenpolitisch stabil, außenpolitisch dem Frieden verpflichtet und wirtschaftlich hervorragend positioniert ist.
Harte Arbeit, große Ausdauer
"Wir sehen unsere Aufgaben mit beharrlichem Bemühen, Dienst am Frieden und am Wiederzusammenfinden der Menschheit zu leisten", heißt es im Leitartikel zur ersten Ausgabe der Furche. Man kann den Furche-Gründern eigentlich kein größeres Kompliment machen, als dass sie sich schon 1945 zur Aufgabe gemacht haben, was dann fünf Jahre später von Robert Schuman als Grundauftrag für die europäische Integration formuliert wurde. Genauso wie den Furche-Gründern war es auch den europäischen Gründervätern bewusst, dass es harte Arbeit und große Ausdauer brauchen wird, um das Saatbeet zu bereiten, in dem Europa wachsen konnte.
In seiner Deklaration vom 9. Mai 1950 hielt Schuman fest: "Europa wird nicht auf einen Schlag erschaffen und auch nicht als Gesamtkonstruktion. Es wird wachsen durch konkrete Umsetzungen, die zuerst eine echte Solidarität erschaffen." Die Idee, mit der Vergemeinschaftung der Schlüsselindustrie Kohle und Stahl zu beginnen, war genial. Dass darauf aufbauend weitere Sektoren und Politikbereiche folgen würden, war von Anfang an geplant und hat funktioniert: Heute leben wir in einem Europa ohne sichtbare Grenzen, mit gemeinsamer Währung, und Kriege zwischen ehemaligen Erzfeinden wie Deutschland und Frankreich sind nicht nur undenkbar, sondern praktisch unmöglich geworden.
Die Ernte ist also eingebracht. Doch wie in der Landwirtschaft kann man sich auch in der Politik und Gesellschaft nicht auf dem Erreichten ausruhen. Um die Zukunft zu sichern, muss man den Boden wieder neu durchlüften und aufs Neue Furchen ziehen. Medien und Politik haben die Aufgabe, aktuelle Ereignisse und Entwicklungen zu hinterfragen und Bewährtes anzupassen, um die Dinge wieder zum Wachsen zu bringen.
An offenen Fragen besteht in Europa derzeit kein Mangel. Das Jahr 2005, das sich dem Ende zuneigt, hat viele dieser Fragen zugespitzt:
* Das "Nein" zur eu-Verfassung in Frankreich und den Niederlanden hat uns ratlos gemacht. Wie ist dieses Nein zu deuten? Ist es ein Nein zur europäischen Integration? Hat die eu überhaupt noch die Legitimation durch die europäischen Bürger?
Egoismus statt Solidarität
* Die eu-Finanzverhandlungen lassen mehr nationale Egoismen als die europäische Solidaritätsgemeinschaft erkennen. Die Auffassungen gehen so weit auseinander, dass mancher sich bange fragt: Gibt es überhaupt noch einen tragfähigen Konsens zwischen den Mitgliedsländern der eu? Oder sind die unterschiedlichen Positionen ein Ausdruck der unterschiedlichen Konzepte von Europa?
* Im Oktober wurde im Zusammenhang mit der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen die Frage nach den Grenzen Europas neu aufgeworfen. Eine europäische Antwort ist nach wie vor ausständig.
25 Hirne, 25 Zungen
* Und im November haben uns die Revolten in den französischen Vororten mit der Frage nach dem Zusammenhalt der europäischen Gesellschaft konfrontiert. Bruchlinien werden aber auch in anderen Politikbereichen sichtbar:
* Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik: In der Haltung zum Irakkrieg wurde einmal mehr offenkundig, dass die Außen- und Sicherheitspolitik nach wie vor als eine nationale Domäne gesehen wird. Allen Mitgliedstaaten ist zwar bewusst, dass sie nur durch eine gemeinsame Außenpolitik eine zentrale Rolle in einer globalisierten Welt spielen können. Wenn es aber zur Entscheidungsfindung kommt, gibt jeder Staat nach wie vor den nationalen Interessen den Vorrang.
Niemand scheint derzeit dazu bereit zu sein, diese nationalen Interessen dem europäischen Ganzen zumindest teilweise unterzuordnen. Daran würde auch der europäische Verfassungsvertrag nicht viel ändern. Dieser sieht mit dem europäischen Außenminister zwar einen einheitlichen Hut vor, unter diesem Hut stecken aber 25 Hirne, und gesprochen wird auch weiter mit 25 Zungen werden.
* Auch in der Wirtschaftspolitik scheinen die Zeiten, in denen die angestrebten Wirtschaftsmodelle die unterschiedlichen Ideologien wiederspiegeln, noch lange nicht vorbei zu sein. Man hatte sich zuvor zum Ziel gesetzt, bis 2010 zur wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsregion der Welt aufzusteigen. Das mag zwar "sexy" klingen, nur haben wir dieses Ziel bisher nicht nur nicht erreicht, sondern wir haben uns sogar in einigen Bereichen davon noch weiter weg bewegt.
Das Hauptproblem besteht hier in der Diskrepanz zwischen europäischem Anspruch und nationaler Realität. Europa kann nicht alles leisten. Die Mitgliedstaaten haben der eu aus guten Gründen nicht die Souveränität über alle Politikbereiche übertragen. Solange aber dringend notwendige Reformen national nicht durchgesetzt werden können, wird es auf europäischer Ebene keine herausragenden Ergebnisse geben können.
* Das Gleiche gilt für das europäische Sozialmodell. Die Herausforderungen an die sozialen Systeme mögen zwar in allen Mitgliedsländern ähnlich sein - allen voran die Demographie und die Arbeitslosigkeit - aber die Lösungsvorschläge könnten unterschiedlicher nicht sein. Beim letzten informellen Finanzministerrat in Manchester vor zwei Monaten sprach der belgische Ökonom André Sapir daher von europäischen Sozialmodellen und wählte dabei bewusst den Plural.
Gespaltenes Europa?
Europa mag gespalten aussehen. Man darf aber nicht vergessen, dass es auch integrierter und größer ist als je zuvor. Dass sich die Wirtschaftsgemeinschaft der sechs Gründerstaaten mit Kompromissen noch leichter getan hat als die heutige politische Union mit 25, ist eigentlich logisch. Doch selbst damals kam es in Einzelfällen zu gravierenden Konflikten, wenn es um die Durchsetzung nationaler Interessen ging, wie 1965 beim sechsmonatigen Boykott der Ratssitzungen durch Frankreich. Je höher der Integrationsgrad und je größer die involvierten Einzelinteressen sind, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit von Auffassungsunterschieden.
Das eigentliche Problem liegt also nicht in einer völligen Ablehnung Europas, sondern in der unterschiedlichen Interpretation von Europa. Zurzeit sind dabei vier Richtungen zu beobachten:
1) Die Vereinigten Staaten Europas. Dieses Modell wurde am prominentesten vom ehemaligen deutschen Außenminister Joschka Fischer in seiner Rede an der Humboldt-Universität in Berlin vor fünf Jahren vertreten und kann am ehesten mit dem deutschen föderalen System verglichen werden. Die bisherigen Nationalstaaten würden demnach eine ähnliche Rolle übernehmen wie derzeit die deutschen Bundesländer.
Dieses Modell hat allerdings den Nachteil, dass es in absehbarer Zeit nicht konsensfähig ist. Eine Großmacht Europa wäre auch sicher nicht im Sinne der europäischen Bürger. Andererseits zeigen alle Umfragen, dass die Bürger ein starkes, handlungsfähiges Europa wollen. Ohne weitere Integration in Richtung einer stärkeren politischen Union ist eine europäische Handlungsfähigkeit vor allem in der Außenpolitik nicht möglich.
"Europa à la carte"
2) Das zweite Modell, das vor allem von britischer, skandinavischer und teilweise von Seiten der neuen Mitgliedsstaaten vertreten wird, ist ein Zurück zu einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft. Das erscheint Europaskeptikern auch hierzulande ein guter Kompromiss zu sein, frei nach dem Motto: "Es soll möglichst viel bringen, aber darf nichts kosten."
Dabei gibt es aber ein Problem: Nicht nur, dass die Integration mittlerweile schon zu weit fortgeschritten ist, um eine "Entflechtung" wieder durchführen zu können. Es stellt sich auch die grundsätzliche Frage, ob eine Wirtschaftsgemeinschaft ohne politische Union überhaupt auf Dauer funktionieren kann. Wirtschaft und Politik haben einen engen Konnex, und daher ist eine Wirtschaftsgemeinschaft ohne politische Komponente nur schwer vorstellbar.
3) Beibehaltung des Status quo: Einige Länder sind durchaus zufrieden mit dem Erreichten, sie wollen aber keine zusätzliche Integration. Zu dieser Gruppe zählen ein Teil der neuen Mitgliedstaaten aber auch einige skandinavische Staaten.
4) Europa "à la carte": Der französische Staatspräsident Jacques Chirac ist der typische Vertreter dieser "Philosophie". Er träumt von einer großen Wirtschaftsgemeinschaft mit vielen Staaten, in der man die Vorteile des gemeinsamen Marktes nutzen kann. Daneben soll es aber eine kleinere, exklusive Gruppe von Staaten geben, die unter dem Titel "verstärkte Zusammenarbeit" eine politische Union mit einer starken Sicherheits- und Verteidigungspolitik bildet. So kann aber Europa nicht funktionieren. Europa funktioniert solidarisch und gemeinschaftlich, oder es funktioniert nicht.
Keines dieser Modelle wird der europäischen Realität wirklich gerecht. Europa ist, wie Jacques Delors es genannt hat, ein "unbekanntes Politobjekt". Es muss sich seinen eigenen Weg bahnen, weil es für die europäische Integration keine Vorbilder gibt. Insofern glaube ich, dass uns eine Finalitätsdebatte nicht weiter bringt.