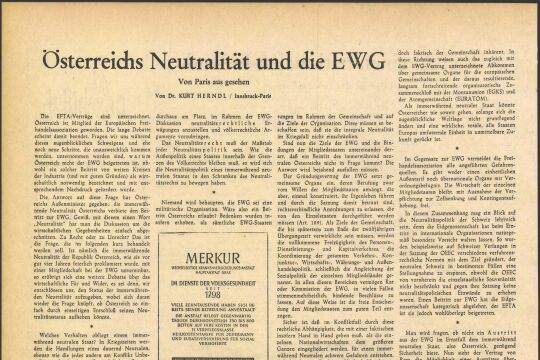Viele misstrauen der Zentrale in Brüssel, deren Wirken schwer zu durchschauen ist. Der Ende Mai wieder tagende Konvent soll die Gemeinschaft auf ein klarer erkennbares Fundament stellen. Welche Perspektiven Österreichs Vertreter in dieses Gremium einbringen, ist ebenso Gegenstand dieses Dossiers wie eine Skizze der derzeitigen Funktionsweise der Europäischen Union.
Wer nur halbwegs in der Schule aufgepasst hat, bekam wohl mit, dass es in Artikel 1 der österreichischen Bundesverfassung heißt, das Recht gehe vom Volk aus. Tatsächlich ist dieses Fundament unserer Verfassung aber längst obsolet. Mehr als die Hälfte aller neuen Normen kommt aus Brüssel und ist vom Nationalrat kommentarlos ins österreichische Recht zu übernehmen (Seite 15).
Das gibt eine Vorstellung davon, welche Bedeutung heute der EU und ihren Institutionen zukommt. Und dennoch interessiert sich kaum jemand für das Geschehen im fernen Brüssel. Niedrige Wahlbeteiligungen bei Europa-Wahlen sind Ausdruck dafür, dass man sich nicht recht vorstellen kann, wie die EU-Maschinerie funktioniert und dass man auf deren Arbeit Einfluss nehmen könne.
Europaweit erzeugt das Unbehagen. Wo immer bisher das Volk über die Entwicklung der Gemeinschaft befragt wurde, war die Antwort entweder negativ (Dänemark 1992 Ablehnung des Maastricht-Vertrags, saniert durch die Wiederholung 1993, Dänemark 2000 Ablehnung des Euro, Irland 2001 Ablehnung des Nizza-Vertrags) oder sie fiel nur ganz knapp positiv aus (Frankreich 1992 pro Maastricht).
Obwohl viel Geld in Werbe-Kampagnen fließt, um den Europäern die EU schmackhaft zu machen, stellt sich kein Enthusiasmus ein. Irgendwie kommt die EU nicht von ihrem Image des "Big Brother" weg: eine ferne, anonyme, mächtige Instanz, die schwer zu durchschauen ist.
Das hat etwas mit ihrer Geschichte zu tun und damit, dass die Akteure kein klares Konzept von der Entwicklung haben: In der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg zur Absicherung einer friedlichen Entwicklung ins Leben gerufen, beflügelte sie zunächst durchaus die Fantasie: Die Perspektive eines gemeinsam erarbeiteten, materiellen Wohlstands im Dienste des Friedens in Europa war attraktiv.
Im Hinblick auf die Friedenssicherung in Westeuropa wurde 1951 der Gründungsvertrag der EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) unterzeichnet. Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande waren die Vertragspartner. 1957 schufen dieselben Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom).
Freier Verkehr
Das Konzept war ziemlich eindeutig: Enge Kooperation souveräner Staaten auf wirtschaftlichem Gebiet. Eine Akzentverschiebung brachte die "Einheitliche Europäische Akte". Sie trat 1987 in Kraft und setzte der mittlerweile erweiterten Gemeinschaft das Ziel, bis Ende 1992 den freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zu ermöglichen. Aber auch ein gemeinsames außenpolitisches Handeln wurde ins Auge gefasst.
Mit dem Maastricht-Vertrag (unterzeichnet 1992) ändert sich die Konstellation: Es entsteht die Europäische Union, ein neues Gefüge mit einer umfassenderen Perspektive. Zur bisherigen Säule der auf wirtschaftliche Integration ausgerichteten Europäischen Gemeinschaft (EG) kommen zwei weitere: die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und die Gemeinsame Innen- und Rechtspolitik.
Die Liste der Kompetenzen Brüssels im Maastricht-Vertrag ist lang und eindrucksvoll: Wirtschafts- und Währungspolitik (im Zentrum der Euro), Agrarpolitik, Visa-, Asyl- und Einwanderungspolitik, Verkehrs-, Steuer-, Beschäftigungs- und Handelspolitik, Sozial-, Bildungs- und Jugendpolitik, Kultur-, Verbraucher- und Gesundheitspolitik, die transeuropäischen Netze, Industriepolitik, Forschungs- und Technologiepolitik, Umwelt- und Entwicklungshilfepolitik... Ein beachtlicher Transfer staatlicher Souveränität: In vielen Bereichen verlagert sich die Entscheidungsbefugnis nach Brüssel.
Die Beziehung zwischen staatlichem und Gemeinschaftsrecht hatte der Gerichtshof der EG schon in den sechziger Jahren klargestellt. 1963 hatte er erklärt: "Die Gemeinschaft (stellt) eine neue Rechtsordnung des Völkerrechts dar, zu deren Gunsten die Staaten, wenn auch in begrenztem Rahmen, ihre Souveränitätsrechte eingeschränkt haben..."
Und 1964: "Zum Unterschied von gewöhnlichen internationalen Verträgen hat der EWG-Vertrag eine eigene Rechtsordnung geschaffen, die ... in die Rechtsordnung der Mitgliedstaaten aufgenommen worden und von ihren Gerichten anzuwenden ist."
Vorrang für EU-Recht
Mit anderen Worten: Die Gemeinschaft schafft selbstständig Recht, das Vorrang vor innerstaatlichem hat - aber wiederum nicht in allen Bereichen! Der Vorrang gilt grob gesprochen nur für Rechtsakte der Wirtschaftspolitik (erste Säule). Wenn es um die Sicherheits- und Außen-, die Innen- und Justizpolitik (zweite und dritte Säule) geht, kann es aus Brüssel nur Programme und Absichtserklärungen geben.
In mancher Hinsicht agiert die EU also wie ein Staatenbund, in mancher kommt sie einem Bundesstaat näher. Zwar wurden der EU bereits sehr viele Kompetenzen übertragen, es fehlt ihr aber die Kompetenz, selbst neue Kompetenzen zu schaffen. So ist sie ein Gebilde im Werden, das im Spannungsfeld sehr divergierender Interessen steht, die jetzt im Konvent (Seiten 16 und 17) auf einen Nenner gebracht werden sollen.
Kuhhandel in Nizza
Weiter kompliziert wird die Sache durch die bevorstehende Osterweiterung (Seite 14). Die Verträge von Amsterdam (1997) und Nizza (2000) sollten die Weichen im Hinblick auf diesen Vorgang stellen. Insbesondere der Vertrag von Nizza ist Ergebnis eines regelrechten Kuhhandels um den zukünftigen Einfluss in den EU-Organen, vor allem im EU-Ministerrat, der das eigentlich entscheidende Organ der Gemeinschaft, der Gesetzgeber, ist.
Jedes Land entsendet einen Vertreter in dieses Gremium. Einmal im Monat tritt er als "Rat der Außenminister" zusammen und behandelt fach- und ressortübergreifende Fragen. Spezifische Fragen werden in den Fachministerräten behandelt, dem "Ecofin-Rat" (der Wirtschafts- und Finanzminister), dem Landwirtschafts-, Verkehrsministerrat usw ...
In den meisten Angelegenheiten entscheidet der Rat mit qualifizierter Mehrheit. Da haben die Stimmen unterschiedliches Gewicht, um das in Nizza heftig gerungen wurde (derzeit zehn für die Großen, zwei für Luxemburg, das kleinste Land, Österreich vier). Nach wie vor gilt für viele Materien die Einstimmigkeit. Sie wird allerdings in der Tendenz abgebaut. Aufgrund des Vertrags von Nizza gilt, dass in der EU-Politik künftig der EU-Ministerrat in rund 35 von 73 Artikeln mit der Mehrheit der Mitgliederstimmen entscheidet.
Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde die Funktion des EU-Parlaments aufgewertet: In einer Reihe von Fragen kann es mitentscheiden, womit die Gesetzgebungskompetenz zwischen Rat und Parlament geteilt wurde. Sie müssen sich dann einigen, damit ein Rechtsakt zustande kommt (Seite 15). Weiters wurdem dem Parlament Kontrollfunktionen übertragen und eine Mitsprache bei der Bestellung des Kommissionspräsidenten.
Allerdings macht dies aus der EU immer noch kein demokratisches System. Es ist ein eigenes Gebilde mit komplizierten Mechanismen, dessen Verfassung nicht in einer zusammenhängenden Urkunde festgehalten ist. Sie ergibt sich aus der Summe von Regeln, die von den Staaten (in oft von kleinlichen nationalen Interessen geprägten Verträgen) vereinbart werden. Diese Regeln stehen in den Gründungsverträgen und in den von den Gemeinschaftsorganen gesetzten Rechtsakten. Wer sich auf das Terrain vorwagt, um sich ein Bild zu machen, resigniert alsbald, weil er sich in einer Kette von Querverweisen und Abänderungen verliert.
Der seit 28. Februar arbeitende Konvent, eine Art verfassunggebende Versammlung, soll da Abhilfe und mehr Klarheit schaffen (Seiten 16 und 17). Sollte er Erfolg haben, gelingt es vielleicht auch besser, im Bürger mehr Verständnis für die Institution EU zu wecken, die sein Leben so stark prägt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!