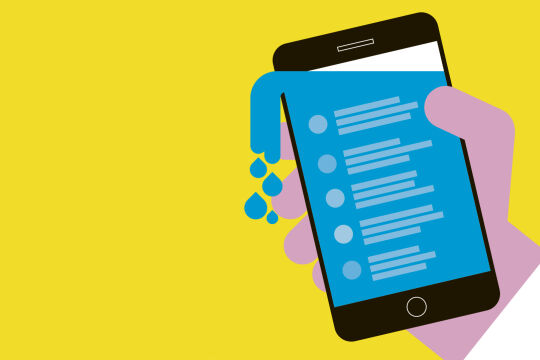Jutta Allmendinger: Kinder verlieren Bildung und Vertrauen
Das Schuljahr soll wiederholt werden, sagt die Soziologin Jutta Allmendinger. Kinder und deren Bildung haben in der Pandemie keine große Wertigkeit gehabt. Ein Interview über Vertrauensverlust, gesellschaftspolitische Narben und Retraditionalisierung.
Das Schuljahr soll wiederholt werden, sagt die Soziologin Jutta Allmendinger. Kinder und deren Bildung haben in der Pandemie keine große Wertigkeit gehabt. Ein Interview über Vertrauensverlust, gesellschaftspolitische Narben und Retraditionalisierung.
Die Soziologin Jutta Allmendinger gilt als eine der meistbeachteten Bildungs- und Sozialwissenschafterinnen weltweit. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Fragen der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, am Arbeitsmarkt oder innerhalb der Familie. Im Gespräch mit der FURCHE erklärt sie, wo sie bildungspolitisches Versagen ortet, wer jetzt am meisten Hilfe benötigt und wo die Pandemie einen Wandel befeuern könnte.
DIE FURCHE: Die Welt befindet sich seit über einem Jahr im Coronamodus. Wie hat sich die Krise auf Kinder und Schüler ausgewirkt?
Jutta Allmendinger: Hier gilt es, vor allem die kleinen Kinder herauszustreichen: Statt im Kindergarten oder in der Volksschule wurden viele über Monate hinweg zu Hause betreut, oft in beengten Verhältnissen und von Eltern, die ja selbst jede Menge anderer Dinge zu tun hatten. Die Krise hat sich bei diesen Kindern in vier Bereichen stark ausgewirkt: dem Verlust an Vertrauen, der Erfahrung von Angst und Gewalt, Problemen beim Spracherwerb und fehlenden Lernfortschritten.
DIE FURCHE: In welcher Hinsicht ging Vertrauen verloren?
Allmendinger: Bei den Kleinen sind die Einschnitte auch deshalb so hart, weil sie den Selbstverständlichkeiten und Gepflogenheiten des öffentlichen Raums weniger ausgesetzt sind, Interaktionen mit Fremden nicht kennen und diese nicht lernen. Genau dies ist aber wichtig, um Vertrauen zu anderen Menschen zu fassen. Georg Simmel – einer der Gründerväter der Soziologie – sagt, dass es das Vertrauen ist, was eine Gesellschaft zusammenhält. Für ihn meint Vertrauen, dass man sich eine Vorstellung darüber machen kann, wie sich andere Menschen wohl verhalten werden. Wie sollen Kinder das schaffen, wenn sie nur selten auf Fremde treffen, sich gar kein Bild machen können? Dazu passen viele Berichte, dass kleine Kinder plötzlich wieder anfangen zu fremdeln, obwohl sie das schon längst abgelegt haben. Und dazu passt auch, dass vielen Kindern das Selbstvertrauen fehlt, sich mit anderen Kindern zu messen. Wir müssen uns klarmachen, dass Kinder viel mehr Zeit mit Spielkonsolen und Fernsehen verbringen und das Homeschooling meist zu einem unkonzentrierten Lernen führt. Ihr Leben ist passiver geworden.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
DIE FURCHE: Auch nannten Sie die Bereiche Angst bzw. Gewalt, die sich Bahn gebrochen haben ...
Allmendinger: Bei Kindern hat sich ein universelles Angstgefühl entwickelt. Werden die Eltern, Familienmitglieder, Freunde angesteckt? Was passiert mit mir? Dies zu ertragen ist alles andere als leicht. Brutal ist eine weitere Form von Angst: die Angst vor Gewalt, oft auch die Erfahrung von Gewalt. In diesen Monaten der Pandemie müssen Kinder oft Übergriffe, physisch wie verbal, ertragen und können nicht darauf hoffen, dass ihnen jemand hilft.
DIE FURCHE: Die Kompensation von psychosozialen Folgen dürfte eine der Hauptaufgaben in Post-Corona-Zeiten sein. Die Institution Schule gilt für viele dennoch weiterhin als Ort des Wissenserwerbs. In welchem Ausmaß wurde Wissen nicht erworben?
Allmendinger: Als Problem sehe ich den Spracherwerb. Die Kinder von Eltern ohne Deutschkenntnisse sind darauf angewiesen, dass sie in den Schulen die deutsche Sprache gründlich lernen. Homeschooling bedeutet, dass diese Kinder mit der deutschen Sprache weniger konfrontiert sind, diese langsamer und schlechter erlernen. Das ist fatal, da viele Lebensoptionen von der Sprache abhängen. Denken Sie nur an die Erwerbsarbeit. Allgemein gilt: Alle Schüler lernen insgesamt weniger. Ihre kognitiven Kompetenzen und ihr Wissen entwickeln sich verzögert, manches lernt man gar nicht. Beim Wissensstand von Lesen, Schreiben, Rechnen, Geografie und Sprachen sieht man das besonders. Wobei es natürlich große Unterschiede zwischen Kindern gibt.
DIE FURCHE: Welche Gruppe hat in puncto „kognitiven Wissens“ hier das Nachsehen?
Allmendinger: Die Kinder von Eltern, denen die finanziellen Möglichkeiten fehlen, gute Endgeräte für das digitale Lernen zur Verfügung zu stellen oder die das Wissen nicht haben, um ihren Kindern eine Stütze beim Lernen zu sein. Es hängt allerdings auch von den Schulen ab. Wie motiviert sind die Lehrer? Welche digitale Ausstattung hat die Schule? Liegt sie in einer Region mit Breitbandanschluss? Je mehr Forschungsergebnisse wir hereinbekommen, desto mehr sehen wir, wie groß die Unterschiede nach sozialräumlicher Lage der Schulen sind. In Deutschland wie in Österreich sind die Bildungschancen allemal schon sehr ungleich verteilt und die Schere zwischen gut gebildeten und bildungsarmen Elternhäusern groß. Diese Schere öffnet sich während der Pandemie noch weiter.
Könnte man nicht über finanzielle Anreize nachdenken, um dieses häusliche Engagement der Männer weiterzuführen?
DIE FURCHE: Wo orten Sie das größte bildungspolitische Versagen innerhalb der Krisenbewältigung?
Allmendinger: In diesem sturen Entweder-oder-Denken. Entweder offene Schulen oder Homeschooling. Das hat schlimme Folgen. Denn wir wissen, dass einige Kinder mit dem Homeschooling gut zurechtkommen, andere aber überhaupt nicht. Warum also haben wir keine gezielten Hilfen entwickelt für jene, die besonders bedürftig waren? Wir wissen relativ gut, welche Gruppen das sind, wo sie leben, in welche Schulen sie gehen. Und wir haben viele Menschen, die gerne helfen würden, etwa Studierende, die ihren Job in der Gastronomie oder im Tourismusgewerbe verloren haben. Wir könnten testen, die Arbeit entlohnen und diese „helping hands“ einsetzen. Diese könnten mit den Kindern nach draußen gehen, beim Digitalunterricht helfen, den Eltern etwas Zeit für ihre eigene Erwerbsarbeit geben. Kurzum: Man hätte die Zivilgesellschaft vielmehr einbinden müssen. Nicht nur medizinische oder technische Innovationen hätte es gebraucht, sondern auch soziale. Ich verstehe auch nicht, warum man Schulen wegen Platzmangels geschlossen hat, während Museen, Theater, Kinosäle, Hotels leerstehen. Bei Heranwachsenden war man nicht kreativ genug.
DIE FURCHE: In einem Interview konfrontierte die FURCHE Bildungsminister Heinz Faßmann bereits im Oktober 2020 mit der Forderung, Kinosäle, Ballsäle etc. aufzusperren und die Krisenbewältigung kreativer anzugehen. Er argumentierte, dass es diese Ideen gebe, eine Umsetzung aber immer wieder aufgrund der föderalen Strukturen scheitere.
Allmendinger: Dann frage ich mich, warum Kommunen diesen Weg nicht gegangen sind. Übergeordnet zeigt uns die Krise aber auch schonungslos die Grenzen und Probleme des Föderalismus. Da müssen wir ran. Das Ende der Coronakrise ist der Beginn von kommenden Krisen. Wenn sich Strukturen als nicht krisenfest erweisen, nicht resilient sind, muss man diese Strukturen überdenken. Dies hat man nicht getan. Und teilweise nicht einmal thematisiert. Das zeigt auch: Bildung steht nicht oben in unserer Prioritätenliste. Familien übrigens auch nicht.
DIE FURCHE: In einem Kommentar in der FURCHE analysierte der Philosoph Peter Strasser auch die Stellung der Lehrlinge und prangerte an, dass diese in der Debatte nahezu unsichtbar seien.
Allmendinger: Ich stimme Professor Strasser zu: Junge Menschen in einer Berufsausbildung bzw. auf der Suche danach wurden vergessen. Sie bekommen oft keine Angebote mehr, weil die Betriebe oft gar nicht wissen, ob sie selbst eine Zukunft haben. Da hätte man mehr helfen, mehr Sicherheit geben müssen. Es geht um die Zukunft unserer Jugend. Wir tun zu wenig und klagen bald wieder über einen Fachkräftemangel.
Wir sind in den vergangenen Monaten zu einer Gesellschaft zurückgekehrt, die von Klasse und Stand geprägt ist – Refeudalisierung.
DIE FURCHE: In einem Fernsehinterview haben Sie von Narben gesprochen, die in puncto Bildung bei Heranwachsenden in der Covid-19-Pandemie entstanden sind. Ist es möglich, diese zu heilen, oder werden bestimmte Gruppen ihr Leben lang davon geprägt sein?
Allmendinger: Der Begriff der Narben ist ein stehender Ausdruck in der Ökonomie. Man wendet ihn etwa bei Müttern an, die nach einer Geburt ihrer Kinder ihr Berufsleben für ein Jahr unterbrechen, dann Teilzeit arbeiten und deswegen nicht mehr in Führungspositionen kommen können. Dieses Konzept kann man auf die Bildung übertragen – und muss alles tun, um solche Narben zu vermeiden, zumindest aber die Wunden so nähen, dass keine Narben entstehen. Man sollte etwa das Schuljahr für alle länger laufen lassen oder wiederholen! Dann sind die Jugendlichen ein Jahr älter bei ihrem Abschluss. Bei dem gestiegenen Lebensalter ist es vollkommen unerheblich, ob ich mit 18 oder 19 Jahren die Schule beende. Wir müssen jenen helfen, die unsere Hilfe am meisten brauchen. Stattdessen rutschen wir zurück in alte Zeiten. Nicht ohne Grund spricht mein Kollege Heinz-Elmar Tenorth von einem Prozess der Refeudalisierung. Die Kinder haben auf der sozialen Position zu bleiben, in die sie zufällig hineingeboren wurden. „Schuster, bleib bei deinem Leisten“, sagen wir nicht nur in Deutschland. Es ist das Ende des Versprechens von Aufstieg durch Bildungschancen. Wir sind in den vergangenen Monaten zu einer Gesellschaft zurückgekehrt, die von Klasse und Stand geprägt wird, und das, obwohl wir glaubten, dies seit den 60er Jahren im Zuge der Bildungsexpansion hinter uns gelassen zu haben.
DIE FURCHE: Ein Leitspruch der Bildungsexpansion war: „Die Kinder sollen es einmal besser haben.“ Ist diese Hoffnung durch die Pandemie obsolet geworden?
Allmendinger: Ja, das ist sie. Die Expansion der Bildung war durchaus ein Demokratisierungsversprechen. Den Menschen wurden Möglichkeiten gegeben und die Chance, daraus etwas zu machen. Die Gegenwart ist ein Verweis zurück in die jeweiligen Klassenlagen. Individualisierung war gestern. Die Unterschiede zwischen den Personengruppen – Stadt versus Land, arm versus reich etc. – sind riesig. Die Pandemie und deren Folgen reißen die Gruppen auseinander. Meines Erachtens werden diese Narben bleiben.
DIE FURCHE: Immer wieder heißt es, die Pandemie wäre wie ein Brennglas, durch das das Wertesystem unserer Gesellschaft besonders deutlich sichtbar ist. Wie bewerten Sie diese Analyse?
Allmendinger: Das ist ja auch eine empirische Frage, und als solche möchte ich sie angehen. Schauen wir auf die Diskussion seit Ausbruch der Pandemie. Was wurde wann diskutiert, was nicht? In Österreich wie in Deutschland wurden die Schulen, Kindergärten, Kinderkrippen einfach geschlossen bzw. auf Notbetrieb gestellt. Im Gegensatz zu skandinavischen Ländern oder Frankreich, die diese Einrichtungen zunächst offengehalten haben und erst später nach sehr intensiven Diskussionen kurzzeitig geschlossen haben. Daraus leite ich ab: Kinder und deren Bildung haben in unseren Ländern keine große Wertigkeit gehabt. Gleiches gilt für die Familie, insbesondere die Situation von Müttern bzw. jungen Familien. Weder in Österreich noch in Deutschland wurde diese zu Beginn der Pandemie groß diskutiert. Es war gesetzt, dass Mütter selbstverständlich ihre Kinder betreuen. Mütter und junge Familien hatten keinen Wert. Und auch nicht das Wohl der Kinder.
Die Virologie hat Wertigkeiten gesetzt und das breite Spektrum dessen übersehen, wie wir Gesundheit definieren. Auch psychische Gesundheit ist wichtig. Auch gesellschaftliches Wohlergehen ist wichtig, Zufriedenheit. Das Gefühl von Gerechtigkeit, Respekt, Augenhöhe, gesehen und gehört zu werden. All das haben wir nicht ernst genommen. Ich möchte nicht missverstanden werden: Bestimmte Wertigkeiten wurden schnell und nachvollziehbar gesetzt. Die Inzidenz und die Gefahr des Virus sind bei älteren Personen am größten, also müssen wir diese besonders schützen. Richtig. Sofort aber kommt die Frage: Rechtfertigt dies deren komplette Abschottung? Das Sterben allein, ohne Trost? Die Erfahrung, den liebsten Menschen nicht beistehen zu können?
Die Krise hat gezeigt, wie wichtig eine sozialversicherungspflichtige berufliche Stellung ist. Wie anders dagegen das Los der Selbstständigen, Freischaffenden.
DIE FURCHE: In den vergangenen Monaten wurde viel über Systemrelevanz gesprochen. Hinsichtlich der Wertedebatte – welche Rolle spielt für Sie diese Causa?
Allmendinger: Es wurde mehr als deutlich, wie sehr unsere Gesellschaft von sogenannten Frauenjobs abhängig ist. Diese sind meist schlecht bezahlt und bieten schlechte Arbeitsbedingungen. Über einige Monate hinweg zollten wir diesen Frauen Anerkennung, dankten ihnen, behandelten sie mit Respekt. Ich war vor einem Jahr sehr optimistisch, dass sich nun auch deren Entlohnung verbessern würde. Doch bislang nur wenig. Das Thema ist nicht mehr auf dem Tisch.
DIE FURCHE: Wie erklären Sie sich diese Wertehierarchie politisch? Haben Familien, Kinder und jene in systemrelevanten Berufen eine kleinere Lobby bzw. die zuständigen Minister(innen) weniger Macht?
Allmendinger: In Deutschland (wie in Österreich; Anm. d. Red.) saßen weder die Familien- noch die Bildungsminister im primären Coronakabinett. Es gab keinen interdisziplinär zusammengesetzten Krisenstab, weder national noch europäisch. Es gab keine großen parlamentarischen Debatten. Es gab keine übergreifenden Prognosemodelle wie etwa in Australien. Wir haben einfach aus vergangenen Krisen nicht genug gelernt. Vielleicht hätte es all das gegeben, wenn man die Dauer der Pandemie realistisch eingeschätzt hätte. So aber hat sich niemand darauf eingestellt, dass die Krise Monate, ja Jahre dauert.
DIE FURCHE: Ein lückenhafter Gesundheitsbegriff, die Geringschätzung von Kindern und Familien, das Hinnehmen von Ungleichheiten, Retraditionalisierung, Refeudalisierung – sehen Sie neben den bereits aufgezeigten noch weitere Folgen, die das defizitäre Krisenmanagement mit sich gebracht hat?
Allmendinger: Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine sozialversicherungspflichtige berufliche Stellung ist. Dann konnte man in Kurzarbeit gehen, ins Homeoffice, man hatte zwar Stress, meist aber keine Angst um die eigene Existenz. Wie anders dagegen das Los von Selbstständigen. Von freischaffenden Künstler(inne)n. Die These wäre: Die Risikoaversion der Gesellschaft hat abgenommen. Das ist nicht gut. Wir brauchen Innovationen.
Jutta Allmendinger im FURCHE Pocast
DIE FURCHE: In Ihrem aktuellen Buch „Es geht nur gemeinsam“ argumentieren Sie, dass die Pandemie zu einer Retraditionalisierung führte. Was bedeutet das?
Allmendinger: Die Begrifflichkeit ergibt sich durch den geringen Wert, den Familien und besonders Frauen im politischen Diskurs erfahren haben. Er ergibt sich daraus, dass Mütter stärker als Väter ihre allemal schon geringere Arbeitszeit noch stärker reduziert und die unbezahlte Arbeit weiter erhöht haben. Er ergibt sich daraus, dass Frauen oft ihre Jobs gewechselt haben und in sichere Positionen gewechselt sind, die allerdings keine Führungsposition in Aussicht stellen. Durch all diese Prozesse erhöhen sich der Gender-Care-Gap, der Gender-Wage-Gap und besonders Unterschiede in den Rentenzahlungen. Das Homeoffice tut dann das seine. Frauen verschwinden aus dem öffentlichen Raum. Ihnen fehlt ein Stück eigenes Leben, finanziell, räumlich, sozial.
DIE FURCHE: Warum schadet die coronabedingte Arbeitsweise, sprich Homeoffice, den Frauen?
Allmendiger: Weil keine neuen, belastbaren und nachhaltigen Netzwerke entstehen. Diese Entwicklung ist für Frauen, die gerade so weit waren, ihre Netzwerke aufzubauen, ganz schlecht. Weil in Onlinesitzungen die Besprechungspunkte durchgetaktet sind, fehlen die Pausen, der gemeinsame Kaffee, zufällige Begegnungen. Früher habe ich oft bei der Rückreise von einem Vortrag über etwas nachgedacht und dann Menschen, die ich kennengelernt habe, kontaktiert. Das fällt jetzt alles weg. Man tauscht auch keine Visitenkarten mehr aus.
DIE FURCHE: Wir haben viel über negative Entwicklungen gesprochen. Lassen Sie uns in die Zukunft schauen. Wie könnte diese gesellschaftspolitisch gestaltet werden, damit aus der Pandemie auch eine positive Wende entstehen kann?
Allmendiger: Wir haben gesehen, dass Männer, die in Kurzarbeit geschickt wurden, mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht haben. Wenn die Frau in einem systemrelevanten Job vor Ort im Betrieb tätig war, dann haben Männer, die in Heimarbeit waren, auch mehr übernommen. Könnte man nicht über Anreize für Männer nachdenken, dieses häusliche Engagement auch nach der Krise weiterzuführen? Finanziell gesehen wäre das im Vergleich zu den Milliarden, die wir für andere Bereiche in die Hand nehmen, gut investiertes Geld.
DIE FURCHE: Was entgegnen Sie den Kritikern, die Ihren Vorschlag aus wirtschaftlicher Sicht für nicht umsetzbar halten?
Allmendinger: Das Fehlen von Mut und Visionen. Wir alle profitieren von einer Gesellschaft und Wirtschaft, in der sich Frauen mehr entfalten und ihre Fähigkeiten zeigen können. Die Wirtschaft schadet sich selbst, wenn sie tradierte Strukturen konserviert.

Es geht nur gemeinsam!
Wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen
Von Jutta Allmendinger
Ullstein 2021, 144 S., geb., € 12,40

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
































.png)