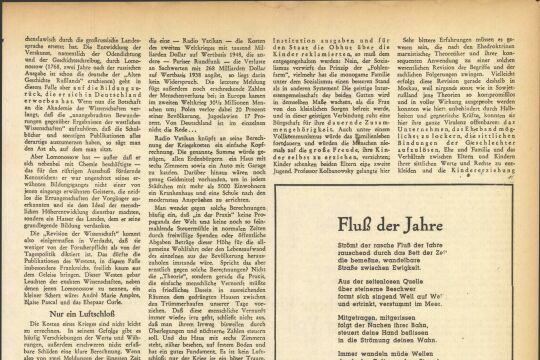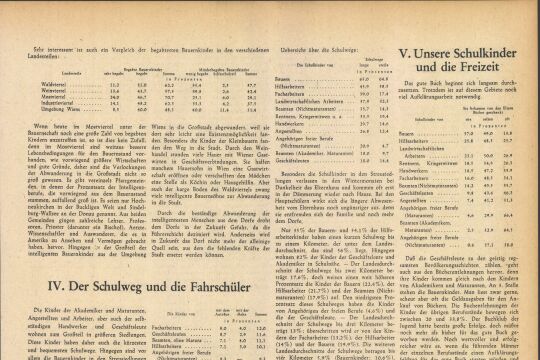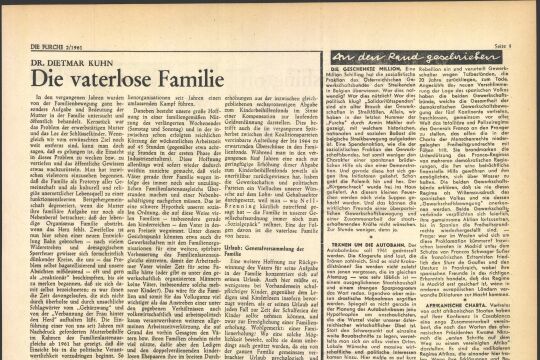Mütter: Wunderwaffe in der Krisenzeit
Muttertag im Zeichen von Corona. Die Politik setzt im Ausnahmezustand auf eine kostenlose Ressource: die Aufopferungsbereitschaft der Eltern. Vor allem Mütter haben das Nachsehen.
Muttertag im Zeichen von Corona. Die Politik setzt im Ausnahmezustand auf eine kostenlose Ressource: die Aufopferungsbereitschaft der Eltern. Vor allem Mütter haben das Nachsehen.
Tanja leitet ein Team in einer Werbeagentur. Sie hat zwei Töchter. Marie ist fünf Jahre alt, Jana acht. Ihr Mann Theo ist selbstständig, arbeitet wie sie im Homeoffice. Beide versuchen seit Beginn der Corona-Krise Aufträge zu retten, die wegzubrechen drohen. Diese Situation wäre für Tanja schon unter normalen Bedingungen ein Stresstest. Im Angesicht der Pandemie kam ein weiterer Faktor hinzu: die Rund-um-die-Uhr-Betreuung ihrer Töchter.
Zwischen Videokonferenzen und Kundenkorrespondenz lernte sie mit Jana, puzzelte mit Marie, kochte das Mittagessen. Aufgaben, die äußerste Konzentration erforderten, erledigte sie nachts, nicht selten bis in die frühen Morgenstunden hinein. „Ich fühle mich nur noch erschöpft und ausgebrannt“, sagt sie. Und was ist mit dem Vater? Tanja: „Er hilft im Haushalt, geht einkaufen und lernt Englisch-Vokabeln mit Jana. Aber der Hauptteil bleibt an mir hängen. Wenn es nach ihm ginge, würden wir jeden Tag Nudeln mit Fertigsoße essen und die Kinder stundenlang vor dem Fernseher parken.“ Die unterschiedlichen Vorstellungen von Erziehung machten sich dieser Tage besonders bemerkbar. Die Corona-Krise ist auch zum Belastungstest für ihre Beziehung geworden.
Die Familie schottet sich ab
Klara und Alex dagegen harmonieren in puncto Erziehungsstil. Klara hat Anfang des Jahres ihr drittes Kind bekommen, die anderen beiden sind im Kindergartenalter. Schon Wochen vor den Ausgangsbeschränkungen hatte Klara ihre größeren Kinder aus der Einrichtung genommen, und vor Herbst wird sie sie auch nicht zurückbringen. „Das Virus macht mir Angst. Ich fürchte mich, dass sich mein Baby anstecken könnte. Dieses Risiko gehe ich keinesfalls ein.“

Liebe Leserinnen und Leser!
Gerade in Zeiten wie diesen freuen wir uns über jede Unterstützung. Denn Qualitätsjournalismus kostet Geld. Testen Sie uns im Rahmen eines kostenlosen Probe-Abos – oder helfen Sie durch eine Spende mit, die Zukunft der FURCHE zu sichern. Näheres unter www.furche.at/abo.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger-Fleckl (Chefredakteurin)
Gerade in Zeiten wie diesen freuen wir uns über jede Unterstützung. Denn Qualitätsjournalismus kostet Geld. Testen Sie uns im Rahmen eines kostenlosen Probe-Abos – oder helfen Sie durch eine Spende mit, die Zukunft der FURCHE zu sichern. Näheres unter www.furche.at/abo.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger-Fleckl (Chefredakteurin)
Das hat zur Folge, dass sich die Familie seit Anfang März in ihrer Wohnung abschottet. Nur ab und zu setzen sich die fünf ins Auto und fahren tief in den Wienerwald hinein, um frische Luft zu schnappen. Die Einkäufe erledigt Papa Alex, der wie so viele in Österreich derzeit um seinen Arbeitsplatz bangen muss. „Noch bin ich in Kurzarbeit. Aber mein Arbeitgeber steht kurz vor dem Konkurs.“
Sabine wiederum ist Alleinerzieherin eines Vierjährigen. Sie arbeitet halbtags als Ordinationsgehilfin. Als systemrelevante Arbeitskraft hatte sie stets Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz im Kindergarten. Aber die Leitung gab ihr zu verstehen, dass ihr Sohn das einzige zu betreuende Kind wäre und er sich alleine beschäftigen müsse. Es wären zwar täglich zwei Pädagoginnen im Wechsel vor Ort, doch diese hätten Bastelarbeiten für die Zeit nach dem Lockdown vorzubereiten.
Am Ende war es doch wieder die Oma, die auf den Enkel aufgepasst hatte. „Ohne Spielkameraden und eine bekannte Bezugsperson wäre mein Kind keine zehn Minuten im Kindergarten geblieben. Ja, natürlich könnte man sein Kind schreien lassen und ihm den Rücken kehren. Aber das widerspricht meinen Vorstellungen von einer guten Mutter.“
Was ist mit dem Kindeswohl?
Genau das ist es wohl, was Müttern in den vergangenen Wochen besonders zugesetzt haben dürfte: Es war die bittere Erkenntnis, dass Kontaktverbote, geschlossene Schulen und Kindergärten sowie gesperrte Spielplätze negative Auswirkungen auf das Wohl ihrer Kinder hatten – und sie dieser Entwicklung quasi hilflos ausgeliefert waren. Fakt ist: Fast alle Kinder in Österreich waren in den vergangenen Wochen mit einem gewissen Maß an sozialer Isolation konfrontiert. Die meisten verbrachten zu viel Zeit vor dem Bildschirm und bewegten sich zu wenig.
Bei den Chefs bleiben die in Erinnerung, die den Laden am Laufen gehalten haben: Väter und Kinderlose.
Hinzu kam die Angst der Eltern vor dem Virus oder/und dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Nicht selten herrschte zu Hause eine angespannte Atmosphäre, weil Lebensumstände zu kombinieren waren, die nicht zu kombinieren sind. Verschärft wurde die Situation durch beengte Wohnverhältnisse, was meist auf Familien zutrifft, die von Armut betroffen sind. Nicht wenige Psychologen hatten vor dem Lockdown vor den psychischen Folgen gewarnt.
Gleichzeitig waren sich die meisten einig, dass die Maßnahmen alternativlos seien. Betroffenen hilft das freilich nicht weiter. Einige von ihnen tauschen indes ihre (negativen) Alltagserfahrungen in diversen Foren aus. So schreibt eine Userin auf der Seite StadtLandMama: „Und dann kam der Tag X. Die Schulen machten zu. Wir bekamen eine Menge Schulstoff nach Hause, ein paar Tage klappte das Bearbeiten recht gut. Doch ich merkte, dass sich meine Tochter veränderte. Sie wurde von Tag zu Tag verschlossener, verbrachte immer mehr Zeit alleine in ihrem Zimmer und hörte einfach still ihrer Musik zu. Das ist absolut untypisch für sie.“ Die Mutter berichtet, dass sie am Ende die Lehrerin um Hilfe gebeten hat. Diese hätte auch sehr verständnisvoll reagiert. Dennoch heißt es am Ende des Textes: „Ich fühle mich als Versagerin.“
Knapp 800.000 Menschen in Österreich leben in einem Familienverband mit mindestens einem Kind unter 15 Jahren. Im Lockdown bedeutete das für die Eltern, dass sie im Homeoffice ihrer Erwerbsarbeit nachzugehen hatten und gleichzeitig die Arbeit auffangen mussten, die sonst von Betreuungs- und Bildungseinrichtungen geleistet wird. Das Krisenmanagement konnte damit auf eine kostenlose Ressource zurückgreifen: die Aufopferungsbereitschaft von Eltern, vor allem die des weiblichen Parts.
Bereits vor der Corona-Krise leisteten Frauen statistisch gesehen mehr Sorgearbeit als ihre Männer. Nach der Geburt schränken Mütter hierzulande ihre Arbeitszeit ohnehin fast immer ein. Die Soziologin Sonja Bastin (Universität Bremen) ist eine von vielen Sozialwissenschaftler(inne)n, die diese aktuelle Entwicklung vehement kritisieren: „Das Funktionieren einer Familie darf nicht zu der Benachteiligung einer Person, häufig der Mutter, führen. Schon Konstellationen, in denen die Mutter etwas weniger verdient, führen im Zuge der Pandemie dazu, dass sie nun noch mehr unbezahlte Sorgearbeit übernimmt. Das kann dazu führen, dass Mütter mit Problemen aus der Krise herausgehen werden. Derzeit vernachlässigen Mütter ihren Beruf mehr als Väter. Und Eltern mehr als Kinderlose. Nach der Krise werden bei den Chefs die Arbeitnehmer in Erinnerung bleiben, die den Laden am Laufen gehalten haben: die Kinderlosen und die Väter.“
So hätte es anfangs nicht einmal eine Debatte gegeben, dass die Last der Familien untragbar ist. Die Regierungen hätten sich blind auf „die unbegrenzte Kümmerkunst der Mütter“ verlassen. Lange wäre nicht einmal kommuniziert worden, dass in dieser Frage an einer Lösung gearbeitet werden muss. Bastin führt das darauf zurück, dass Eltern, ganz besonders jene von Kindergartenkindern und Volksschülern, nicht die entsprechende Lobby haben. „In den entscheidenden Positionen sind die Betroffenen unterrepräsentiert.“
Frauen in der Zwickmühle
Gleichzeitig veranschaulicht die Krise aber auch Fehlentwicklungen unseres Vor-Corona-Lebens, die erst durch die Stilllegung des öffentlichen Lebens wahrgenommen werden. Etwa, dass der klassische Hamsterrad-Alltag Gift fürs Familienleben ist. Die Geschäftsführerin eines Mittelstandsunternehmens, die anonym bleiben will, sagt beispielsweise: „Im Grunde hatte ich mich die vergangenen Jahre zwischen Ganztagsschule und Arbeitsplatz abgehetzt. Ich war eine Getriebene, habe meine Kinder während der Woche kaum gesehen. Jetzt bin ich auch gestresst und arbeite viel. Aber physisch bin ich mit meinen Kindern an einem Ort. Das ist eine neue Erfahrung, die ich mitunter auch genieße. Denn was wäre die Alternative? Ich werde und will meinen Beruf ja nicht aufgeben.“
Wie in vielen Bereichen hat die Krise die Situation von Frauen mit Kindern nur verstärkt. Vor allem von denjenigen, die wenig von ihrem Partner unterstützt werden. Sie befinden sich in einer Zwickmühle, die sich nun in ihre eigenen vier Wände verlagert hat. Tanja, Klara und Sabine versuchen jeweils auf ihre Art mit dieser Herausforderung umzugehen. Das Gefühl, dass ihre Situation seitens der Regierung besonders ernst genommen wird, haben allerdings alle drei nicht. Tanja: „Zuerst diskutierte die Regierung über die Öffnung von Golfplätzen, dann erst ging es um die Familien. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen.“