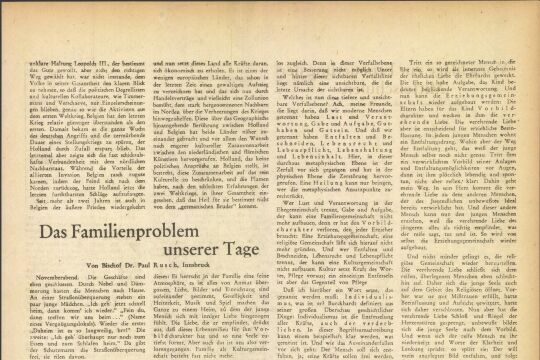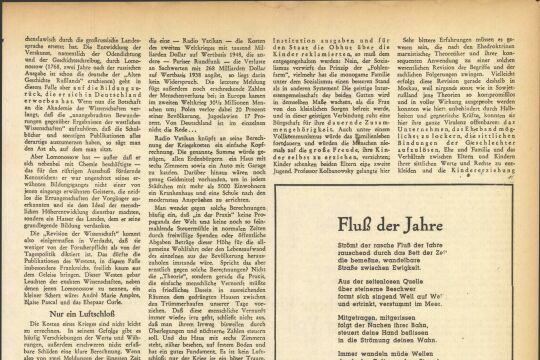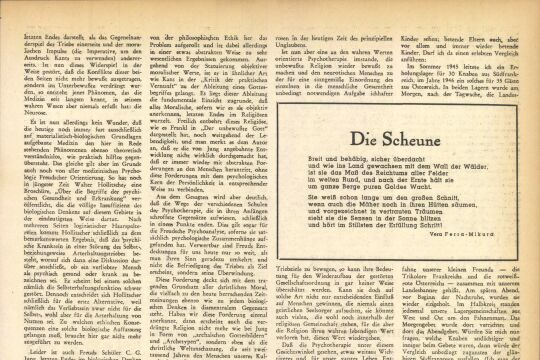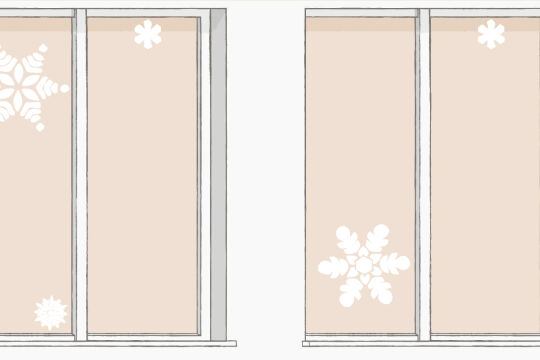Einzelkinder versäumen ziemlich viel
Was die Gesellschaft zusammenhält, wird im Zusammenleben der Familie grundgelegt. Ohne (Mehr-kinder)-Familien überlebt die Gesellschaft nicht.
Was die Gesellschaft zusammenhält, wird im Zusammenleben der Familie grundgelegt. Ohne (Mehr-kinder)-Familien überlebt die Gesellschaft nicht.
Es geschah an einem der goldenen Tage im Spätherbst Wetter und Wald waren wunderschön, aber die Heimfahrt war wieder mal schrecklich. Vanessa ärgerte Tobias, Thibaut stichelte David, Thomas tyrannisierte Arnaud. Nur Nathanael, den alle Momo rufen, hielt sich ruhig. Er war müde und schlief. Ermahnungen an die tobende Bande im Fond des Bullys nutzten nichts. Wiederholungen folgten in verschiedenster Lautstärke. Keine Beaktion, jedenfalls nicht die erhoffte. Der Innendruck stieg. Da passierte es. Der Kragen platzte. „Heute abend kriegt keiner was zu fressen", tönte es vom Fahrersitz. Totenstille. Draußen brummte der Motor. Ein erstes Knurren durchbrach drinnen die unheimliche Buhe.
Zuhause deckte Momo den Tisch. Sechs Gedecke zuviel. Momo räumte wieder ab. Da reute es den Vater, daß der Kragen nicht ein paar Nummern weiter gewesen war. Aber nun hieß es, konsequent bleiben, sonst war wieder für längere Zeit landunter. Die Mutter schwieg, den Blick nachdenklich gesenkt. Der leere Tisch schien länger als sonst. Am nächsten Tag war Schule und ruhig schläft es sich nicht mit knurrendem Magen. Vor allem Thibaut sollte etwas essen, er ist so mager und bekommt leicht Kreislaufprobleme ohne Vitamine und so. So dachte auch der Vater und schon wurde Momo losgeschickt, um den Bruder zu holen. Der lauschte bereits an der Tür, hinter ihm die anderen. Mit einer Botschaft kehrte Momo zurück: „Bibo sagt, alle oder keiner." Der Vater vergaß für einen Moment das Kauen. Das kam unerwartet. Sekunden später war der Tisch wie immer zu klein. Der Braten war auch nicht mehr so zäh.
Thibaut wurde nun ein offenes Lob ausgesprochen. Er habe Sinn für die Gemeinschaft bewiesen. „Ein Kommunionkind", meinte David, der sich - mit vollen Backen - daran erinnerte, daß comunio Gemeinschaft heißt. Jetzt lief der pater familias zu großer Form auf. Solidarisches Verhalten habe mit Gemeinschaft, mit Teilen und mit Liebe zu tun. Das lerne man eben zuerst in der Familie, der kleinen Gemeinschaft zu Hause. Praktiziert werde es auch in den größeren Solidargemeinschaften des Volkes, bei den Steuern, bei den Benten, etc. etc. „Wenn der Bibo den Braten allein gegessen hätte, hätte er nachher Zimmerkeile gekriegt", meinte völlig ohne Pathos Tobias. Und seine Version hatte sicher auch etwas mit Solidarität, mit der Wirklichkeit von Geben und Nehmen zu tun.
So ist normal erlebte Solidarität. Sie wird in der Familie zuerst gelehrt, gelernt und gelebt. Und zwar auf eine osmotische Weise, sozusagen über die Haut eingesogen im täglichen Mit-und Nebeneinander, in tausend Kleinigkeiten des Umgangs in der Familie, so daß sie nachher wie selbstverständlich zur Persönlichkeitsstruktur der Kinder gehört - oder auch nicht.
Je stärker der familiäre Zusammenhalt - eine Chiffre der Soziologen für Liebe - umso intensiver geht das Bewußtsein für Solidarität und Miteinander in Fleisch und Blut über. Freilich bedarf es eines gewissen intellektuellen Überbaus. Solidarität muß auch verstanden, plausibel gemacht werden. Der Überbau braucht ein Wertegerüst, deren Stangen und Stufen das Gespräch, die Kommunikation in der Familie sind. Nicht die Zahl konstituiert Familie, sondern die Qualität der Beziehungen. Aber ohne Mehrzahl kann es auch kein Bezie-hungsgeflecht geben, mithin keine Chance für die Qualität. Deshalb ist vermutlich eines der größten und am tiefsten prägenden Geschenke, die Eltern einem Kind machen können, daß sie ihm Geschwister schenken.
Kann das nicht auch in der Arbeitswelt oder der größeren Solidargemeinschaft namens Gesellschaft geschehen? Kaum, denn die Gesellschaft ist im Vergleich zur Familie ein Kollektiv ohne Gesichter, ohne Namen. Nur die Familie kennt die Person, hier wird die Konstante der persönlichen Beziehung lebendig. Gesellschaft ist namenlose Sachgemeinschaft, sie erzeugt weder Liebe noch Solidarität, sie lebt nur von ihr. Als Sachgemeinschaft ist sie auch dem Wandel der Arbeitswelt unterworfen.
„Vor 25 Jahren noch", schrieb der amerikanische Soziologe Fitzhugh Dodson schon Mitte der siebziger Jahre, „bereiteten die Väter ihre Söhne auf ein Leben als Erwachsene vor, das dem ihren sehr ähnlich war. Unsere Kultur aber ändert sich mit solch einer Geschwindigkeit, daß dies nicht mehr möglich ist. Man weiß, daß von 100 Kindern, die heute auf einem Schulhof spielen, fünfzig Berufe ausüben werden, die heute noch gar nicht existieren. Die Väter können diese ihre Kinder also gar nicht auf ein Leben wie sie es führen vorbereiten. Der Wandel der Gesellschaft geht zu schnell voran." Konstant aber bleibt die persönliche Beziehung. Für sie zählt nicht, was der andere hat - Geld, Güter, Ideen -, sondern was er ist: Vater, Sohn, Mutter, Tochter, Freund -alles Menschen, Gesichter mit Namen.
Es gibt viele Arten von Gemeinschaftserlebnis. Das gemeinsame Essen zum Beispiel. Wenn Geschwister eine Mahlzeit vorbereiten, dann nicht nur der Gaumenfreuden wegen. Und es gehört zu den traurigen Erfahrungen von Kindern aus den sogenannten Mehr-Personen-Haushalten, daß man sie nicht versteht, wenn sie ihr Interesse für das Wohlbefinden von anderen bekunden. Ein anderes Solidarerlebnis ist das Gebet. Wer für andere betet, der ist solidarisch in einem Sinn, der an die Tiefe der Existenz rührt. Deshalb droht eine Gesellschaft, in der nicht mehr gebetet wird, zu verflachen und zu zerfallen. Eine Mutter, die mit ihrem Kind für andere betet, übt Solidarität, stiftet Gemeinsinn und Gespür für Selbstlosigkeit, wie es wohl keine andere Schule vermag. Die Eltern, die Kinder, die Familie - eine Schule der Tugenden, das wußten schon die Alten. Wissen es noch die Jungen, die sich für eine Welt ohne Kinder entscheiden?
Sie wissen es. Nach einer aktuellen Emnid-Umfrage (Herbst 97) sind den meisten Deutschen „ideelle Werte" wichtig. Und „die Familie vermittelt diese Werte am besten". Meist seien es konkrete, persönliche Erfahrungen, die zu diesem Urteil führten. Jedenfalls nennen die Deutschen auf die Frage „welche Menschen oder Institutionen sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten, um Werte zu vermitteln" 96 Prozent „die Eltern" an erster Stelle und 69 Prozent „Lehrer" an zweiter. Abgeschlagen auf Platz drei bis fünf landen Vorgesetzte (29 Prozent), Kirchen (23 Prozent) und Medien (18 Prozent).
Erziehung zu Toleranz, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Treue und Verantwortung geschieht wie jede Erziehung zu großen und guten Teilen spontan. Natürlich ist es von Nutzen, ein pädagogisches Konzept, besser noch eine Lebensphilosophie zu haben, um die Spontaneität richtig kanalisieren zu können. Aber Voraussetzung dafür ist, zunächst mal überhaupt präsent zu sein. Ohne physische Präsenz läuft die Spontaneität ins Leere. Wenn der vier-oder fünfjährigen Tochter beim Spielen eine Frage in den Sinn kommt, wird sie diese Frage stellen wollen und zwar in der Begel der ersten Bezugsperson, der Mutter.
Ist die Mutter nicht da, wird das Kind kaum auf die Idee kommen, die Frage aufzuschreiben oder im Laptop zu speichern, um sie erst am Abend zu stellen. Kinder stellen ihre Fragen aus der Situation heraus. Das können auch Bemerkungen oder Behauptungen oder auch Beschreibungen sein, die sie mitteilen wollen. Um diese Mitteilungen zu bestätigen, zu korrigieren oder auch zu kommentieren, müssen sie erst einmal wahrgenommen werden. Damit ist nicht nur die physische Präsenz gemeint, sondern auch die innere Hinwendung oder Präsenz des Herzens. Aus diesem Dialog, so lehren uns die Jugendpsychologen, aus diesem ersten sozialen Umgang zu Hause erwächst mit den Jahren für das Kind eine innere Selbstsicherheit und somit auch die Fähigkeit zu sozialem Verhalten mit anderen Personen außer Haus. Und was ist, wenn die Präsenz nicht nötig ist, weil es keine Kinder zu Hause gibt? Dann ist wohl weniger Spontaneität angesagt, dann steht Sachlichkeit und Sterilität auf dem Programm. Eine traurige Alternative. Abgesehen davon, daß die reine Sachlichkeit mit Solidarität oft nicht mehr viel zu tun hat, die Gesellschaft degeneriert zu kalten, funktionierenden Teilen. Die „Totalität der Arbeitswelt", vor der der jüngst verstorbene Philosoph Josef Pieper so oft warnte, sie hätte auch das Zuhause besetzt - und entseelt.
Die Familie ist der gesunde Nährboden für die Sozialisierung der Person, das geistige Umfeld für das Hineinwachsen in die Gesellschaft. Es ist bezeichnend, daß - folgt man der wissenschaftlichen Literatur - „die Erzeugung solidarischen Verhaltens" als ein Grund für den verfassungsrechtlichen Schutz der Familie genannt wird. Es sei eine Leistung, die in der Familie „in einer auf andere Weise nicht erreichbaren Effektivität und Qualität" erbracht werde. In der Allgemeinen Menschenrechtserklärung heißt es, die Familie ist der „natürliche und fundamentale Kern" der Gesellschaft. Und „aus der Familie erwächst der Friede für die Menschheitsfamilie", schrieb Papst Johannes Paul zum Jahr der Familie 1994. Dennoch muß sie sich oft gegen die Politik behaupten.
Sie kann es - von finanziellen Aspekten einmal abgesehen, die es in der Tat heute erheblich erschweren, eine Familie zu gründen und zu ernähren —, weil diese Lebensform der Natur des Menschen entspricht, seinen Hoffnungen und Sehnsüchten, seinem Durst nach Liebe, seinem Hunger nach Anerkennung in der Gemeinschaft, seinem Bedürfnis nach Intimität, die Geborgenheit schenkt und Gefühl für existentielle Sicherheit. Deshalb blendet eine Scheidung oft mehr aus als nur eine gemeinsame Vergangenheit. Sie kann seelisch verstümmeln. Sie kann den Sinn für Gemeinschaft und Treue im Kern spalten, Verlustängste durch Erziehung „vererben" oder Lebensenergien zerstörerisch zur Explosion bringen. Aber die gleichen Kräfte und Energien, von Liebe genährt, in der Erziehung erprobt und gestählt, sie stärken Familie und Gesellschaft.
Vielleicht hat der Vater in unserem Beispiel eingangs das damals nicht so gewußt oder verstanden, als er die Botschaft vernahm: Alle oder keiner. Aber er hat es geahnt und, wie die meisten Väter und Mütter, instinktiv in der Familie gelebt. Darauf kommt es an. Ohne die Kinder aber wäre es nicht möglich.
Der Autor ist freier Journalist in Deutschland und Vater von zehn Kindern.