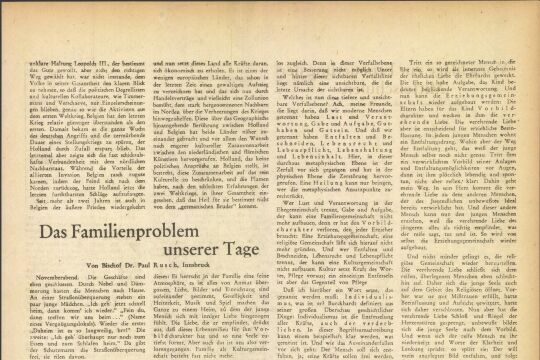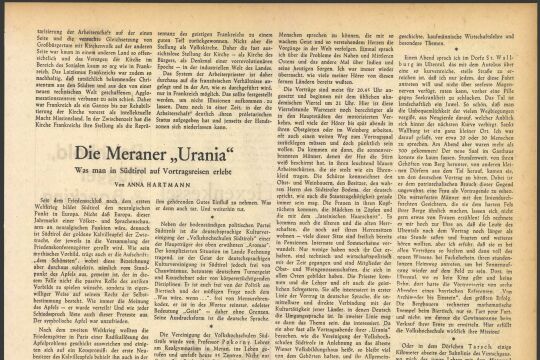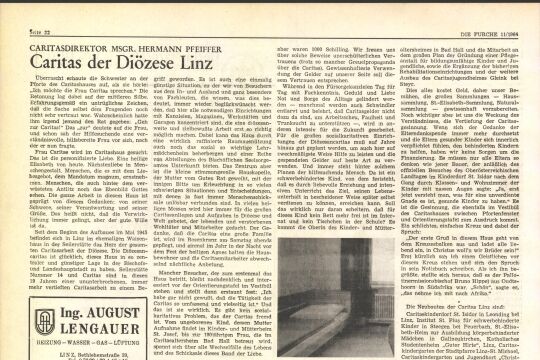DER WAGEN HAT ERST VOR WENIGEN MINUTEN, auf der Straße vom Hauptbahnhof Linz westwärts fahrend, den Bereich der großen Stadt verlassen. Die hohen Gebäude werden niedriger, die Woge aus Stein verebbt im Land, über dem die strahlende Sonne dieses überaus zeitigen Frühjahres liegt. Zur linken Hand steht behäbig, als wir im Kinderdorf St. Isidor einfahren, ein Vierkanter; zur rechten ein in der Bauanlage ganz gleiches, aber durch eine vorgelagerte Arkade und durch Mansarden modernisiertes Gebäude. Wir fahren an der Kirche vorbei, Mittelpunkt der Siedlung und zugleich Zentrum des religiösen Lebens der Umgegend, im Jahre 1953 erbaut, und halten zwischen zwei sehr verschieden aussehenden Bauten. Rechts ein dreistöckiges, neuzeitlich wirkendes Haus mit flachem Dach, links ein niedriges Gebäude. „Das niedrige Haus ist”, sagt beim Aussteigen Direktor Erber, „die erste in Österreich nach dem Kriege gebaute Schule. In jenem Jahre 1948 war jeder Ziegelstein, jeder Sack Zement, jeder Topf mit Lack, ganz zu schweigen von Eisen oder Leichtmetall, eine Kostbarkeit.” Man sieht diesem niedrigen Hause, in dem uns Sonderschu’.direktor Anton Rumler empfängt, kaum an, unter welchen Schwierigkeiten in jener Zeit ein karitatives Unternehmen von besonderer pädagogischer Bedeutung beginnen mußte.
DAS KINDERDORF VON SANKT ISIDOR bei Leonding — es ist erst seit dem Jahre 1955 zur selbständigen Ortschaft erklärt worden — hat sich die Aufgabe gestellt, das Glück einer Erziehung im Familienverband auch solchen Kindern zu schenken, die wegen eines körperlichen, sprachlichen oder geistigen Gebrechens nicht bei Eltern sein können; teils, weil diese Kinder verwaist oder verlassen sind, teils, weil die vorhandene Familie nicht die Möglichkeit besitžt, einen wirklichen sozialen Kontakt Und die dauernde fachärztliche Betreuung zu vermitteln, aber auch, weil der nötige Besuch einer Sonderschule nicht garantiert weiden kann. In einer gewöhnlichen Internatserziehung kann ein von Natur aus benachteiligtes Kind nicht entsprechend gefördert werden; ein solches Kind versteht ja nicht — wie etwa eines, das aus siedlungsmäßigen Gründen höhere Schulbildung auswärts suchen muß —, warum es aus der eigenen Familie fort muß; es braucht in viel höherem Grad ein familiengerechtes Milieu, weil es einmal durch seine physische Konstitution und außerdem durch die Entfernung von der angestammten Familie benachteiligt ist. Ein solches Kind ist wie eine Pflanze, die man sorgfältig versetzt, der man möglichst die gleiche Erde geben muß, aus der sie sproß; eine Blume, die mehr Sonne, mehr Windschutz braucht als eine andere.
WIR BETRETEN DIE DRITTE KLASSE. An der Wand befindet sich eine Tafel mit Abbildungen von Kleidungsstücken, wie man sie aus einem Kaufhaus kennt. „Um die Kinder in der Bildung von Sätzen zu schulen”, erklärt Direktor Rumler von der allgemeinen Landessonderschule II, „benützen wir die Signalmethode von Freunthaller und versuchen so, den Agrammatismus zu beseitigen oder wenigstens zu verbessern: Nun, Resi”, so sagt er zu dem Mädchen an der Tafel, „was machst du da jetzt?” — „Ich kaufen”, das Kind verbessert sich gleich: „kaufe eine Bluse.” Das Bild wird ausgelegt — es ist eine Tuchtafel, auf der das Bild der Bluse im Augenblick sogleich allen sichtbar haftet — und die Frage wird an das nächste Mädchen gestellt: „Was macht die Resi?” Und sofort kommt die klare Antwort: „Sie kauft eine Bluse.” Die Gesamtpersönlichkeit steht bei der Unterrichtsarbeit mit debilen, sprach- gestörten und schwerhörigen Kindern immer im Mittelpunkt. Eine isolierte Behandlung, so betont man ausdrücklich, eine gesonderte Berichtigung der Sprachfehler lehnt man ab. Beim Schuleintritt ist das debile, sprach- gestörte Kind nqch nicht im Zustand eines gewöhnlichen Kindes, das einen Kindergarten besucht. Es ist eine mehrjährige, langsame und konsequente Arbeit nötig, die vorhandenen Fähigkeiten zu nützen und auszuweiten. Welches Maß von Geduld, von innerer Teilnahme, von menschlichem Mitgehen (nicht Mitleid!) da notwendig ist, kann der Besucher, der eine solche Klasse betritt, nur ahnen — und bewundern. Wenn man über die Köpfe der Kinder hinwegschäut, hat man eigentlich gar nicht den Eindruck (und dies verstärkt sich später bei den Gehbehinderten), daß diese Kinder unter ihrem Schicksal leiden. Und das ist auch keineswegs der Fall. Wir müssen uns nämlich hüten, Gefühle aus unserer persönlichen Sphäre zu transponieren. Wir würden alle Maßstäbe verlieren. Während ich mit dem Direktor rede, der den Gebrauch des Mikrophons und der Kopfhörer erklärt — das Kind kann die zweckmäßige Lautstärke selbst wählen —, hat Resi sich frohgemut den Bügel über den Kopf gelegt und hört, man sieht das aus ihrem leuchtenden Gesicht, gut zu. Als wir draußen auf dem Gang schon eine lange V eile gestanden sind, kommt ein Kind nach und fragt, ob die Resi den Kopfhörer abnehmen könne, „denn es gibt jetzt nichts mehr zu hören”. Nun, diese Disziplin läßt sich sehen und hören.
EINEN TEST haben wir auch durchmachen müssen: die roten, runden, in verschieden tiefe Löcher zu steckenden Hölzer so zu ordnen, daß sie, von oben gesehen, gleich hoch sind; und das in möglichst einer Zeit, die den Rekord von Sekunden, der auf der schwarzen Tafel hinter mir verzeichnet ist, unterbietet: das ist mir wohl hinsichtlich der Zeit gelungen (der Lehrer stand mit der Stoppuhr neben mir). „Aber”, so wendet er ein, als ich mit meinem Werk fertig bin, „die Hölzer sind nicht gleich hoch.” Nichts ist es mit einem Rekord! Der kleine Bub da vor mir, der den Holzkasten mit den Löchern bekommt, ist geschickter. Wohl schaut auch er vorher in die Vertiefungen hinein, aber irgendwie sind seine Finger geschickter. „Hinter Ihnen stand eben jenes bedrückende Phänomen unserer Tage”, sagte der Lehrer sinnend. „Schnell, schneller, am schnellsten; das, was heute die Menschen terrorisiert, sie langsam, aber stetig zermürbt: die Zeit! Für dieses Kind da wirkt ein Ordnungsmaß aus seinem Innern, und meine Stoppuhr hat es weniger beeindruckt als Sie, der im nächsten Augenblick auf die Uhr schauen. wird, ob er nicht zum Zug zu spät kommt.”
ES GIBT DINGE, von denen sich unsere Schulweisheit wirklich nichts träumen läßt. So beispielsweise, welche Schwierigkeit es für ein Kind bedeuten kann, ein Pfeifchen zum Tönen zu bringen. Es gelingt beim ersten Male. Beim zweiten Male, als der Lehrer aneifert: „Gut, gut, aber jetzt länger!” will es wieder gar nicht gehen. Man muß dieses Mienenspiel im Gesicht des Kindes, die rätselhaft im Innern wirkende Kraft, den bemühten Willen sehen — und dann, als ein langes Signal durch das Schulzimmer hallt, dieses Leuchten auf dem Gesicht, das allen verkünden möchte: Da schaut her, wie läng ich’s kann! Ein anderes Schulungsobjekt, das uns jetzt Sonderschuldirektor Franz Bayer vorführt, ist eine einfache, kleine Kerze. Es geht für das Kind nur darum, das Licht auszublasen. Eine Tätigkeit, die, wenn sie andere Kinder um uns oder wir selbst vollziehen, förmlich gedankenlos vor sich geht. Hier aber bedeutet es Konzentration des Willens, physiologische Konsequenz — und welch tiefer Eindruck bleibt wieder bei dem Zuschauer zurück, wenn er sieht, mit welcher Miene die ausgeblasene Kerze zurückgereicht wird! Direktor Bayer ist seit 1948, Direktor Dr. Fuchs, der Fachpsychologe und. Leiter der Landessonderschule I, sogar schon seit 1946 hier tätig. Dr. Fuchs ist übrigens auch Direktor der Sonderklassenschule in St. Pius in Steegen-Peuerbach. Diese Expositur wurde nach den Erfahrungen von St. Isidor geschaffen. In Steegen wohnen und werden jene Kinder unterrichtet, die an den hochorganisierten Sonderschulen mit ihren sieben aufsteigenden Klassen nicht über die Unterstufe hinauskommen. In sechs Klassen werden dort gegenwärtig 90 Kinder unterrichtet; die außerschulische Betreuung liegt in den Händen der Caritas. Der Direktor der Caritas der Diözese Linz, zugleich Präsident der Österreichischen Caritas- Zentrale, Monsignore Hermann Pfeiffer, hat es sich nicht nehmen lassen, den Besuch aus Wien auch durch das Therapiehaus und durch die Kinderwohnhäuser zu begleiten.
WIE SIEHT HIER EINE KINDERDORFFAMILIE AUS? Wie wohnt man? Wie groß ist die Familie? Kocht man selbst? In St. Isidor, das in rechtlicher Hinsicht von der Caritas der Diözese Linz getragen wird und in schulischer Beziehung dem Landesschulrat untersteht, das sich ferner der Mitwirkung und der Zusammenarbeit mit der Landesfürsorge und der Landessanitätsbehörde erfreut, hier wirken, im Gegensatz zu anderen Formen der Kinderdorffamilie, wo eine Mutter die Kinder im eigenen Haushalt umsorgt, zwei Mütter zusammen. Diese Zusammenarbeit kann nach den persönlichen Wünschen zweifach sein;, entweder beide Mütter leben mit ihren Kindern in einer gemeinsamen Wohnung, wo jede Mutter sich um ihre sechs Kinder bemüht; oder die beiden Mütter leben nebeneinander in zwei völlig selbständigen Wohnungen. Bei Abwesenheit einer Mutter kann sich die andere um deren Kinder mitsorgen. Darin, daß sich die zwei Frauen zur Zusammenarbeit finden müssen, daß sie ihre Wànsęhe, ihre Sorgen einander mitteilen können und voreinander viel freier sprechen als vor Außenstehenden, daß sie sich gegenseitig ihre Erfahrungen vermitteln können: darin liegt ein großer Wert. Wie sehr dieses Zusammenwirken geschätzt wird, kann man in St. Isidor daraus ersehen, daß keine von den Müttern baumäßig getrennt und allein leben möchte. Um den Maßstab für das normal entwickelte Kind nicht zu verlieren, nehmen die Mütter in den großen Ferien, wo etwa zwei Drittel der Kinder, die eine gut eigene Familie haben, dorthin zurückkehren, für drei bis vier Wochen normale Ferienkinder zur Erholung in ihre Kinderdorffamilie auf. Die Auswahl der Kinder für die einzelne Familie erfolgt durch das Los, das die Mutter zieht. Die Kinder werden vom Landesfürsorgeamt eingewiesen. Solange immer noch mehr Kinder vorgemerkt sind, als aufgenommen werden können, ist diese Art der Einweisung wichtig, weil wirklich nur stets den Kindern, für die es am nötigsten ist, geholfen wird. Ein siebentes (oder achtes) Kind kann — nach Wunsch — in die Familie freiwillig genommen werden. Ein solches Kleinkind habe ich im Bettchen, das die anderen Kinder neugierig und gespannt umstanden, gesehen; für den ersten Blick glaubte man wirklich, in irgendeinem beliebigen Haushalt zu sein. Kochen müssen die Mütter nicht selbst, das ist eigentlich gar nicht erwünscht; die Mütter können sich, unabhängig von den Problemen des Einkaufs und den Arbeiten in der Küche, das Essen aus der Zentralküche holen. Im Eßzimmer, in das wir gerade zur Mittagsstunde traten, legte ein Bub eben Messer, Gabeln und Löffel auf.
DIE FRAGE ARBEITSPLATZ: Dem Jugendlichen wird die Gelegenheit gegeben, Sich, seiner Behinderung entsprechend, produktiv zu betätigen. Er wird nicht von vornhere’in zu einer bestimmten Tätigkeit veranlaßt. Mit Fingerspitzengefühl, mit viel Gemüt und Herzenswärme trachtet man, den Jugendlichen in jene Tätigkeit zu bringen, die seinen Fähigkeiten entspricht; es sind die sonderbarsten, auf den ersten Blick verwickeltsten Umwege nötig, von dem erwünschten Beruf (den man nicht einschätzen kann) zum möglichen Beruf hinzuleiten. Teamarbeit der Mütter, der Schwestern (vom hl. V. von Paul und Barmherzige Schwestern vom hl. Karl Borro- mäus als Lehrkräfte), geistliche und weltliche Erzieher, jung und alt, vom Bodensee bis zum Neusiedler See, sowie regelmäßige Praktikanten (auch evangelische Hochschüler aus Deutschland), Fachleute der Medizin und Krankenschwestern haben jenes beispielhafte Wunder von St. Isidor zuwege gebracht, von dem man im Dorfe nicht viel redet. Ein chinesisches Sprichwort, das im neuen Kalender des Dorfes auf dem inneren Deckblatt steht, sagt: „Wer auf ein Jahr wirken will, der säe Korn. Wer auf zehn Jahre wirken will, der pflanze einen Baum. Wer auf hundert Jahre wirken will, der erziehe einen Menschen.”