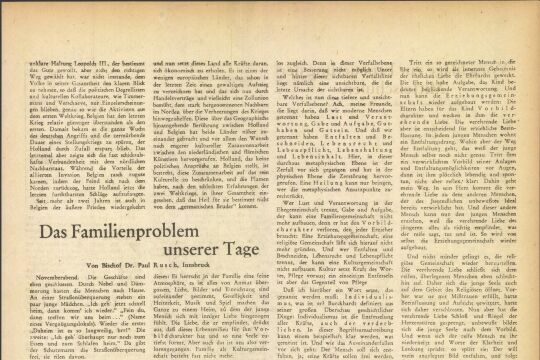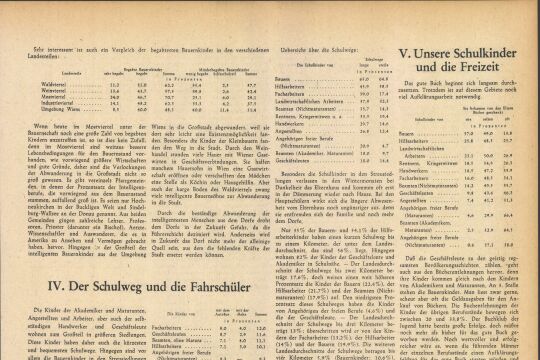Der sechsjährige Klaus furchtet sich vor der Dunkelheit. Sobald die Mutti am Abend das Licht abdreht, beginnt sein Martyrium. Er zieht die Bettdecke fest über den Kopf, achtet genau darauf, daß kein Körperteil unbedeckt bleibt, in den sich der böse Geist oder ein Ungeheuer festbeißen könnte. Klaus kann nicht einschlafen; er beginnt zu schwitzen, er verfällt schließlich in einen unruhigen Schlummer, aus dem er aufschreiend erwacht und dann zur Mutter läuft, um ihr seinen schrecklichen Traum zu erzählen. Klaus ist Bettnässer, es nützt gar nichts, wenn ihm seine Eltern klarmachen, mit sechs Jahren tue man das nicht mehr. Denn Klaus fürchtet sich auch, aufs Klo zu gehen, vor allem bei Nacht. Weil da Schlangen, Drachen und Geister in der Klomuschel lauern, die ihn beißen und quälen und viele schreckliche Dinge mit ihm anstellen könnten.
Klaus ist kein Einzelfall. Wie ihm geht es vielen Kindern, die unter teilweise phantastischen, meist uneinge-standenen und vor ihrer Umwelt verborgen gehaltenen Ängsten leiden. Der erste Schritt zu einer Heilung hegt häufig darin, diese ursprünglich diffuse, uneinheitliche Angst an ein Objekt zu heften und sie damit dem Kind und seiner Umwelt bewußt zu machen. Die Angst vor einem Hund, vor dem Wasser, vor einem Menschen kann bekämpft werden. Weitaus schwieriger ist es, unbestimmten Ängsten, die sich lediglich in Symptomen, wie Bettnässen, Erbrechen oder Asthma, äußern, beizukommen.
Nicht alle Ängste müssen krankhaft sein. Reale Ängste sind sogar notwendig und nützlich, damit sich das Kind -oder der Erwachsene - vor Gefahren schützen kann. Bedenklich wird die Situation erst dann, wenn irreale Ängste so überhandnehmen, daß das Kind darunter leidet und in seiner gesamten Entwicklung beeinträchtigt wird. Es gibt Ängste, die neurotischen Charakter haben und zu Gehemmtheit, Unsicherheit, Krankheit, sogar zu Pseudo-debilität führen können.
.Kinderängste sind im Zunehmen begriffen. Auch wenn wir die Tatsache berücksichtigen, daß wir für Störungen im Kindesalter sensibler geworden sind und dem größere Bedeutung beimessen. Oberärztin Dr. Ruth Naske von der Psychiatrischen Klinik, die
Leiterin des Instituts für Erziehungshilfe, führt das Anwachsen von Kinderängsten auf ein mangelndes Urvertrauen zurück. Dieses kann sich dann nicht wirklich ausbilden, wenn bereits der Säugling in seinen grundlegenden Bedürfnissen wie Hunger, Durst, Wärme, Zärtlichkeit zuwenig befriedigt wird.
Daß Kinder immer häufiger diesbezügliche Mangelerscheinungen zeigen, wirft die Frage nach den Ursachen auf. Die Antwort hegt im Verhältnis des einzelnen zu der ihn umgebenden gesellschaftlichen Realität. Es ist sicherlich ungerecht, dabei in erster Linie der Mutter die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wie Dr. Naske meint, ist es nicht so sehr die zunehmende Berufstätigkeit junger Mütter, weshalb Kin-
der in ihrer frühesten Phase und auch später zuwenig Wärme, Liebe und Geborgenheit erfahren und damit jene schützende Atmosphäre vermissen, die das Entstehen dieses „Urvertrau-ens“ erst ermöglicht, sondern unsere Einstellung dem Kind gegenüber ganz allgemein.
Eine Gesellschaft, die sich an steigenden Produktionsziffern orientiert und ihr Prestige, ihre Selbstachtung aus einem möglichst effektiven Konsumverhalten bezieht, kann nicht jene Voraussetzungen schaffen, die für eine positive Entwicklung des Kindes und damit des Menschen von morgen notwendig sind. Es ist absurd, von jungen Müttern zu verlangen, daß sie in kommunikationsarmen Satellitenstädten, wo man nur wohnen kann, den ganzen Tag bei kleinen Kindern verbringen, ohne irgendeine Anregung, ohne Gesprächspartner, und wenn man sich dann noch wundert, daß diese Mütter depressiv werden, zu Beruhigungstabletten oder gar zur Flasche greifen und dieses gestörte Verhalten an ihre Kinder weitergeben.
Ein Umdenken und daraus folgernd eine Änderung der Verhältnisse müßte ganz woanders und viel tiefer einsetzen. Wir alle müssen begreifen lernen, daß der Mensch nicht nur, aber doch wohl auch aus Leistung besteht, daß daher Frauen ebenso ein Anrecht auf produktive Mitarbeit an unserer Ge-
sellschaft haben wie Männer ein Recht auf die Erziehung ihrer Kinder. Der total in den Erfolgszwang seiner Geschäfte flüchtende Mann kann seinem Kind ebensowenig positive Werte vermitteln wie die total frustrierte, weil in den vier Wänden ihrer - und sei es auch komfortablen - Appartementwohnung eingeschlossene Frau.
Ein Zurückschauen in vergangene Zeiten nützt hier nichts. Die Großfamilie alten Musters gibt es nicht mehr. Aber es gibt die neue Möglichkeit einer offenen Gesellschaft, einer offenen Familie, in der Frau und Mann in gleicher Weise - und mit gleicher Freude -Erziehung und Geschäft betreiben, und damit ihren Kindern jene Liebe geben, die sie benötigen.
Das soll, bitte, nicht gegen die Familie gerichtet sein. Es soll ganz im Gegenteil die Familie aus ihrer gegenwärtigen Krisensituation herausführen, um sie auf einer neuen, geänderten Umständen entsprechenden Basis zu festigen.
Solche und ähnliche Überlegungen scheinen jedoch, wenn schon nicht utopisch, so doch erst in Ansätzen verwirklicht. Die tatsächliche Situation sieht in den meisten Fällen anders aus. Die Kinder wachsen in einer hochindustrialisierten Leistungsgesellschaft auf, in der ein Vater keine Zeit hat, weil er durch seine Arbeit überfordert ist, eine Mutter entweder keine Zeit hat, weil sie durch Doppelbelastung überfordert ist, oder keine Zeit haben will, weil sie durch Isolation (siehe oben) frustriert ist
Eine Welt, in der Omas, Opas, Tanten und Onkel entweder in einem anderen Bezirk oder in einer anderen Stadt wohnen oder in der die Generationsunterschiede in unserer raschlebigen Gesellschaft, die enorme Veränderungen und Bedrohungen innerhalb einer beängstigend kurzen Zeit zu bewältigen hat, so gravierend geworden sind, daß ein Zusammenleben nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich geworden ist.
In einer solchen Gesellschaft fehlt die schützende Geborgenheit, fehlt die hebende Zuneigung, fehlt, daraus resultierend, das kreative Spiel, das Fro-he-Feste-Feiern. Es fehlt an Menschen, die so etwas überhaupt noch können, die so etwas darüber hinaus als genügend sinnvoll erkennen, um sich voll
dafür zu engagieren. Es fehlen Räume, Freiräume, vor allem, es fehlt an Kommunikationsmöglichkeiten.
Diese Situation ist so beklemmend, weil sie tiefer reicht als vielfach angenommen wird. Als in einer Wiener Stadtrandsiedlung zwei engagierte Sozialarbeiterinnen den Versuch unternahmen, in einer „Mutter-Kind-Gruppe“ die Mütter die verlorengegangene Fähigkeit zu lehren, mit ihren Kindern wieder zu spielen, mußten sie feststellen, daß das eigentliche Problem ganz woanders angepackt werden mußte: in dem Versuch, den vielfach bereits gestörten Müttern überhaupt erst einmal die Möglichkeit zu geben, sich über ihre persönlichen Schwierigkeiten auszusprechen.
Das oft zitierte Endstadium für die Kinder ist dann der Fernsehapparat, vor dem sie ganze Nachmittage verbringen, und für den sie um so anfälliger sind, je weniger sie gelernt haben, eine eigene Phantasie auszubilden und zu betätigen.
In der Reizüberflutung, ganz allgemein und speziell jener durch das Fernsehen, sieht Ruth Naske denn auch eine weitere Ursache für das Zunehmen von Kinderängsten. Kinder, die zu häufig vor dem Fernsehapparat sitzen und dabei zuviel präsentiert bekommen, das sie innerlich gar nicht verarbeiten können, reagieren mit Angstzuständen, Gereiztheit, Alpträumen und Konzentrationsschwierigkeiten. Es ist darum wichtig, daß vor allem bei kleinen Kindern immer ein Erwachsener dabeisitzt, um das Gesehene zu erklären und später mit dem Kind darüber zu sprechen, es vielleicht auch nacherzählen zu lassen. Dann kann das Fernsehen, wird es in vernünftigen Dosen verabreicht, kaum schädlich, oft sogar nützlich sein.
Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch Schulängste, Prüfungsängste und Strafängste überhaupt. Prüfungsängste, hervorgerufen durch einen immer stärker werdenden Leistungsdruck, spielen eine immer größere Rolle. Strafängste hingegen machen ein Kind gefügig, autoritätshörig, es wird „brav“. Dadurch kann aber unter Umständen eine seelische Reifung verhindert werden. Das ist auch der Grund, weshalb die „antiautoritäre Erziehung“ vor allem die Strafangst im Auge hat, wenn sie von Kinderängsten spricht.
Welche Folgen Kinderängste haben
können, beschreibt Primarius Dr. Hans Zimprich, der Leiter der psychosomatischen Abteilung an einer Kinderstation im Wilhelminenspital: Die kleinen Patienten, die hier in den 16 zur Verfügung stehenden Betten stationär behandelt werden, zeigen vorwiegend Symptome wie Bettnässen, Brechdurchfall, Asthma, Magengeschwüre. Sie brauchen eine gezielte, durchschnittlich sechs bis acht Wochen dauernde Behandlung, die in einer ruhigen, freundlichen Atmosphäre von geschulten Psychologen und Ärzten durchgeführt wird.
Eine der wichtigsten Formen ist dabei die Spieltherapie, wobei das Kind seine Konflikte im Spiel ausdrücken und damit sich selbst und dem Psychotherapeuten bewußt machen kann. Großer Wert wird auf die „Familientherapie“ gelegt, an der die Mutter, wenn möglich auch der Vater und weitere Familienmitglieder, teilnehmen sollen. „Denn meist“, meint die Psychologin Dr.' Renate Singer, „ist die ganze Familie behandlungsbedürftig.“ Das Kind, in den Familienverband eingebettet, wird auch in seinen Verhaltensweisen davon geprägt und ist bei einer Therapie nicht davon zu trennen. Eltern oder Verwandten das klar zu machen, ist allerdings oft schwierig und häufig nur dann möglich, wenn der Leidensdruck bereits sehr groß geworden ist.
Weil die Zahl gestörter und behandlungsbedürftiger Kinder die Zahl der zur Verfügung gestellten Betten natürlich weit übersteigt, gehen die ambulant zu behandelnden Fälle auch in die Hunderte. Das Kind kommt mit seiner Mutter durchschnittlich einmal pro Woche in die Therapiestunde und kann meist nach etwa einem halben oder einem Jahr entlassen werden.
Neben der Station im Wilhelminenspital gibt es in Wien noch drei „Child-guidance“-Kliniken (eine vierte soll im Jänner 1979 eröffnet werden), die allerdings nur ambulant^ hier aber nach ähnlichen Methoden arbeiten wie im Wilhelminenspital. Wie enorm der Andrang auch hier ist, zeigt die Tatsache, daß die Frist von der Anmeldung bis zur ersten Untersuchung durchschnittlich ein halbes Jahr beträgt, und bis zur ersten Therapiestunde dann noch einmal mit einem Jahr Wartezeit gerechnet werden muß. Daß es angesichts solcher Zustande an der Zeit wäre, durch entsprechende Maßnahmen dieser Entwicklung baldmöglichst Abhilfe zu schaffen, muß nicht eigens erwähnt werden.