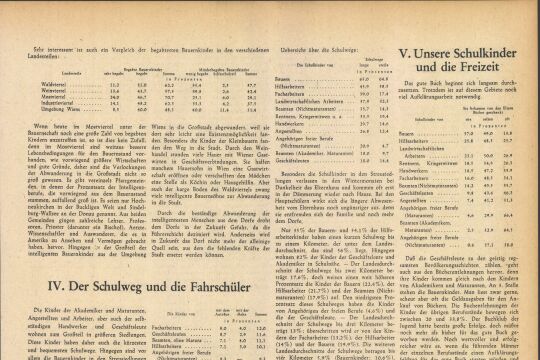Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Dilema mit Pflegekindern
Die Vorstellung, daß Kinder, die von den leiblichen Eltern nicht geliebt werden, von anderen Menschen in liebevolle Obhut ge- nommen werden, hat einen zutiefst humanen Aspekt. Da wir alle Brü- der und Schwestern sind, hilft man dort, wo ein anderer aus irgendwel- chen Gründen versagt. Doch diese Vorstellung hat mit der Wirk- lichkeit leider häufig gar nichts gemein.
Ungeliebte Kinder haben zumeist furchtbare Karrieren der Soziali- sation vor sich. Häufig pendeln sie zwischen Pflegeeltern, Heim und auch leiblichen Eltern, sodaß sie als
Halbwüchsige überhaupt kein Zuhause mehr haben.
Von der Voraussetzung ausge- hend, daß die pränatale Phase in der Entwicklung des Kindes eine große Rolle spielt, läßt sich er- messen, was es bedeutet, ungewollt auf den Tag seiner Geburt zu war- ten und danach weggegeben zu werden. Zwischen Geburt und Weggeben können Zeiträume von mehreren Tagen, Wochen, Mona- ten oder auch Jahren liegen.
Je länger der Aufenthalt der Kinder bei den Eltern, die äußerst ambivalent mit ihren Sprößlingen umgehen, desto größer die Störun- gen. Die Ambivalenz zeigt sich in einem stürmischen Umarmen der Kinder, das rasch in gröbste Miß- handlungen umschlagen kann. Anders gesagt: Die Trieb- durchbrüche können nicht kon- trolliert werden und erreichen unvermindert die Adressaten.
Solche Familien, Lebensgemein- schaften, Einzelpersonen mit Kin- dern sind zumeist den Sozialar- beitern bekannt. Sie sind in ihrer Dissozialität auch in anderen
Lebensbereichen auffällig und bedürfen einer sie durchs Leben begleitenden Hilfe. Kommt nun ein als auffällig Bekannter nach Mei- nung des Sozialarbeiters der Er- ziehung, Beaufsichtigung, Ernäh- rung, Pflege, kurz Obsorge für sein Kind nur in unzureichendem (was ist unzureichend?) Maße nach, macht er dem Klienten das Ange- bot, das Kind zur Pflege weiterzu- geben.
Dieses Angebot ist häufig so for- muliert, daß der Klient genau weiß, er kann es kaum oder gar nicht ablehnen. Die Drohung braucht erst gar nicht ausgesprochen zu wer- den, daß bei nicht vorhandenem „freiwilligen" Einverständnis mit der Erziehungshilfe auch das Ju- gendgericht eingeschaltet werden kann, um die nötige Zustimmung zu erreichen. Dissoziale haben nicht selten Gerichtserfahrung und wis- sen, wie schwer es ist, ihren Stand- punkt dort so zu vertreten, daß die Justiz ein Einsehen hat.
Die gestörten Kinder werden an pflegewillige Familien weiterge- geben oder kommen in Heime. Vie- le pflegewillige Familien haben einerseits durchaus den Wunsch, wirklich Gutes zu tun, andererseits wissen sie auch von den finanziel- len Zuwendungen, die mit der Pfle- ge verbunden sind. So manche Familie konnte mit mehreren Pfle- gekindern ihr Haushaltsbudget so aufbessern, daß Wünsche erfüllt werden konnten, die sonst nie er- reichbar gewesen wären. Nicht wenige Kinder aus Wien sind aufs Land gekommen, weil Bauern ne-
ben dem zusätzlichen Geld auch noch unbezahlte Helfer zur Verfü- gung hatten.
Jene Menschen, die es grund- sätzlich gut meinen, stehen häufig vor dem Problem, daß das Kind, dem sie Zuneigung schenken wol- len, diese gar nicht annehmen kann. Geprügelte und schwer mißhandel- te Kinder sind überaus aggressiv und halten das übliche Streicheln, wie es jeder Vater und jede Mutter dem Kind in Zuneigung angedei- hen läßt, nicht aus. Den einzigen körperlichen Kontakt, den gestörte Kinder aushalten können, ist meist nur der Kontakt des Rauf ens. Nach einer langen Zeit, wenn die Enttäu- schungen durch andere Erfahrun- gen wieder wettgemacht werden konnten, kann eine andere Form des Austauschs von Zuneigung aus- geübt werden.
Kinder von Medikamenten- süchtigen haben monatelang nach ihrer Geburt schwere Ent- zugserscheinungen. Diese äußern sich durch lautes Schreien. Pfle- geeltern, die ihr Kind gewaschen, gefüttert und spazierengetragen haben, die mit Vorsingen von Lie- dern einen entspannten Gemütszu- stand erreichen wollen, stehen plötzlich vor einer großen Ratlosig- keit: Scheinbar unmotiviert schreit das Kleine und läßt sich durch nichts beruhigen.
Nicht selten werden Kinder
nachdem die Pflegeeltern ihre Erwartungen enttäuscht sehen, wieder ins Heim zurückgegeben. Sie wissen nicht, daß nicht sie als El- tern versagt haben, sondern daß die psychischen Störungen des Kindes Anlaß für die Unfähigkeit sind, eine Beziehung zwischen Eltern und Kind aufzubauen.
Begegnen ließe sich diesem Di- lemma nur durch eine radikale Veränderung des Pflegesystems: Für Menschen, die Pflege-Kinder aufziehen wollen, müßte eine ver- nünftige therapeutische Aus- bildung verbindlich sein. Sie müs- sen abstrahieren können zwischen den Schwierigkeiten, die aktuell zwischen ihnen und den Kindern auftreten, und jenen, die sowohl sie als auch die Kinder von früheren Beziehungen geerbt haben. Bedenkt man, daß ein Heimplatz pro Monat für jedes Kind bis zu 60.000 Schil- ling kostet, daß für jedes Pflege- Kind in einer Familie monatlich etwa 3.500 Schilling ausgegeben werden und beachtet man die kläg- lichen Ergebnisse, muß man eine neue Art der Versorgung fordern. Sie muß familienähnlicher werden.
Therapeuten, die mit zwei, drei Pflegekindern leben wollen, die sich zutrauen, jene gefühlsmäßigen Bindungen einzugehen und durch- zustehen, die notwendig sind, um aus einem Kind einen Erwachse- nen zu machen, der sich in der Gesellschaft nicht nur durchsetzen, sondern auch glücklich sein kann, sollten die Möglichkeit haben, mit einem Partner eine Familie zu grün- den. Nicht vorgesehen ist bei die-
sem Plan ein permanentes Nach- schieben weiterer Pflegekinder, sodaß die Familie zu einem Durch- haus wird, sondern das Beschrän- ken auf eine Zahl von Kindern, wie sie den heutigen Standards ent- spricht.
In solchen Familien gäbe es auch keine Möglichkeit, daß Kinder bei Schulschwierigkeiten in ein Heim abgeschoben werden. Ein Vorgang, der bei heutigen Pflegefamilien nicht selten vorkommt. Die zu schaffenden therapeutischen Fami- lien wären selbst bei großzügiger Entlohnung des Vaters oder der Mutter immer noch weit billiger als jedes Heim. Nach Entlassen des letzten Kindes in das Berufsleben müßte den Therapeuten auch eine Pension zugestanden werden. Drei Kinder setzen bei einem gehobene- ren Ausbildungsgang ohnehin 30 Jahre elterlich-therapeutische Arbeit voraus.
Niemand, der sich ernsthaft mit Kindererziehung beschäftigt, wird die Notwendigkeit fixer Bezugs- personen für Heranwachsende be- zweifeln. Wer die Bezugspersonen sind, ist nicht ganz nebensächlich. Am besten sind noch immer die eigenen Eltern, wenn diese aber auslassen, gilt es optimalen Ersatz zu schaffen. Die Familie als Keim- zelle unserer Gesellschaft muß ge- fördert werden, doch sollte das nicht mit Almosen, sondern mit wirkli- cher Hilfe versucht werden. Dann, und nur dann lassen sich jene Teu- felskreise auflösen, die Therapeuten endlos zu beschreiben in der Lage sind.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!