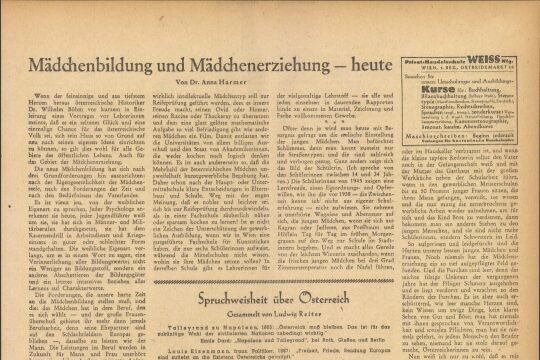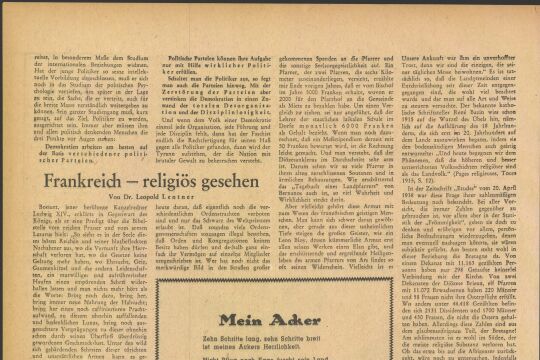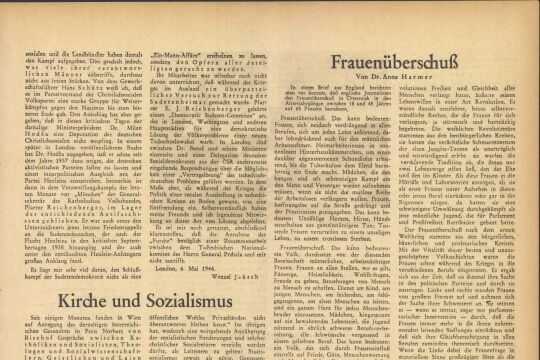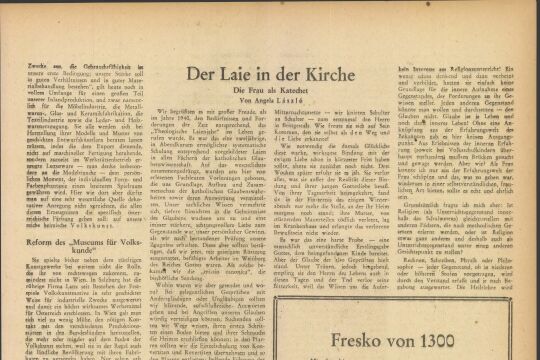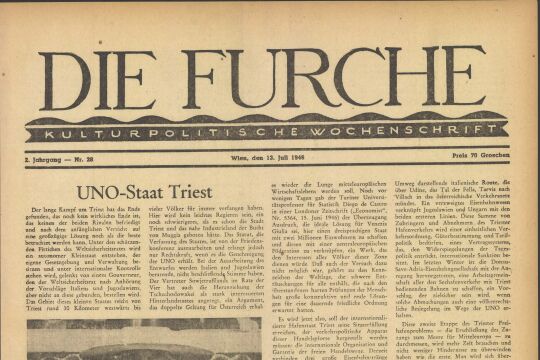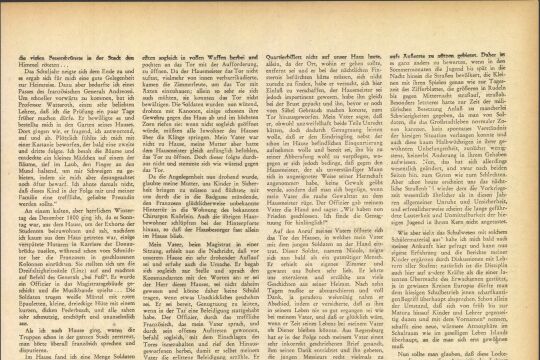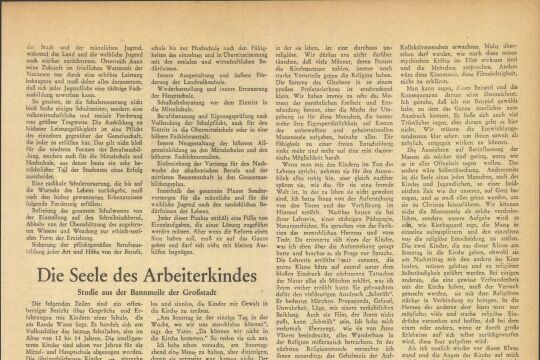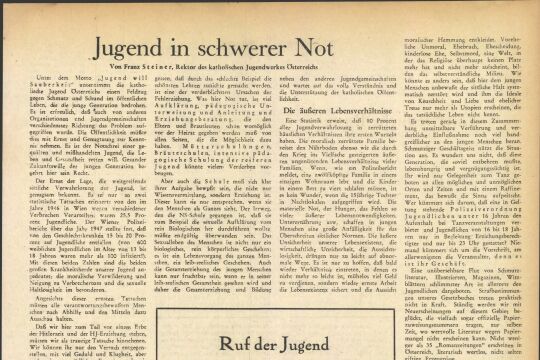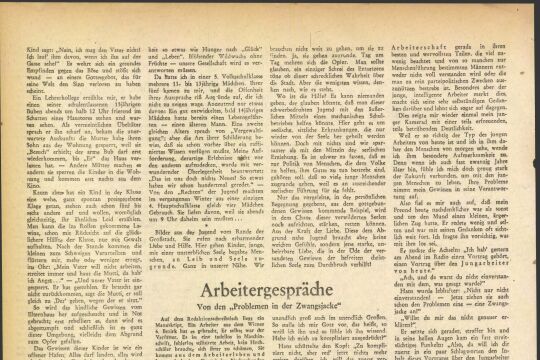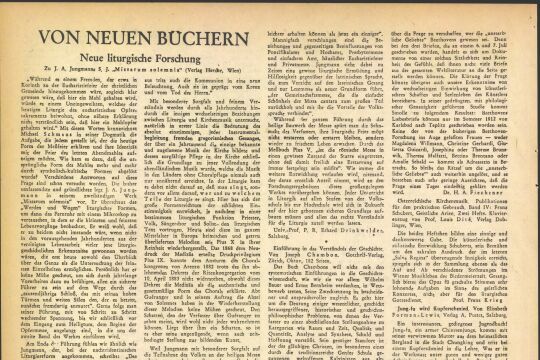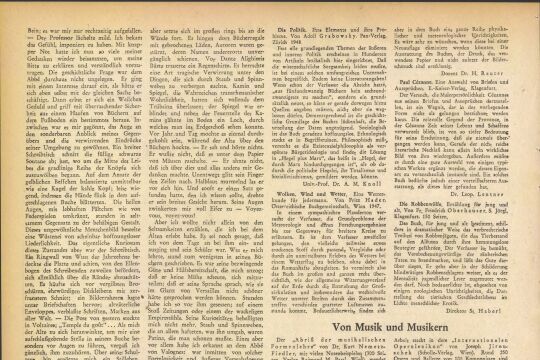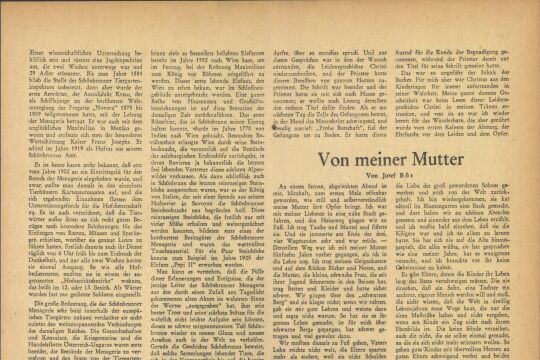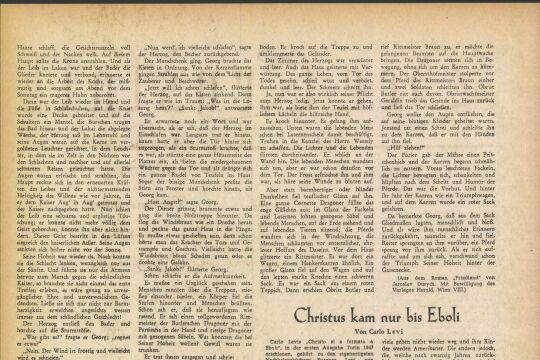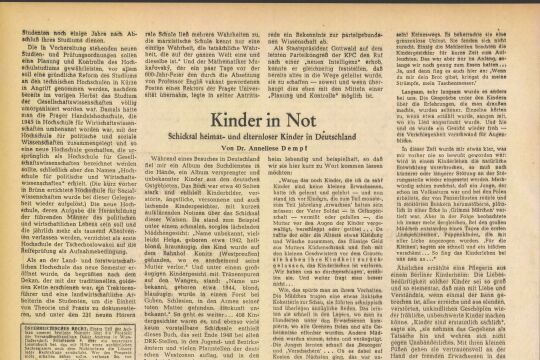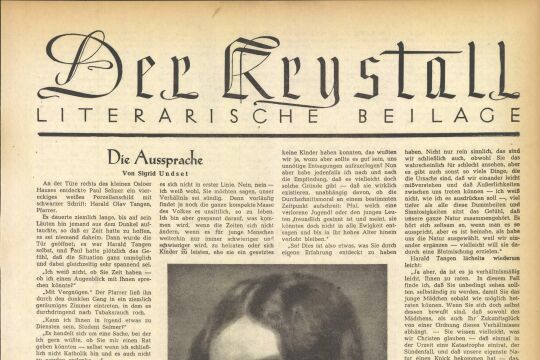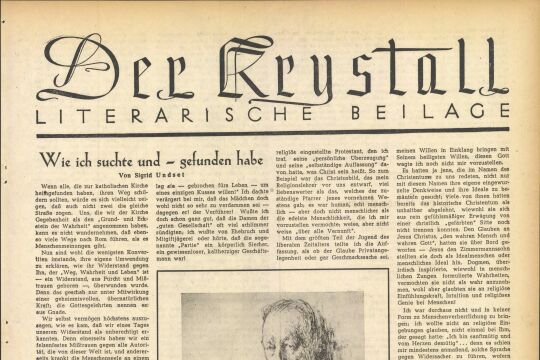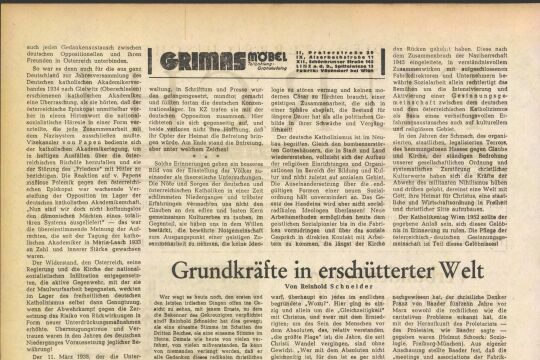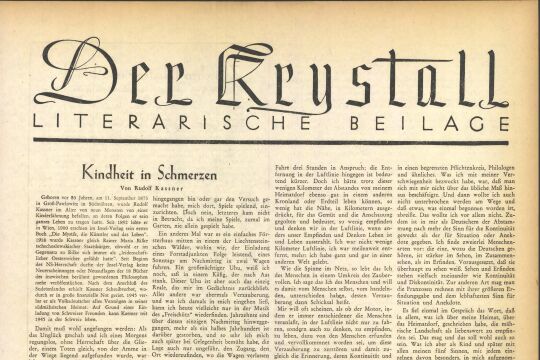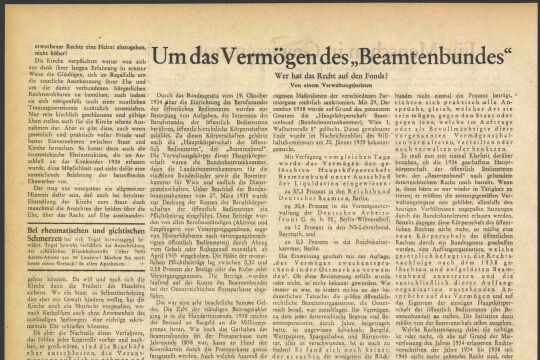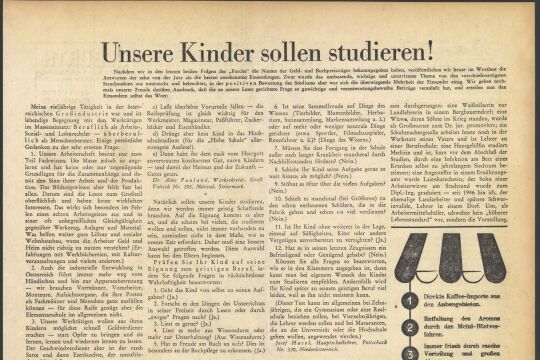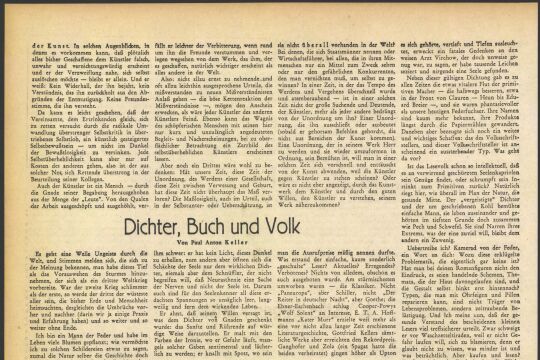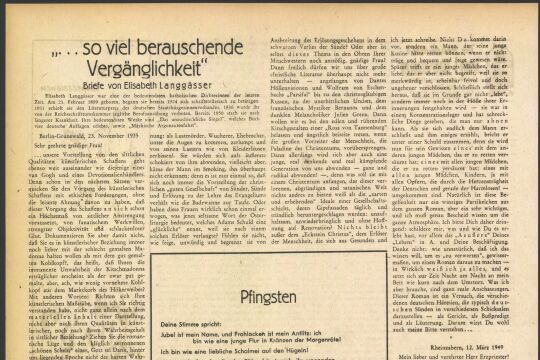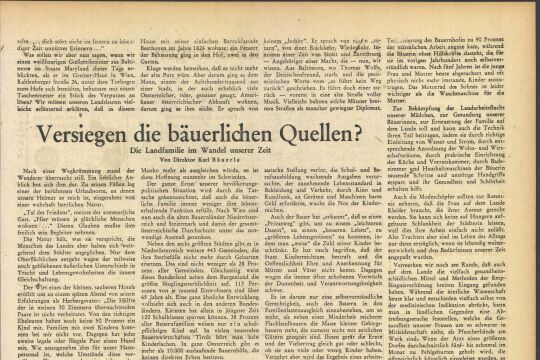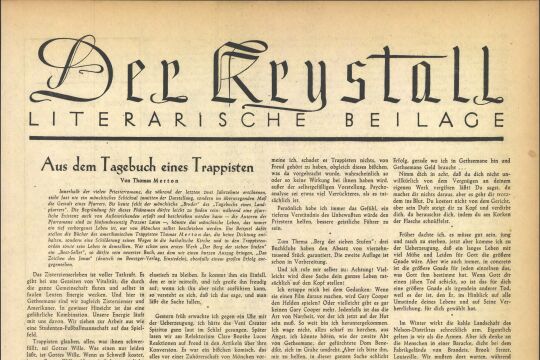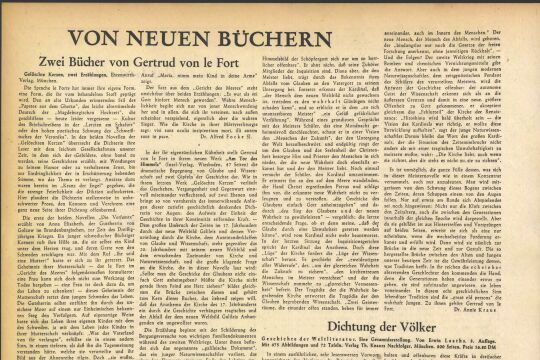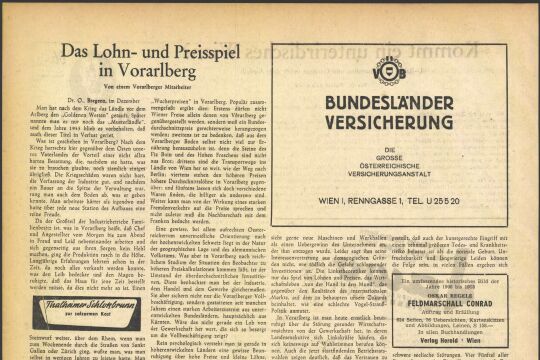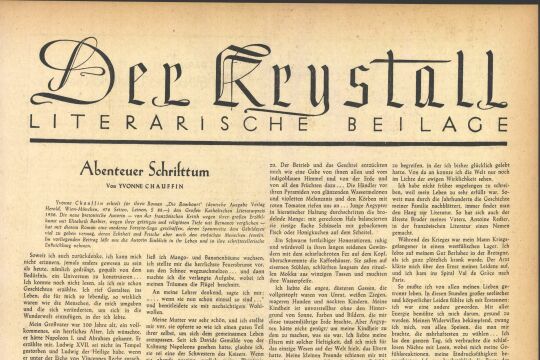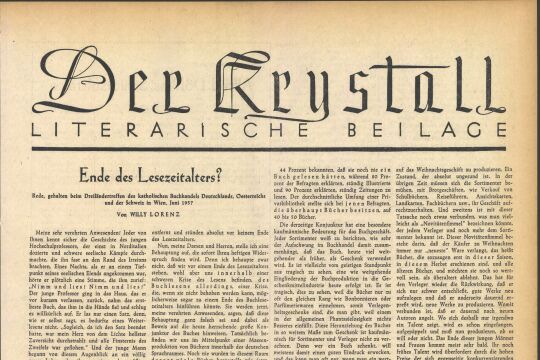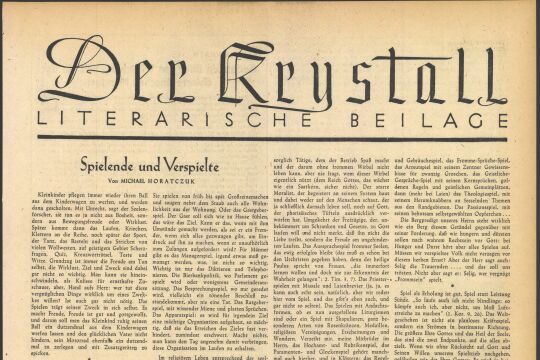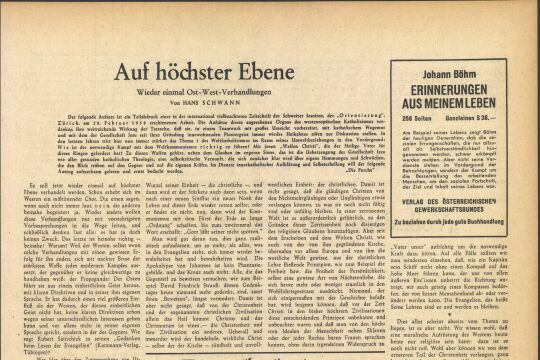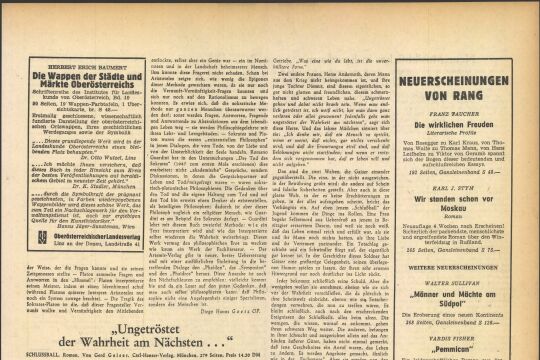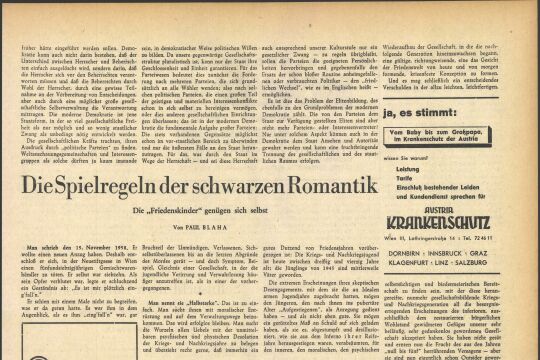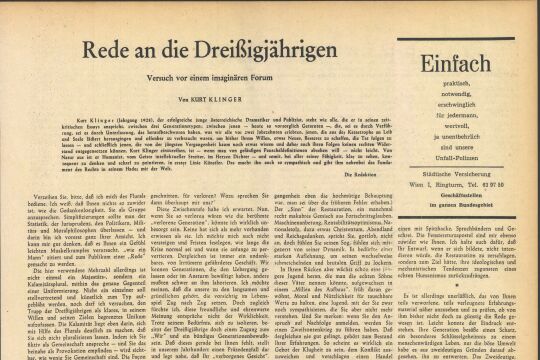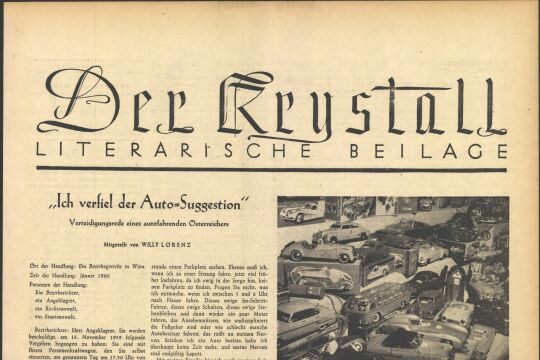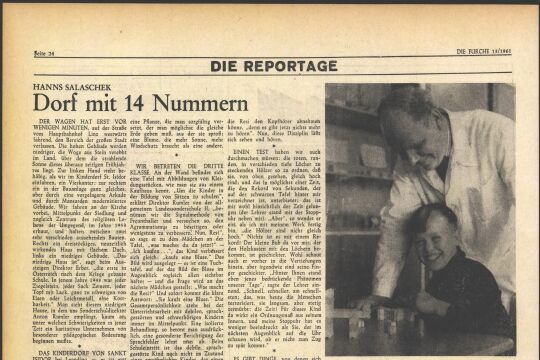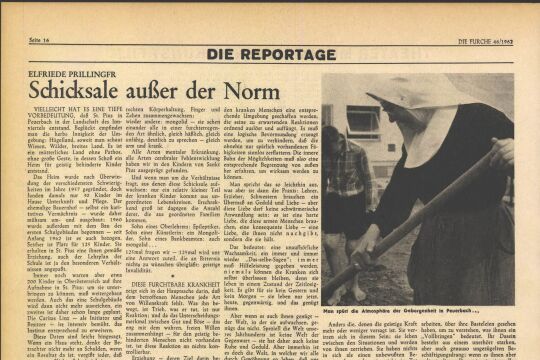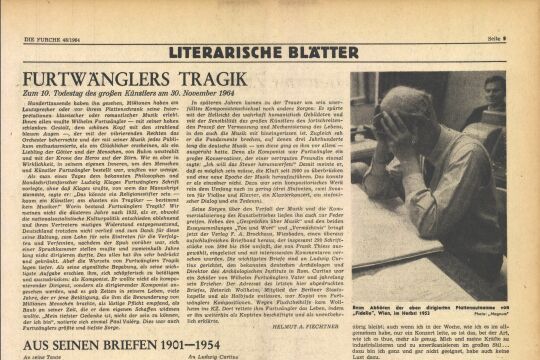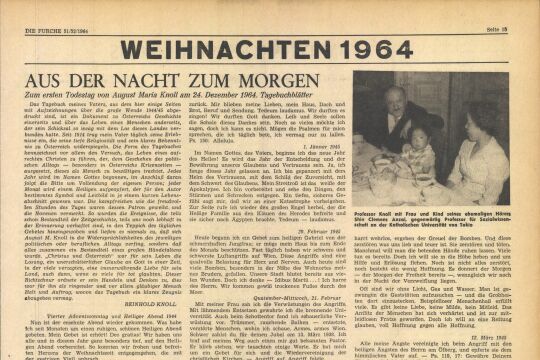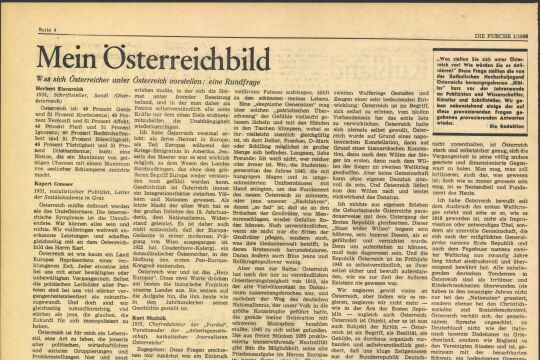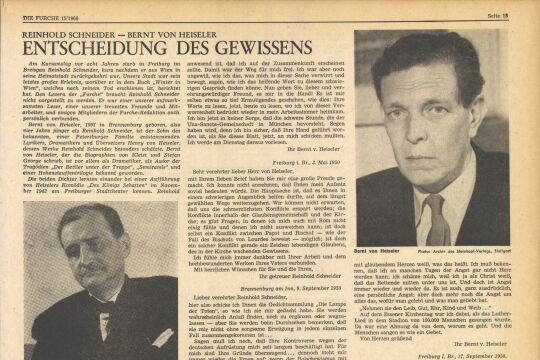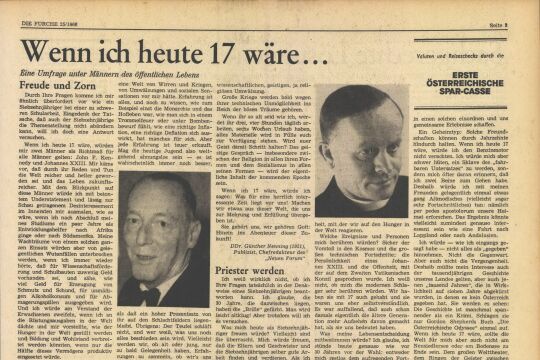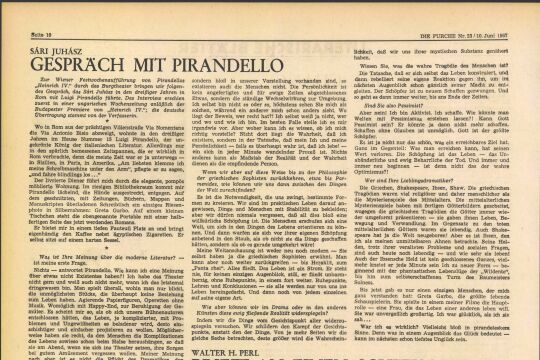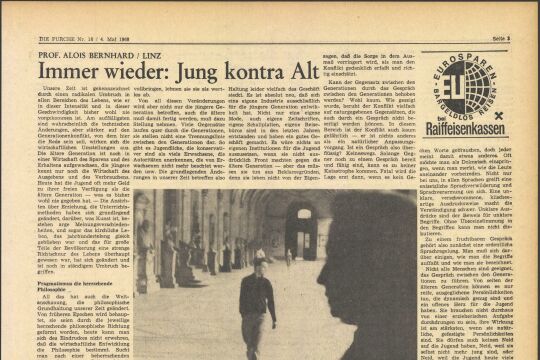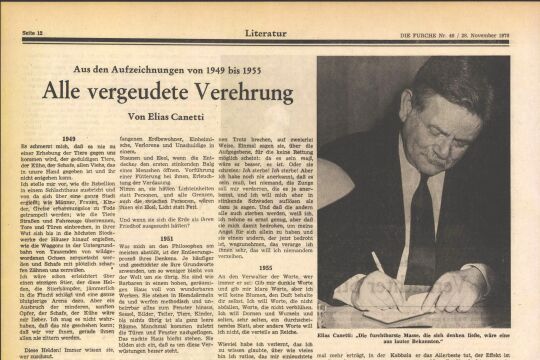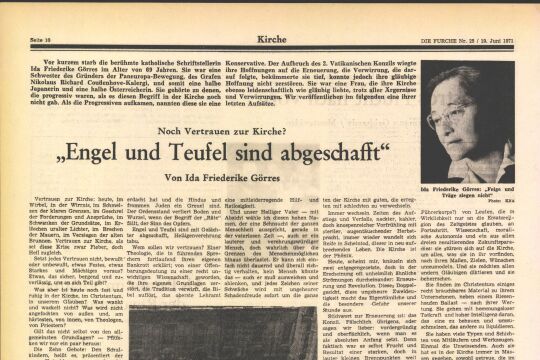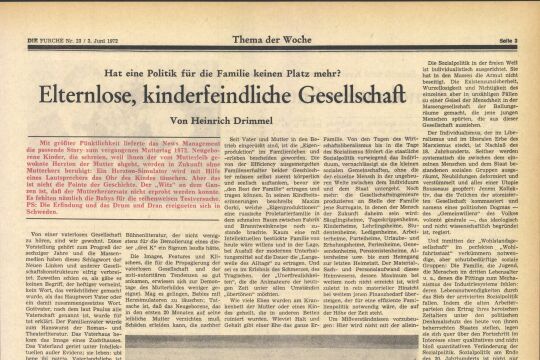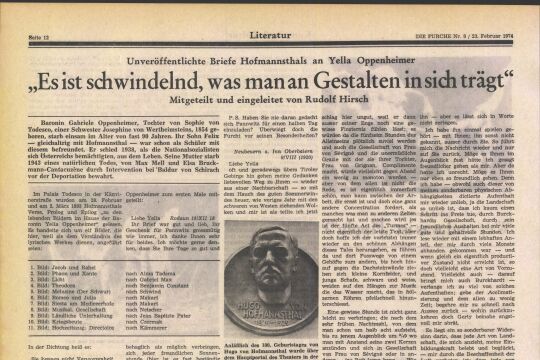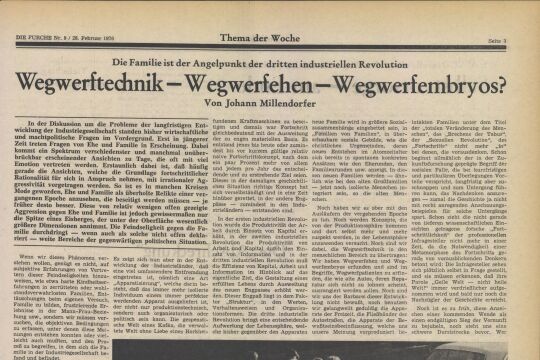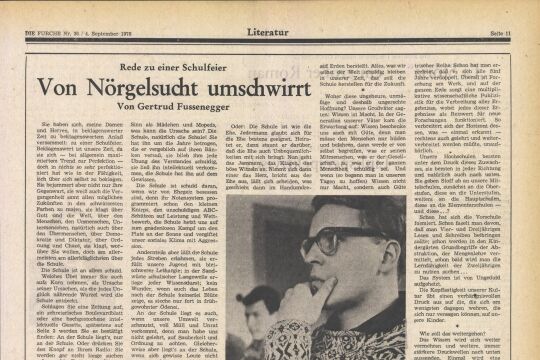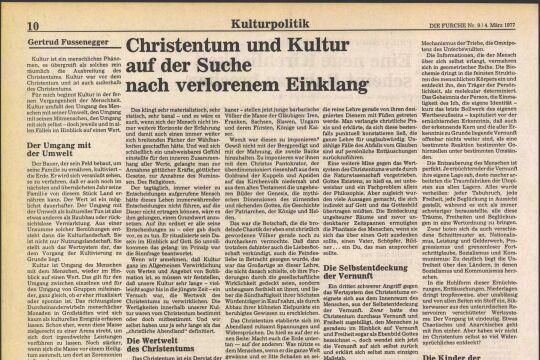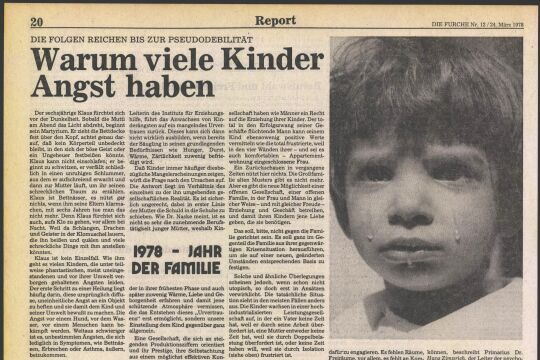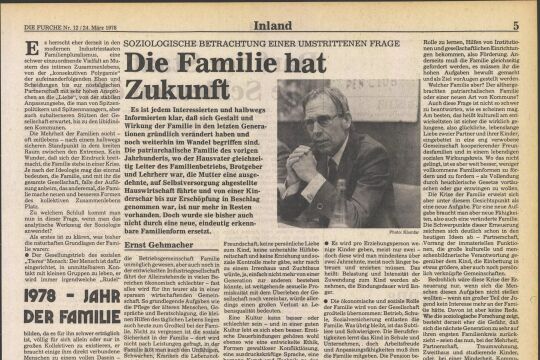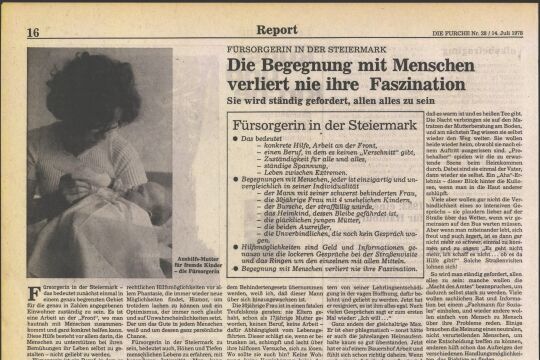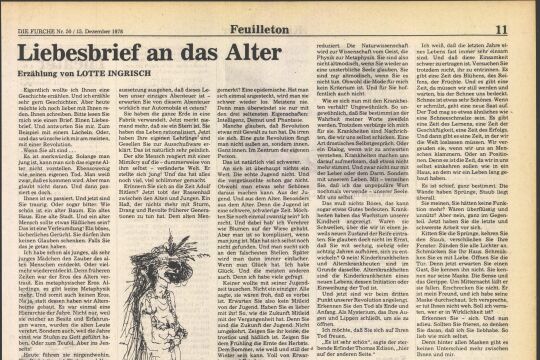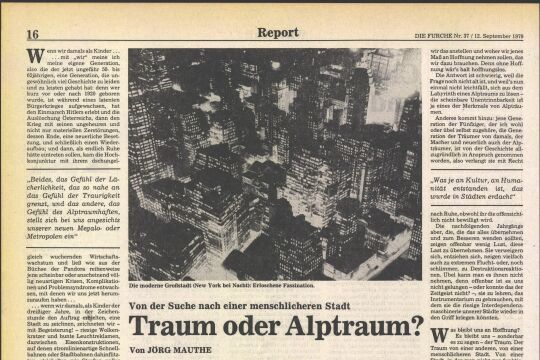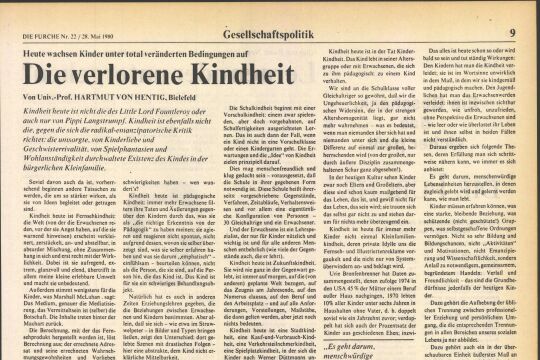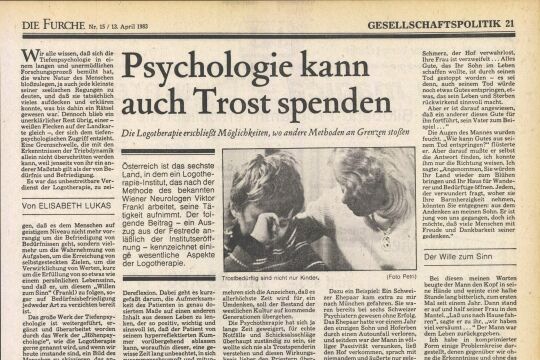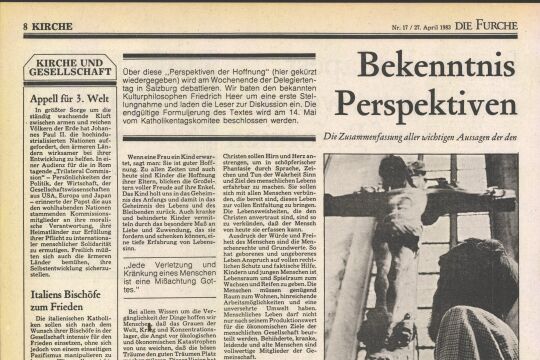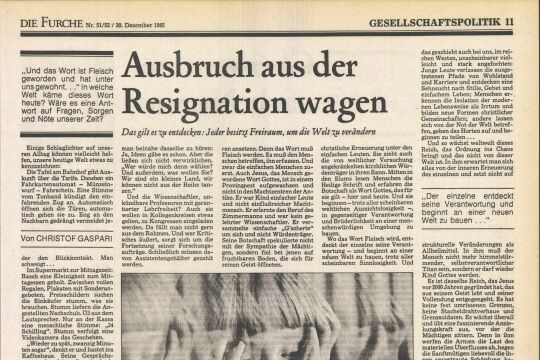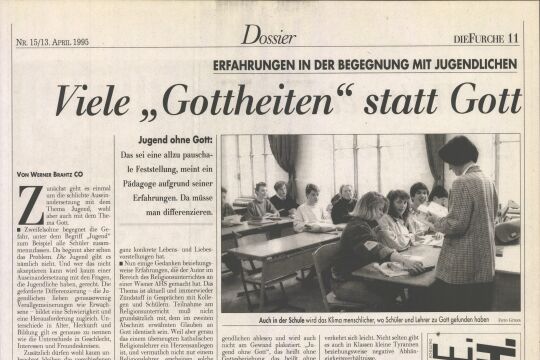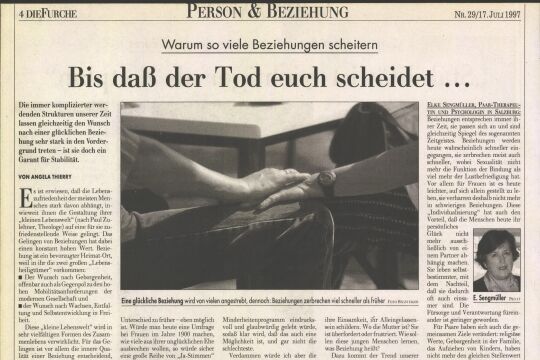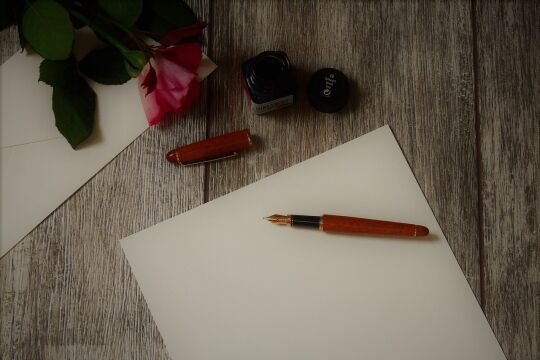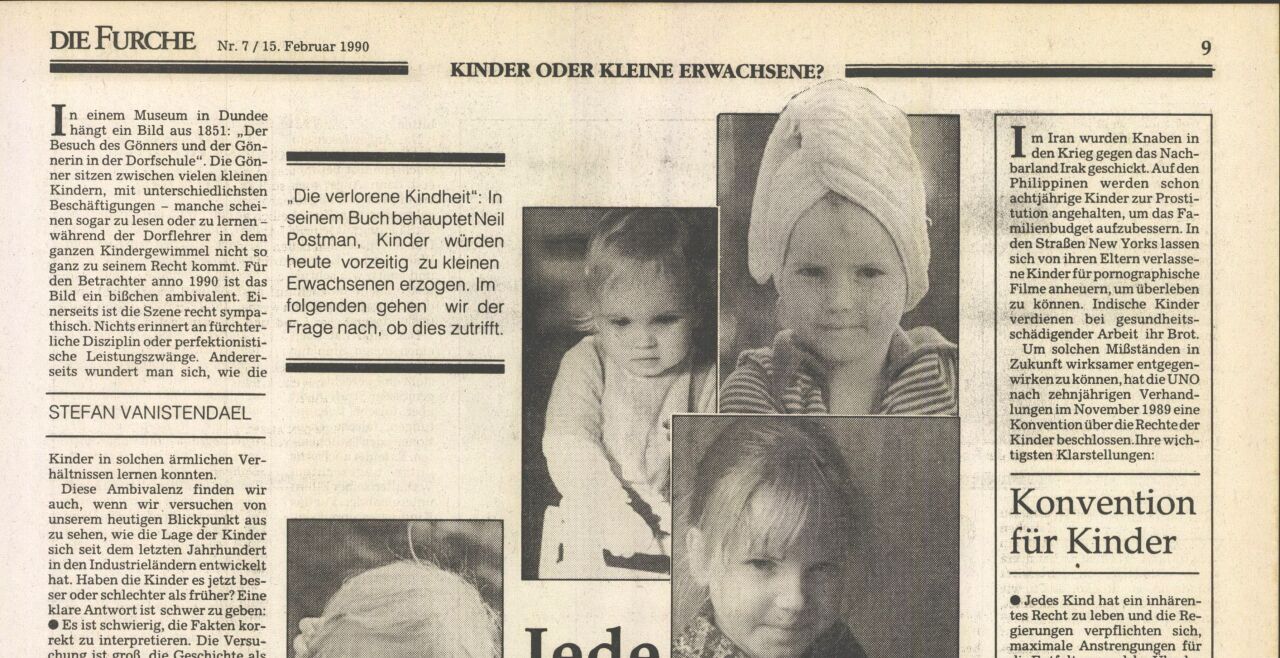
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Jede Zeit hat ihre Sorgen
„Die verlorene Kindheit": In seinem Buch behauptet Neil Postman, Kinder würden heute vorzeitig zu kleinen Erwachsenen erzogen. Im folgenden gehen wir der Frage nach, ob dies zutrifft.
„Die verlorene Kindheit": In seinem Buch behauptet Neil Postman, Kinder würden heute vorzeitig zu kleinen Erwachsenen erzogen. Im folgenden gehen wir der Frage nach, ob dies zutrifft.
In einem Museum in Dundee hängt ein Bild aus 1851: „Der Besuch des Gönners und der Gönnerin in der Dorfschule". Die Gönner sitzen zwischen vielen kleinen Kindern, mit unterschiedlichsten Beschäftigungen - manche scheinen sogar zu lesen oder zu lernen -während der Dorflehrer in dem ganzen Kindergewimmel nicht so ganz zu seinem Recht kommt. Für den Betrachter anno 1990 ist das Bild ein bißchen ambivalent. Einerseits ist die Szene recht sympathisch. Nichts erinnert an fürchterliche Disziplin oder perfektionisti-sche Leistungszwänge. Andererseits wundert man sich, wie die Kinder in solchen ärmlichen Verhältnissen lernen konnten.
Diese Ambivalenz finden wir auch, wenn wir versuchen von unserem heutigen Blickpunkt aus zu sehen, wie die Lage der Kinder sich seit dem letzten Jahrhundert in den Industrieländern entwickelt hat. Haben die Kinder es jetzt besser oder schlechter als früher? Eine klare Antwort ist schwer zu geben:
• Es ist schwierig, die Fakten korrekt zu interpretieren. Die Versuchung ist groß, die Geschichte als Fortschritt zu betrachten, oder die Vergangenheit zu romantisieren.
• Unsere Beurteilungskriterien ändern sich ständig.
Was das bloße Überleben anbelangt, haben die Kinder in den letzten 100 Jahren in den Industrieländern große Fortschritte erzielt. Die Kindersterblichkeit der weißen Bevölkerung in den USA zum Beispiel war am Anfang unseres Jahrhunderts vergleichbar mit der heutigen in Zimbabwe oder Peru. Selbst 1930 war die Kindersterblichkeit von Dänemark, Frankreich, Belgien, Kanada und Deutschland noch vergleichbar mit jener in den erwähnten Entwicklungsländern.
Die Menschen hatten damals wahrscheinlich wohl auch ein anderes Verhältnis zum Tode als heute. Trotzdem dürfen wir das Leid der Kindersterblichkeit nicht unterschätzen. Es ist kein Zufall, daß so viele Kulturen die Maßnahmen zur Verringerung der Kindersterblichkeit so rasch aufnahmen. Die Gelassenheit der geprüften Eltern, die mehrere Kinder kurz nach der Geburt verlieren, darf keinesfalls mit Gleichgültigkeit verwechselt werden.
Außerdem kann hohe Kindersterblichkeit wohl als Zeichen für schwierige materielle Lebensumstände, mit denen Familien tagtäglich zu kämpfen hatten, gedeutet werden. Papst Johannes XXIII. hat als Kind diese Armut miterlebt. Im Haus seiner Eltern gab es kein fließendes Wasser und keinen richtigen Herd. Tagaus, tagein aß die Familie Polenta, den Maisbrei der Lombardei. Geld war nur für das Allernotwendigste da, für einige Kleider und Schuhe.
Der Unterricht des jungen Giovanni Roncalli wurde nach der Grundschule von einem Gönner bezahlt. Einige seiner Geschwister starben sehr jung. Obwohl der Papst sicher die Werte schätzte, die er im einfachen Landleben als Kind mitbekommen hatte, bemerkte er dennoch einmal witzig: „Es gibt drei Arten, auf die man sich zugrunde richten kann: Frauen, Spielen und Landwirtschaft. Mein Vater wählte die langweiligste der drei."
In der Stadt war es nicht viel leichter. Wir brauchen nicht nur an die schwere Arbeit zu denken, die manche Kinder schon in ganz jungen Jahren leisten mußten, zum Beispiel in den Bergwerken. Auch jetzt noch leben viele Menschen unter uns, Städter die frühzeitig die Schule verlassen mußten, um zum Lebensunterhalt ihrer Familie beizutragen.
Die materiellen Lebensumstände der Kinden haben sich in Europa in den letzten 100 Jahren wesentlich verbessert, vielleicht sogar viel mehr, als wir uns das jetzt vorstellen können. Es ist aber gerade auch dieser materielle Fortschritt, der in sich die Keime der neuen Probleme trägt - auch für die Kinder.
Bleiben wir bei den materiellen Zuständen: Da drängt sich zuerst die Frage der Umweltzerstörung auf. Wir lassen diesen Problemkreis hier außer Betracht, weil er so umfassend ist, daß er den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, und weil er vielleicht nicht so ganz neu ist: Die Luft, die ein Kind in London anno 1900 einatmete, war möglicherweise schmutziger als die Luft in London heute.
Der materielle Fortschritt und der technologische Umbruch, der ihn ermöglichte, haben aber auch das geistige und soziale Umfeld der Kinder tiefgreifend verändert. Hier seien zwei Folgen hervorgehoben:
1. Die Größenordnung der Umgebung des Kindes ist um ein Vielfaches angewachsen, besonders durch Reisen und die Medien.
2. Oft unbewußt bringt man den Kindern heute den Traum bei, das Paradies lasse sich auf Erden verwirklichen.
Die Welt zu entdecken, bedeutete früher für ein Kind oft, seine Straße zu entdecken, sein Dorf, sein Viertel. Es war eine kleine Welt, aber sie wurde gründlich entdeckt. Und es war die Welt, in der man im Alltag leben mußte. Die Schule konnte gegebenenfalls weitere Horizonte öffnen. Heute weiß ein Kind vielleicht früh, wer Michail Gorbatschow ist, ohne ihn zu kennen. Aber kennt es seinen Nachbarn?
Der Soziologe Pierre Delooz hat festgehalten, ein Kind könne Hunderte von Tötungs- und Liebesszenen im Fernsehen sehen, ohne zu wissen, was Tod und Liebe sind.
Unter dem Druck von Tausenden oberflächlichen Eindrücken drohen die Wurzeln des Kindes zu erstik-ken. Jeder Mensch braucht Wurzeln. Sie sind nicht unbedingt, was wir am meisten lieben, noch was wir am schönsten finden. Wurzeln: Das heißt die Umgebung, in der ich Mensch geworden bin, Leben in unmittelbarer Beziehung zu Menschen und zu Gegenständen, in
Ehrfurcht für das Unsagbare. Wir können unsere Wurzeln lieben oder hassen, aber verneinen sollen wir sie nie. Wir brauchen sie, wenn auch nur um uns - wie es ein Baum tut -im Wachstum immer weiter von ihnen zu entfernen.
Die Vergrößerung seines Informationshorizonts setzt ganz allgemein die Qualität der Beziehungen zwischen dem Kind und seiner Umgebung unter Druck. Kann ein Kind (ja sogar ein Erwachsener) zu immer mehr Gegenständen, zu immer mehr Personen, in oft sehr indirekten Verhältnissen noch tiefe Beziehungen haben? Saint-Exupe-ry hat es schön formuliert: „Die Zeit, die man seiner Rose schenkt, macht die Rose so wichtig."
Kinder im modernen Europa wachsen in einer Gesellschaft auf, die fast völlig der Verwirklichung der Illusion vom Paradies auf Erden ergeben ist: das neue Auto, die Traumwohnung, die Superferien, der ideale Partner, die Selbstverwirklichung. Alles soll immer perfekter werden. Aber wenn alles ohne Fehler, ohne Tadel sein soll, so wird schließlich das Leben selbst unmöglich. Die Verletzbarkeit soll verdrängt werden, und mit ihr die .bedingungslose Liebe, die tiefsten Beziehungen. Wenn die Erziehung einer solchen Perfektionismus-Logik folgt, so kann ein Kind unter krankmachenden Druck geraten.
Wie soll ein Kind reagieren, wenn es nach und nach entdeckt, daß der Traum vom Paradies eine Illusion ist? Wenn es mit unheilbarem Leiden, mit Schuld, mit Sinnlosigkeit konfrontiert wird? Wird es noch den tiefen und mysteriösen Glanz des wirklichen Lebens entdecken, wie ihn zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank zeigt?
Besonders gläubige Christen sollten sich gegen die Illusion des irdischen Paradieses wehren. Der Tod und die Auferstehung Christi zeigen eine ganz neue Dynamik: Der Körper eines Verprügelten in neues, ungeahntes, unfaßbares Leben transformiert. Die Wunden sind noch da, aber sie sind nicht mehr im Tode verloren. Diese Hoffnung soll auch die Erziehung der Kinder mitprägen.
Schließlich ist die Frage, ob Kinder heute besser leben als vor 100 Jahren vielleicht nicht so wichtig. Jede Generation kann von der Ver-gangenheit lernen. AberjedeGene-ration soll auch mit ihren eigenen Herausforderungen leben, und nicht mit denen der Vergangenheit.
Der Autor ist stellvertretender Generalsekretär des International Catholic Child Bureau in Genf.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!