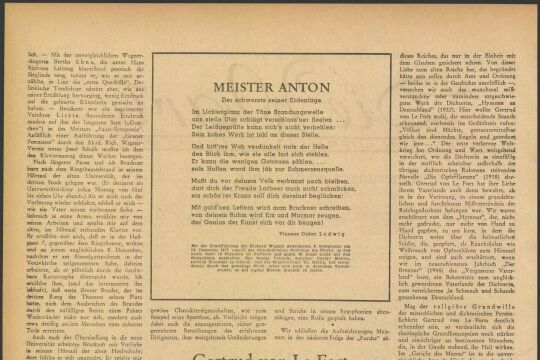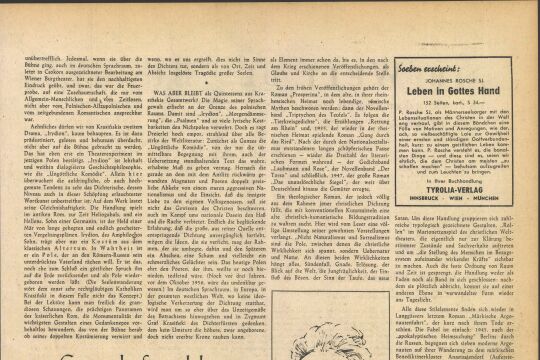Gelöschte Kerzen, zwei Erzählungen, Ehrenwirth-Verlag, München.
Die Sprache le Forts hat immer ihre eigene Form, eine Form, die ihr vom behandelten Stoff geprägt wird. Den an alte Urkunden erinnernden Stil des „Papstes aus dem Ghetto“, das leicht altertümelnde Deutsch der „Magdeburgischen Hochzeit“, die geschliffene — heute leider vergessene — Kultur des Briefschreibens in der „Letzten am Schafott“ oder den hohen poetischen Schwung des „Ichweißtuches der Veronika“. In den beiden Novellen der „Gelöschten Kerzen“ überrascht die Dichterin ihre Leser mit dem leichten Gesellschaftston unserer Zeit, in dem sich der Gebildete, ohne banal zu werden, seine Geschichten erzählt, mit Wendungen zu feinem Humor oder zu verhaltenem Ernst, bis zur Eindringlichkeit der in Erschütterung bebenden Stimme, wo das Thema es verlangt. Ansätze dazu waren bereits im „Kranz der Engel“ gegeben, die die strenge Feierlichkeit der Diktion auflockerten. Hier plaudert die Dichterin stellenweise in unbeschwerter Prosa, den Kennern und Verehrern eine ganz neue Seite ihrer Dichtung offenbarend.
Die erste der beiden Novellen „Die Verfemte“ erzählt von Anna Elisabeth, der Gutsherrin von Golzow im Brandenburgischen, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Ein junger schwedischer flüchtiger Kornett ruft ihre Hilfe an, die sie selbst ein Kind unter dem Herzen trug, und deren Gatte von den Schweden erschlagen war. Mit dem Ruf „Ihr seid eine Mutter!“ hatte er sich zu ihr gerettet. Das Geheimnis ihrer Mutterschaft — das le Fort im „Gericht des Meeres“ folgendermaßen formulierte: eine Frau kann sich doch nicht zum Werkzeug des Todes hergeben — eine Frau ist doch dazu da, um das Leben zu schenken! — dieses Geheimnis der Mutterschaft rettet dem jungen Schweden das Leben. Die Gutsherrin selbst entführt ihn durch das unsichere Moor auf einem nur Einheimischen bekannten Steg den Verfolgern. Auf eigenartige Weise hatte sich das Leben ihres eigenen Kindes mit dem des Schweden, ja mit dem Leben jedes Kindes in ihrer Mutterschaft verknüpft. „Was das Vaterland von ihr verlangte“, erfüllte sie in einem andern Sinn, in einem tieferen, als daß ihn die Tagesmeinung verstanden hätte, welche sie verurteilte und ihr Bild aus der Ahnenreihe tilgte. Doch „sie wußte, sie trug ihr gerettetes Kind heim, aber nicht nur dieses, sondern so, als wachse dieses kleine Kind unter ihrem Herzen und begehre immer mehr von dessen Raum, so viel Raum, als sollten alle Menschen darin Platz finden“. Wie St. Christopherus war sie, der das Jesuskind trug, das allen Menschenkindern das Leben schenkte. Eine spätere Zeit, ihre Nachkommen in der Gegenwart, die von ihrem Gut vertrieben wurden, aber auf der Flucht ihre Kinder gerettet hatten, verstanden sie besser: mit dem Mütterlichen fängt die echte Menschlichkeit an und „oh, wie grausig ist die Weltgeschichte, die sie immer wieder verrät“, aber sie ist trotzdem ..das einzige, das über die Furchtbarkeit der Weltgeschichte triumphieren kann, und darum hat Anna Elisabeths ausgelöschtes Antlitz zuletzt doch alle unsere Untergänge überdauert“.
Die zweite Novelle ,J)ie Unschuldige“1 ist „dem Andenken der toten Kinder des Weltkrieges“ gewidmet, ähnlich dem „Gericht des Meeres“. „Es gibt nichts Ruchloseres auf Erden, als ein Kind zu ermorden“, heißt es dort. Aber das ist diese „wirkliche“ Welt, schreibt die „Tochter Farinatas“, in der man unschuldige Kinder steinigte, „wo man alles Lebendige ungestraft zertreten durfte, das holdeste Blütenbäumchen und das lieblichste Kind, sobald es einer grausam-bösen Macht gefiel“; eine Zeit der „gelöschten Kerzen“.
Die Gegenwart gab einige grausige Beispiele dafür ab, unter ihnen die Geschichte des französischen Dorfes Oradour, an der der „Onkel Eberhard“ der Novelle beteiligt war. In ihrer diskreten, zurückhaltenden, aber nicht weniger deutlichen Art, die oft wirksamer ist als gemeines Schimpfen, charakterisiert le Fort diesen Menschen damit, daß ■ der kleine Heini, die Hauptperson der Novelle, den Hund Barry um Verzeihung bat, als er das Lachen seines Onkels mit dem Lachen des Hundes verglichen hatte. Homo homini lupus, das ist das Ergebnis jenes abendländischen Menschen, der sich stets rühmte, auf den Humanismus getauft zu sein. „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“, sagte Goethe, heute meint Gottfried Benn weniger diskret „die Krone der Schöpfung — der Mensch, das Schwein“. — In seinen Tagebuchaufzeichnungen zeigt der fast vierzehnjährige, durch die Bombennächte frühreife Bub das Verhalten der Menschen zu diesen Dingen: die einen — in seiner Großmutter charakterisiert — wollen nichts von alldem gesehen haben, treiben Vogel-Strauß-Politik und flüchten sich in den „Trostmarkt“ ihrer Religion, die andern — seine Mutter — verlieren den Glauben. Da greift der Bub, ein halbes Kind noch, mit seiner Ohnmacht ein und wird zur rettenden Macht; jedoch ohne Kurzschlußlösung, wie sie auf den ersten Blick vielleicht scheinen mag. Der Onkel bekehrt sich zwar nicht, läßt aber ab von der Mutter und geht in die Fremdenlegion. Der Mutter bleibt die Katastrophe nicht erspart: ihr Kind stirbt. Das Kind selbst sieht sich im Tod mit allen unschuldig gemordeten Kindern vereint und erlebt im eigenen Tod die Verklärung des Todes, es hatte wie sein Vater nicht den Tod, sondern Gott gefürchtet, und zwar einen menschgewordenen Gott, der selbst ein unschuldig leidendes Kind geworden war, wie der
Anruf „Maria, nimm mein Kind in deine Arme“
zeigt.
Der Satz aus dem „Gericht des Meeres“ steht unsichtbar über beiden Erzählungen: „Es war als sei Gott hinfort Mensch geworden“. Wahre Menschlichkeit begibt sich nur von jener Menschwerdung her und in allen, die sich ihr vereinen, nach außen scheinbar verspielend, eigentlich aber die wahren Sieger. Wie die Kirche in ihrer Märtyrerliturgie sagt: visi sunt oculis insipientium mori, illi autem sunt in pace.
In der ihr eigentümlichen Kühnheit stellt Gertrud von le Fort in ihrem neuen Werk „Am Tor des Himmels“ (Insel-Verlag, Wiesbaden, 87 Seiten) die dramatische Begegnung von Glaube und Wissenschaft auf zwei Gipfeln der Geschichte dar. Wie in ihrem letzten Werk „Gelöschte Kerzen“ verläuft das Geschehen, Vergangenheit und Gegenwart sinnvoll miteinander verflechtend, auf zwei Ebenen und bringt so von vornherein das immerwährende Anliegen dieser zutiefst geschichtlich denkenden Dichterin vor Augen: den Aufweis der Einheit der Geschichte in ihrer Kontinuität stiftenden Kraft. — Dem großen Umbruch der Zeiten im 17. Jahrhundert durch das neue Weltbild Galileis und dessen Verurteilung durch die Kirche, dem Auseinanderklaffen von Glaube und Wissenschaft, steht gegenüber das 20. Jahrhundert mit seinem neuen Weltbild und dem erwachenden Zueinander von Kirche und Naturwissenschaft, und die große klagende Frage an die Kirche, die in dieser Novelle laut wird: „Sollte man die Geschicke des Glaubens nicht einfach Gott anheimgeben? Müßte die Kirche nicht gerade ihren Feind ans Herz ziehen?“ bildet gleichsam die Brücke zwischen diesen und gehört zum Kern dieses Buches, das iiebend zeigen will, daß das Anathema der Kirche des 17. Jahrhunderts ein durch die Geschichte verhängtes tragisches und der Abfall der dem neuen Weltbild Galileis Anhangenden ein ungewollter waren.
Die Erzählung beginnt mit der Schilderung des Bergungsversuchs von wichtigen Familiendokumenten während des zweiten Weltkriegs. Unter ihnen befindet sich das sogenannte „galileische Dokument“, das ein junger Naturwissenschaftler vorliest, das aber den Flammen eines am Ende der Lektüre einsetzenden Bombenangriffs zum Opfer fällt und nun aus dem Gedächtnis nacherzählt wird. Der nie genannte Held dieses Dokuments ist Galilei. Am „Tor des Himmels“, am Teleskop seines Observatoriums, erkennen seine liebsten Schüler, das Mädchen Diana und der Verfasser des Dokuments, voll Schrecken, daß in der Unermeßlichkeit da droben kein Platz mehr ist für den Gott unseres Glaubens, „denn unmöglich kann Gottes Sohn für die Geschöpfe unseres winzigen Sterns herabsteigen“. Sie erkennen, „daß wir keinen Gott mehr haben, der sich um uns kümmert, sondern nur noch die ewigen Gesetze und uns selbst.“ Der Meister ist bereits nach Rom vor das Inquisitionsgericht zitiert, und Diana, die durch das neue Weltbild den Glauben verloren hat, zweifelt nicht an seiner Verurteilung, trotzdem ihr Onkel, der Kardinal, selber ein Anhänger der neuen Wissenschaft ist. Die Schule des Meisters wird auf Befehl Roms aufgelöst, aber dem jungen Verfasser des Dokuments, der Diana liebt, gelingt es, ihr nach Rom zu folgen und im Palast des Kardinals glühend zu bezeugen, daß man „das neue Weltbild bejahen und doch der Kirche treu sein kann“, ja „daß durch das neu erschlossene
Hiinmelsbild der Schöpfergott sich nur um so herrlicher offenbare“. Er ahnt nicht, daß seine Zuhörer Mitglieder der Inquisition sind. Diana aber, die den Meister liebt, trägt durch das Bekenntnis ihres Abfalls vom Glauben an den Vatergott zu seinem Untergang bei. Entsetzt erkennt der Kardinal, daß „der Mensch dem neuen Weltbild nicht gewachsen ist, trotzdem es den wahrhaft Gläubigen nicht schaden kann“, und so erblickt er in dem „an sich unantastbaren Meister“ „ein Gefäß gefährlicher Verführung“. Während eines grandiosen Gesprächs mit des Meisters Schüler, das eine Mondnacht geheimnisvoll durchleuchtet, schaut er in einer Vision den „Menschen der Zukunft“, der den Untergang der Welt heraufbeschwört und endgültig ringt der um den Glauben und das Seelenheil der Christenheit besorgte Hirt und Priester den Menschen in sich nieder, der die neue Wahrheit doch ebenfalls erkannt hat und der den Meister liebt. Noch einmal versucht der Schüler, den Kardinal umzustimmen. Er erinnert ihn an den auf dem Meere wandelnden, die Hand Christi ergreifenden Petrus und schlägt ihm vor, die erkannte neue Wahrheit nicht zu verleugnen und zu verstoßen, „die Geschicke des Glaubens einfach Gott anheimzugeben“ und dadurch „den Sieg des Glaubens und der neuen Wahrheit zu gewährleisten“ — vergeblich: die letzte entscheidende Frage, ob er denn meine, „daß der Glaube durch eine Unwahrheit gerettet werden könne“, wird vom Kardinal nicht mehr beantwortet. In der letzten Sitzung des Inquisitionsgerichts spricht der Kardinal das Anathema. Doch diese „Lüge“ der Kirche fordert die „Lüge der Wissenschaft“ heraus. Es geschieht der „zweideutigste aller Widerrufe“, der, „um der glorreichen Wahrheit die Zuknuft zu sichern“, „den kirchentreuen Menschen im Meister vernichtet“ und der die Wissenschaft nunmehr zu „glorreicher Vermessenheit“ befreit. Der Tragödie der die Wahrheit begrabenden Kirche antwortet die Tragödie der den Glauben begrabenden Wissenschaft. „Zwei Geistesräume, die einander offen standen, beben für immer auseinander, auch im Innern des Menschen.“ Der neue Mensch, der Mensch des Abfalls, wird geboren, der „bindungslos nur noch die Gesetze der freien Forschung anerkennt, ohne jenseitigen Rückhalt“. — Und die Folgen? Der zweite Weltkrieg mit seinen Bomben und chemischen Vernichtungsmitteln gibt die Antwort. Aber auch in dem jungen modernen Naturwissenschaftler, dem zeitgenössischen Pendant des Schülers des verurteilten Meisters, wird die Antwort der Geschichte offenbar: der autonome Geist der Wissenschaft erkennt sich als an die äußersten Grenzen und damit in eine neue, größere Offenheit zu Gott gekommener, er akzeptiert gleichsam das „Fehlurteil“ der Kirche de Renaissance: „Hiroshima wird bald überholt sein — die Vision des Kardinals war richtig, er wollte diese Entwicklung aufhalten“, sagt der junge Naturwissenschaftler. Darum bleibt das Wort des großen Kardinals, der die Situation des Zeitenumbruchs nicht anders als mit einer tragischen Unwahrhaftigkeit zu meistern wußte, wahr: „Die Kirche liebt, auch wenn sie richtet, aber dir steht es nicht zu, sie zu richten“.
Es ist unmöglich, die ganze Fülle dessen, was sich in dieser Meisternovelle wie in einem Konzentrat versammelt, auch nur anzudeuten. Man wird mitgerissen von dem Schwung dieses Bogens zwischen den Zeiten, deren Schuppen einem von den Augen fallen. Nur auf etwas am Rande sich Abspielendes sei noch hingewiesen: Nicht nur die Kluft zwischen den Zeitaltern, auch die zwischen den Generationen innerhalb der gleichen Epoche wird dargestellt. Aber da sie gebildet ist aus Hintertreffen und Vorsprüngen auf beiden Seiten, erweist sie sich als eine nur scheinbare, wenn die wechselseitige Forderung erkannt und erfüllt wird. Dann wird sie nämlich zur Brücke in die neue Zeit und zur Gestalt. Die so hergestellte Brücke zwischen den Alten und Jungen unserer heutigen Zeit ist die Gewährleistung dessen, was Tradition heißt. In ihr reichen die scheinbar abtretenden Geschlechter den kommenden die Hand, denn die Generationen haben einander etwas zu geben, sie sind aufeinander angewiesen, sie leben voneinander. In diesem echt geschichtlichen Sinn lebendiger Tradition sind die „great old persons“ die wahrhaft Jungen. Zu ihnen gehört Gertrud von le Fort. Dr. Annie Kraus