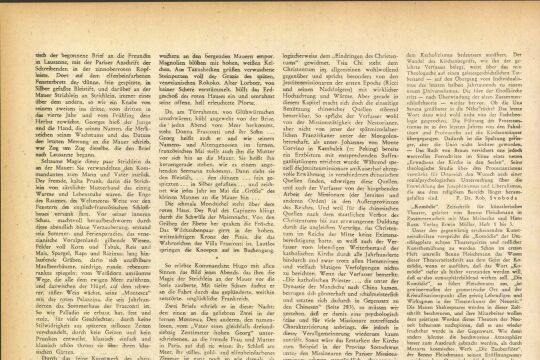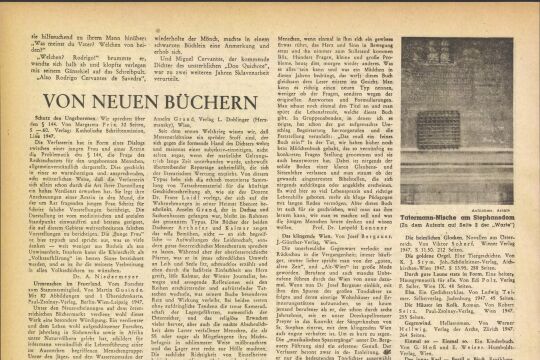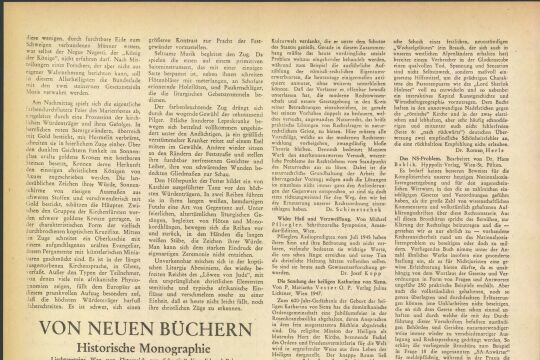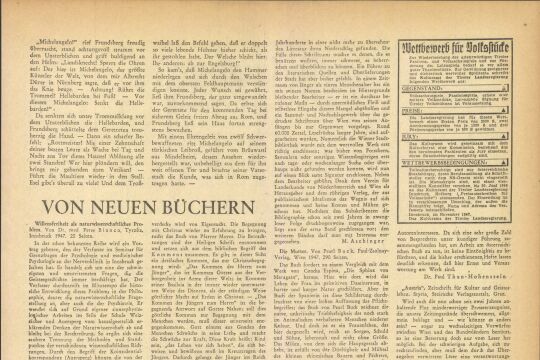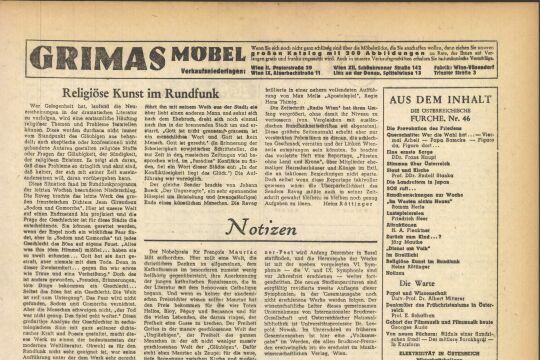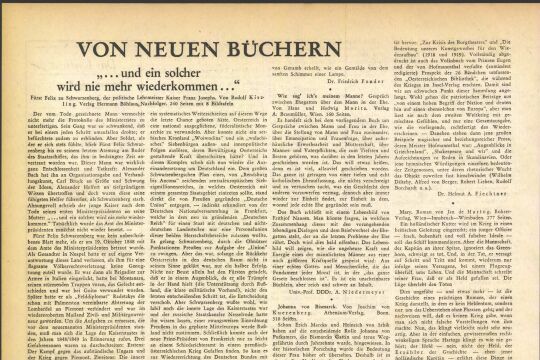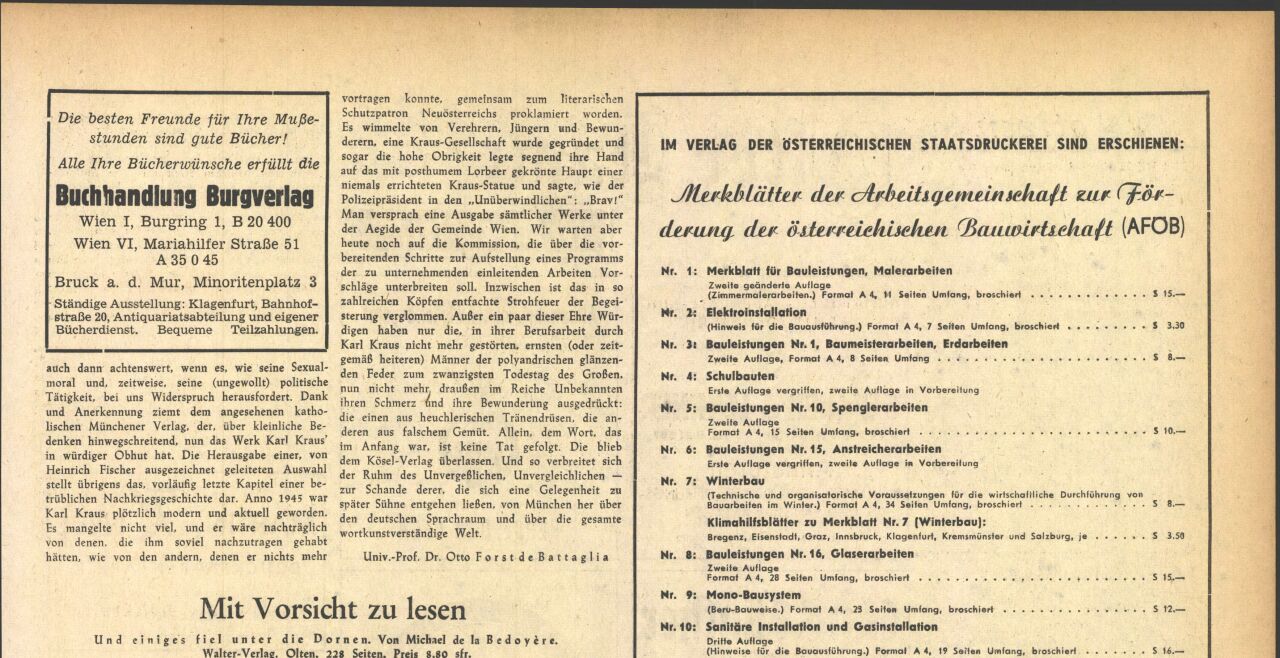
Der Herausgeber der Londoner Tageszeitung „The Catholic Herald“ ließ sein Buch „Living Christia-nity“ unter obigem Titel in einer guten Ueber-setzung den deutschen Lesern zugänglich machen. Der deutsche Titel läßt den reichen Inhalt des Buches nicht ahnen. Gleich unzulänglich ist der deutsche Untertitel: „Aufzeichnungen eines schlichten Christen über die Kirche in der Zeit.“ Der Verfasser will „ein rein persönlich gehaltenes Buch“, also ein Bekenntnisbuch, vorlegen. Darin liegt sein Reiz. Indem aber der Autor sich zum Typ von vielen macht, wird es ein Reformbuch. Darin liegt seine Gefahr. Es setzt geistig etwas gereiftere Leser voraus. Diese müssen beachten, daß England eine katholische Minderheit hat und das Geburtsland des Puritanismus ist. Der Mitteleuropäer wird trotz mancher Wenn und Aber auf jeder Seite die lautere Absicht des Verfassers spüren. Er verfolgt ein großes Ziel, dem zuliebe er sich auch einige Risiken erlauben kann. Er geht dem Wesen der christlichen Religion nach. Er sieht es in der persönlich erlebten bedingungslosen Hingabe an Gott in der sakramental-gnadenhaften Vereinigung mit dem menschgeworde-rien Gottessohn. Von dieser christozentrischen Haltung aus hofft er eine den ganzen Menschen befriedigende Harmonie zwischen Glauben und Leben zu sichern. Damit hofft er auch im innerkirchlichen Bereich Dogma, Sittlichkeit, katholisches Brauchtum Und katholische Frömmigkeit auf ein einheitliches großes Ziel hinzuordnen und in der außerkirchlichen Umwelt werbend und erobernd zu wirken. Bei diesem ehrlichen Bestreben kommt er in einem Punkt des sittlichen Lebens, der einer der wundesten de 20. Jahrhunderts ist, leider zu einer förmlichen Kapitulation des Christen vor dem Dämon, nämlich im Sexualproblem. Er gesteht, daß er bis zu seinem zehnten Lebensjahre von „vielen Skrupeln geplagt“ war, daß er in diesem Punkte seine Erziehung im Pubertätsalter „in Bausch und Bogen verdammen“ könne und darum zweifle, ob er die richtige Person sei, „diese Sache gerecht und mit dem Mitsprechenden Verständnis darzustellen“. Gleichwohl sagt er auf diesem Gebiet viel Beherzigenswertes. Doch scheint das seelische Pendel noch immer nicht die Ruhe der goldenen Mitte gefunden zu haben. So wird, es einigermaßen verständlich, daß er zu schreiben wagt: „Die Kirche kann natürlich weder eine Ehescheidung anerkennen noch Ehebruch, Unzucht und Mißbrauch des Geschlechtstriebes billigen; doch sind die eben erwähnten häufigen Sünden in so weitem Maße auf die unwiderstehliche Triebkraft der sinnlichen Natur des Menschen zurückzuführen, daß das Vorhandensein aller zum Zustandekommen einer schweren Sünde erforderlichen Bedingungen und damit die Anrechenbarkeit von Seiten Gottes unwahrscheinlich ist“ (S. 198 f). Man könnte über den Satz hinweggehen, wenn das Wörtchen „oft“ oder „sehr oft“ eingefügt wäre. Doch in seiner allgemein gehaltenen Fassung ist er unhaltbar, muß verwirren und kann verheerend wirken. Er ist ein Angriff auf das menschliche Gewissen, das bei gesunden Menschen immer als letzte Norm für die
Anrechenbarkeit von sittlichen Verirrungen zu gelten hat. Er ist ein Eingriff in die alleinige Kompetenz Gottes, über das subjektive Verdienst und Mißverdienst des Menschen zu richten. Den folgenden Satz, der für die Lösung des Sexualproblems die entscheidende Bedeutung der Gnade betont, dürften manche als kleine Abschwächung empfinden, tatsächlich drückt er einen Widerspruch aus. Man erinnert sich da an das Konzil von Trient, das gegen Luther erklärte: „Gott verlangt nicht Unmögliches, sondern indem Er befiehlt, mahnt Er, sowohl zu tun, was du kannst, als auch zu erbitten, was du nicht kannst, dann hilft Er, daß du es kannst“ (Denz. 804). Bedoyere hat (vielleicht neben der Beeinflussung durch die Psychoanalyse, die immer kranke Menschen vor Augen Jiat, deren Haltlosigkeit sicher sehr milde zu beurteilen ist) wohl zu sehr nach der Einzeltat und zuwenig nach der Gesamthaltung des Menschen geurteilt. Nach seiner Meinung wären also alle die genannten Sünden mit moralischer Gewißheit — diese ist der Gegensatz von UnWahrscheinlichkeit — keine Todsünden. Damit wäre eigentlich der wesentliche Unterschied aufgehoben zwischen Jugendlichen, die gutwillig ringen, aber zuweilen versagen, und solchen, die böswillig auch in der Stunde der Entspannung nach der Möglichkeit neuen Lustgewinnes Ausschau halten; zwischen Jungmännern und Mädchen, die ehrlich sich bemühen, keusch zu lebt.i, aber in einer unvorhergesehenen Situation fortgerissen werden, und solchen, die ohne jeden Reinheitswillen verführen und sich verführen lassen; zwischen Eheleuten, die in nicht mehr alltäglichen Lagen und Gefahren entgleisen, und jenen, die jeden Willen, sich der von Gott gesetzten Ordnung zu beugen, bewußt, ständig und hemmungslos ausschalten. Wenn wir so weit sind, können wir der katholischen Kirche ruhig raten, das Wort Jungfräulichkeit nicht mehr zu gebrauchen, sondern sich auf den Harem umzustellen. Den oben erwähnten wesentlichen Unterschied nicht mehr anerkennen, hieße nicht viel weniger, als das sechste und neunte Gebot aus dem Dekalog streichen. Wenn eines fällt, welches hat dann noch Bestand? Dann ist es sinnlos geworden, noch das Wort des Herrn zu zitieren: „Meinet nicht. Ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzuheben; Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen“ (Mt 5, 17).
Pius F a n k ean. reg„ Stift Vorau
Die Akkomodationsmethode des P. Matteo Ricci SJ. in China. Von Johannes B e 11 r a y SVD. Analecta Gregoriana, vol. LXXVI, Rom. 411 Seiten.
Hinter der nüchtern, fast dürren Aufmachung dieser streng wissenschaftlichen Serie entdeckt man, besonders in diesem Fall, ein sehr lebendiges, gut geschriebenes Buch, das ein lesselndes Lebensbild jenes Mannes entwirft, der die Akkomodationsmethode in der Missionierung Chinas theoretisch begründete und praktisch durchführte. Den ersten Schritt bildete die äußere Akkomodation in Kleidung, chinesischer Namensgebung, Anpassung an die chinesische Höflichkeit und Gewinnung der Sympathie durch passende Geschenke. Während Ricci in der sprachlichen Akkomodation Erstaunliches erreicht hat, ist er auf dem Gebiet der ästhetischen Anpassung in der Gestaltung christlicher Kulträume sowie einer christlich-chinesischen Malerei eher zögernd vorgegangen. In der sozialrechtlichen Akkomodation kommen die Beziehungen der ersten Jesuiten zum Kaiserhof, ihre Stellung zur Polygamie, Ehe und Sklaverei zur Sprache. Lesenswert sind noch immer Riccis Aufzeichnungen über den chinesischen Volkscharakter. Die intellektuelle Akkomodation umfaßte unter anderem das Apostolat der Presse und auch schon die Bildung eines einheimischen Klerus. Im letzten Abschnitt behandelt der Verfasser die religiöse Akkomodation, besonders Riccis Stellungnahme zum Konfuzianismus, Buddhismus und Taoismus, wobei er — natürlich innerhalb des christlichen Dogmas — eine erstaunliche Großzügigkeit zeigte. Nach Ansicht des Verfassers hat man in der Folge den großen Geist und die weitgehende Missionsmethode Riccis nicht mehr zu würdigen gewußt.
DDr Nico Greitemann
Josef Kriehuber und die Wiener Gesellschaft seiner Zeit. Von Wolfgang von Wurzbach. (I. Band: Katalog der Porträtlithographien Josef Kriehubers.) Verlag Walter Krieg, Wien. XV und 440 Seiten.
Der erste Teil dieses vierbändigen Werkes enthält eine durch zahlreiche neue Daten bedeutend erweiterte Fassung des 1902 erschienenen, längst vergriffenen Oeuvrekatalogs des produktivsten Wiener Aquarell- und Lithographieporträtisten aus der Feder des bekannten Romanisten und Kunsthistorikers Universitätsprofessor Dr. Wolfgang von Wurzbach. Eine wesentliche Bereicherung dieses für alle graphischen Sammlungen und Bibliotheken unentbehrlichen Behelfs bedeutet die Beschreibung des wechselvollen Schicksals des von seinen Zeitgenossen gesuchten Porträtisten des Kaiserhauses, zahlreicher Persönlichkeiten aus allen Kreisen und auch vorübergehend in Wien lebender Ausländer, der, wie die anderen Meister seines Genres, durch das Aufkommen der Photographie aus seiner dominierenden Stellung verdrängt, seinen Lebensabend in dürftigsten Verhältnissen zu verbringen gezwungen war.
Jean de Boargoing
Kreuze in Kardien. Roman. Von Väinö L i n n a. Deutsch von Karl Heinz Bolay und Rolf Schroers. Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln-Berlin. 47 Seiten.
Ein 'riegsbuch. Eines von vielen — und dennoch herauszuheben aus den in den letzten Jahren recht zahlreichen Veröffentlichungen desselben Genres. Herauszuheben aus mehr als einem Grund. Da ist zunächst einmal die finnische Nationalität des Verfassers, der Blickwinkel des finnischen Soldaten, aus dem der vergangene Krieg gesehen wird. Und das war doch ein ganz anderer als der eines Soldaten der deutschen Wehrmacht im Hitler-Krieg. Der kaum von weltanschaulichen und politischen Schatten belattet Weltkrieg 1914/1918 könnte als Vergleich schon eher dienen. Auch der Sturm, den Linnas Buch in der Heimat des Verfassers erregt hat, gleicht am ehesten den Wellen, die seinerzeit Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ geschlagen hat. Von rechts und links prasselten auf Väinö Linna die Vorwürfe ein. „Verunglimpflichung der Armee“ und „falscher Heroenkult“ sind einige von den oft einander widersprechenden Kritiken.
Und doch hat Linna, wie man annehmen darf, nichts anderes getan als dem finnischen Soldaten und auch der finnischen Armee ein Denkmal gesetzt. Ein Denkmal, das freilich frei ist von jeder falschen Heldenpose, ein Buch, in dem neben der unbeschönigten Darstellung des Krieges und den oft gar nicht gerade patriotischen Reden der Männer doch die Liebe zu seinem Land verzeichnet ist. Selbst in Sätzen wie den folgenden steckt — vielleicht uneingestanden und sogar widerwillig — mehr Stolz auf die eigene Art eines kleinen Volkes, einer in den Strudel der Weltgeschichte hineingerissenen Armee, als man meinen könnte:
„Diese Armee war in ihrer Eigenart unnachahmlich. Andere Armeen in der Welt hätten ihr vielleicht geglichen bei Flucht und Niederlage, nicht aber auf dem Vormarsch. Die finnische Armee blieb sich gleich, ob auf dem Vormarsch, ob auf dem Rückzug. Ein formloser Klumpen war sie, der sich zäh dahinwälzte. Allmorgendlich beim Aufbruch wurden die einzelnen Kompanien in Marschordnung aufgebaut, die sich nach kaum einer Stunde in kleine Klüngel aufgelöst hatte. Die tippelten auf eigene Faust vorwärts und pfiffen auf alles und jeden, was und wer immer das sein mochte. Die Gewehre hingen oder baumelten herum, wie es gerade kam. Einer trottete barfuß am Straßenrand durch das Gras, die Schuhe über der Schulter ... Ein anderer genoß ein Sonnenbad während des Marsches. Die Kleider hatte er als Bündel unter den Arm geklemmt . .. Ein General, der mit seinem Wagen vorbeirauschte, wurde in einem wahren Ausbruch von Raserei derart mit unflätigen Worten eingedeckt, daß ein unbeteiligter Zeuge davon hätte überzeugt werden müssen, eine Meuterei stehe unmittelbar bevor ... Finnland marschiert!“ (S. 134 ff.)
An der Uebersetzung wird, so schwer das Unterfangen auch gewesen sein mag, von allen Kritikern des vorliegenden Buches kein gutes Haar gelassen. Mit Recht! Einzelne Worte sind selbst dem in der deutschen Wehrmacht gedienten Oesterreicher unverständlich — es sei denn, er war zufällig einmal in ein pommersches Grenadierbataillon geraten.