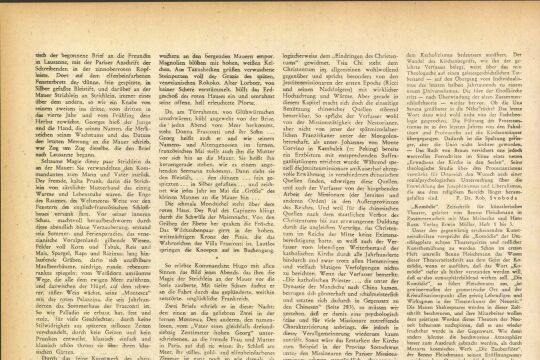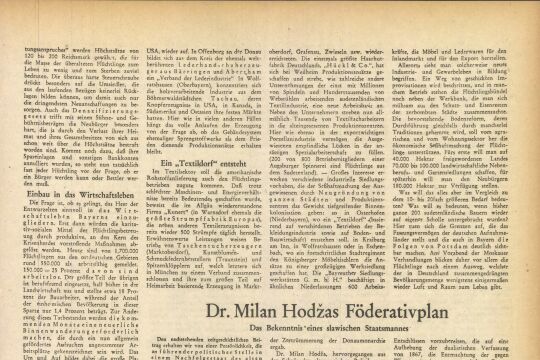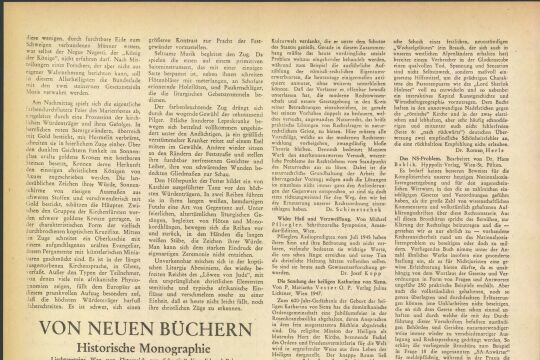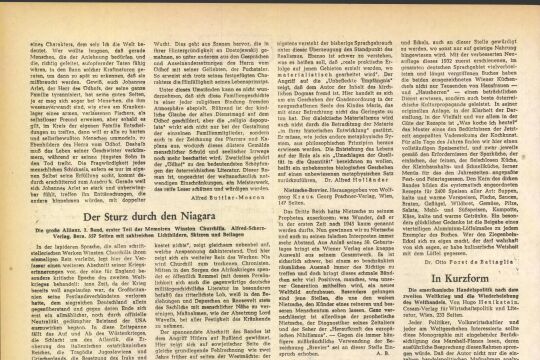Dem ersten Band seiner in jeder Hinsicht wohlgelungenen Darstellung, der „Die historischen Grundlagen des 20. Jahrhunderts“, nämlich die Zeit von der Begründung des Bismarckschen Reiches bis zum Russisch-Japanischen Krieg und zur russischen Revolution von 1905 umfaßt hatte, läßt der bedeutende schweizerische Geschichtsforscher nun seine Schilderung der „Vierzehn Jahre, die die Welt erschütterten“ folgen, jener verhältnismäßig kurzen Zeitspanne, während derer die meisten Voraussetzungen der bisherigen inneren und äußeren Ordnung dahinschwanden und es mitunter scheinen mochte, als sollten mehrere tausend Jahre organischer Entwicklung ausgelöscht werden, als hätte Klio mit ihrem Griffel auf einer mit viel Blut abgewaschenen Tafel völlig von neuem ihren Bericht anzufangen. Salis blickt auf das wirr-verwirrende Geschehen vom europäischen Standort aus, doch er überschaut den gesamten Erdkreis, ohne etwas -Wesentliches zu übersehen. Mit dem Blick des großen Historikers und des einfühlsamen Politikers entdeckt er die wichtigsten Zusammenhänge, das vermeinte Chaos gibt die Gesetze seines Aufbaues preis, die Logik der Ereignisse wird offenbar und wir empfangen die Erkenntnis, nicht nur, w i e alles eigentlich gewesen ist, sondern auch warum es so gekommen ist, freilich nicht — und zu derlei Einsichten vermag nur der Geschichtsschreiber zu gelangen, der an Prädestination, an zwingende Gesetze des historischen Ablaufs glaubt —, weshalb, o düstere Macht des Verhängnisses, alles so und nicht anders kommen mußte. Der Autor bejaht den freien Willen der Sterblichen und also deren sittliche Verantwortung . für ihr Tun und Lassen. Ohne sich zum überheblichen, moralinsaueren Richter am Tribunal der Weltgeschichte aufzuwerfen, scheut Salis dennoch nicht davor zurück, das Verhalten derer, die große Politik betrieben, beim richtigen Namen zu nennen. Lieber Scheußlichkeiten breitet er keinen Mantel der unchristlichen Vorliege für bliese öde? jene Partei; Dummheit'tmd Unzulänglichkeit werden auch dort angeprangert, wo sie in einem dem Verfasser gesinnungsmäßig nahestehenden Lager zu finden sind. Fügt man den bisher gerühmten Vorzügen hinzu, daß der Schweizer Historiker eine ganz ungewöhnliche Vertrautheit mit der Literatur und mit den Quellen seiner Darstellung aufweist, daß ihm der deutsche, französische, angel sächsische Sprachraum gleichermaßen gewohnte Umwelt sind und daß er dort überall die Ideen, die Menschen und die Dinge von innen her sieht; daß Salis ferner den wirtschaftlichen Momenten die gebührende — und, erfreulicher Gegensatz zur marxistischen Betrachtung, nicht die allein-entschei-dende — Aufmerksamkeit widmet, daß er endlich vom sichtbaren Streben nach Unparteilichkeit geleitet wird und daß er, ohne eigentliche Wortkunst zu bieten, einen klaren, einprägsamen Stil schreibt: dann ist wohl der Titel gerechtfertigt, den wir dieser Anzeige gewählt haben.
Als Schwächen, die dem Werk im allgemeinen anhaften, sind nur wenige hervorzuheben: zu geringe Bewertung der Kraft der Ideen, die sich, mitunter als irrationale Gewalten oder als unabdingbare Voraussetzungen einer, sei es auch falschen, Logik gegenüber wirtschaftlichen Argumenten oder Erwägungen der Staatsräson, durchsetzen; die im Westen und im Herzen Europas leider übliche ungenügende Berücksichtigung der östlichen Forschung und ihrer Ergebnisse — Salis verzeichnet immerhin, und das verdient Beifall, ein paar ihm zufällig aufgestoßene russische Buchtitel, doch schon aus deren englischer Transkription ersieht der Kundige, daß es sich hier nur um Zitate aus angelsächsischen Schriften dreht —; schließlich die viel zu stiefmütterliche Behandlung der einstigen Habsburgermonarchie und der Polen, Ungarn, die alle drei in ihrer, zeitweise überragenden, Wichtigkeit für den europäischen Ge-jchichtsablauf nicht hervortreten.
Damit wären wir bereits zur Einzelkritik gelangt, die ja an jedem, auch dem besten Gesamtwerk, unvermeidlich ist und aus der wir, in nötiger Beschränkung auf eine kleine Probe, folgendes vorzubringen haben: die Einbeziehung Rußlands in den Abschnitt „Das Erwachen Asiens“ verleitet zu unzutreffenden, ins Politische hinüberspielenden Folgerungen. Das auf dem Weg zur völligen Europäisierung befindliche Zarenreich ist erst durch Krieg und Oktoberrevolution zurück in die asiatische Welt geworfen worden (S. 137). Von einer völligen Abgeschlossenheit Japan vor 1854 zu reden, ist zwar üblich, doch unzutreffend. Es genügt, auf die japanischen Expan-sionspläne nach den Philippinen und auf Korea hinzudeuten, um z erkennen, dafl sich Nippon schon im 16. Jahrhundert unter den großen Shögunen auf den Weg zur ostasiatischen Seeherrschaft begab. Erst das Scheitern dieses Bemühens brachte Stagnation und Absperrung, deren beider Höhepunkt im 18 Jahrhundert liegt (S. 143 ff.). An der sonst glänzenden Erfassung des Russisch-Japanischen Krieges ist irrig, daß sein Ausgang das Prestige des Zarentums schonte; es fehlt der wenigstens kurze Hinweis auf den Zusammenhang mit dem Wiederaufleben der polnischen Frage (Dmowski und Pilsudski in Tokyo, der keineswegs rein soziale Aufstand in Kongreßpolen, S. 186). Wider die sehr geistreiche Parallele und Antithese „Europäer“— ,,Asiaten“ läßt sich sehr viel einwenden. Das, was für den Buddhismus und für manche chinesische Philosophien, vorab den Taoismus, stimmt, kann in keiner Weise für den erdnahen chinesischen Realismus, auch des K o n g Fu-Tse, oder gar für die japanische Nationalromantik gelten. Daß man in Europa so wenig Biographien bedeutender Ostasiaten kennt, sagt gar nichts über das unbezweifelbare Vorhandensein zahlreicher starker Individualitäten in der chinesischen und japanischen, in der mongolischen und hinterindischen, weniger in der yorderindischen Geschichte. Und aus dem theoretischen Bekenntnis zum Buddhismus oder Taoismus auf die Weltabkehr und Beschaulichkeit der tüchtigen, grob-irdischen chinesischen Beamten und Kaufleute, Literaten und Bauern zu schließen, ist so fälsch, wie etwa die Venezianer und Genuesen nach dem heiligen Franziskus, die Franzosen nach Bernhard von Clairvaux zu beurteilen (S. 197 ff.). Hier vermissen wir Erwähnung des japanischen, auf den berühmten General Tanaka zurückgehenden Plan einer Restauration der chinesischen Monarchie unter den Auspizien des Tennö. Beim Abschnitt über Fernost macht sich eben das Vernachlässigen der russischen und japanischen Literatur, vor allem der grundlegenden Werke von Gal'perin (Anglo-japon-skoj sojuz 1947), Sidorov (Russko-japonskaja vojna 1946), doch auch einiger ausgezeichneter Beiträge in westlichen Sprachen, zum Beispiel Dallins „Rise of Russia in Asia“ (1949) spürbar (S. 269). Das österreichische Parlament konnte, entgegen Salis' Ansicht, einen Ministerpräsidenten stürzen (S.. 272). Norwegen wurde nicht „selbstverständlich“ Monarchie, sondern auf Grund einer Volksabstimmung, bei der die Republik eine nicht unbeträchtliche Minderheit der Stimmen erhielt, (S. 274). Es ist irrig, von einer „Ausnahme“ zu schreiben, die den König von Italien, den Kaiser von Oesterreich und das holländische Königshaus betroffen habe und vermöge deren diese drei Dynastien der Savoyer, der Habsburg-Lothringer und der Nassau-Oranier „keine oder nur entfernte Verwandtschaft“ mit den „anderen großen Herrscherhäusern Europas“ besessen hätten, tn' Wahrheit stand es 'so, 'daß die europäische Fürstenfamilie in zwei Hauptgruppen zerfiel: -die evangelisch-orthodoxe und die katholische. Zwischen beiden gab es jedoch eine Menge naher blutmäßiger Querverbindungen, die hier einzeln anzuführen -unmöglich ist, die aber schon beim flüchtigen Durchblättern des „Ahnentafelatlas“ von Kekule v. Strado-nitz oder der neueren Publikation des Prinzen Karl Isenburg in die Augen springen (S. 328 ff.). Die Unaufhaltsamkeit des Zerfalls der Donaumonarchie, ein Leitsatz, der bei Salis oft wiederkehrt, müssen wir aufs energischste bestreiten. Der Untergang des alten Oesterreich-Ungarn war auch nach der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand nicht in den'Sternengeschrieben. Sie war das Werk des Zusammenarbeitens mehrerer untereinander bitter verfeindeten Kräfte, und sie hätte noch im Sommer 1918 vermieden werden können, wären nicht Dummheit, Bosheit und ideologische Verblendung stärker gewesen als staatsmännische Einsicht (S. 337 und 440). Graf Aehrenthal als Angehörigen des deutsch-jüdischen Bürgertums oder gar als „Jude“ zu bezeichnen, sollte man ddm Semi-Gotha und dem Ressentiment Izvol'skijs überlassen. Mit einer hocharistokratischen Ahnentafel gehörte der k. u. k, Außenminister durchaus der sogenannten „Ersten Gesellschaft“ des österreichischen Hofadels an. Seine Abstammung von den Lexa (in der Vaterlinie) reicht ins beginnende 18. Jahrhundert zurück und er hätte, nach den Ber Stimmungen der NSDAP, deren Parteimitglied werden können (S. 482). Botschafter Gottfried Hohenlohe war Prinz und nicht Fürst (S. 483 ff.). Conrads Standpunkt findet bei Salis ebensowenig Verständnis wie der Aehrenthals. Wir vermissen Erwähnung der grotesken Affäre des Konsuls Prochaska. Völlig übergangen wird die Bedeutung der polnj-. sehen Frage, die Bildung der Kampforganisationen Pilsudskis unter dem Schutz des k. u. k. Generalstabs (S. 522). Oesterreich-Ungarn, seine damals leitenden Staatsmänner und Heerführer werden viel zu sehr mit einer Kriegsschuld belastet, die, wenn überhaupt vorhanden, auf der Ueberzeugung gründete, nur durch eiren Verzweiflungskampf die nackte Existenz der sonst dem Untergang geweihten Monarchie retten zu können (S. 570). Hier.steht kein Wort über die katastrophale Wirkung des-Verlusts Lembergs („Im Osten ist'Lemberg noch ,.in. unserem Besitz“, S. 582 ff.). Üeber die großen Siege der k. u. k. Armee gleitet Salis. zu schnell,hinweg und er berührt wiederum mit keinem Wort.die in jeucn Jahren kapitale Bedeutung der polnischen Diiige (S.“ 5:|S). Der „a|te“ Erzherzog Friedrich zählte bei Ucbcituhtrie des Oberbefehls 58 Jahre! (S 611). Einer dei vieben Satze- die in der Gesamtdarstellung/es .ersten Vdfkfi|teS den Polen eingeräumt srndi.emhalt_.cinc,artige .Zähl von „Unstimmigkeiten.“. Er faatetr als daher kurz vor dem Tode Franz losefs dielfi lytd Wilhelm IL, in einer Proklamation Polen die Unabhängigkeit in der Form einer, konstitutionellen Erbmonärchie versprachen, bildete, sich' eine polnische-.L'4p'c|rti';ünter dem früheren Sozialdemokraten PUsü'dski. die als selbständige Einheit in den. Reihen- dci;f;'piterreichischen Aimee kämpfte.“,.Nun..is,t die? politische Legion, die ,.unterirdisch“' seit'Iahten- bestand, sofort bei Kriegsausbruch offen aufgetreten und sie hat bereits Anfang August 1914 ihre Operationen begonnen. Sie kämpfte nicht in den Reihen der österreichischen Armee (die es überhaupt nicht gab, denn es existierte nur eine k. u. k. Armee), sondern als eigener Verband unter einem vom k. u. k. Oberkommando (AOK) bezeichneten Befehlshaber, einem k. u. k. General polnischer Volkszugehörigkeit. Pilsudski stand unter diesem, einem Divisionär, als Kommandant der 1. Brigade. Nach der Proklamation vom 5. November 1916 sollte eine polnische Wehrmacht gebildet werden, die dem. deutschen Oberkommando zu unterstellen war. Ludendorff hatte dem, ihm sonst verhaßten Experiment des polnischen Staates zugestimmt, um Kanonenfutter zu erhalten. Als die von Pilsudski gestellten Bedingungen nicht erfüllt wurden, verweigerte dieser samt seiner weitverzweigten Organisation die Hilfe bei der Rekrutierung. Es kam später zu Meutereien, auch in der dem k. u. k. Befehlsbereich angehörenden“ Legion. Dfese-wüTde-atffferfSf,-. die Widerspenstigen . wurden |nterniert=--Einem,. Teil der Legion glückte der Ausbruch und sie ging, unter General Haller, zu den Alliierten über, kam auf abenteuerlicher Fahrt über Rußland nach Frankreich. Pilsudski wurde verhaftet, nicht weil er — wie Salis sagt — eine „rebellische Natur“ war, sondern um ihn, der höchstes Ansehen bei der Mehrheit seiner landsleute genoß, als nunmehr Unzuverlässigen unschädlich zu machen (S. 658). Die überragende Wichtigkeit der Sixtus-Episode leuchtet aus Salis Darstellung nicht genug hervor. Es wird dabei nicht auf die Rolle hingedeutet, die antikatholische Affekte und geheime Einflüsse spielten; die Zusammenkunft von St. Jean-de-Maurienne sollte in ihrer ganzen Tragschwere gewürdigt werden. Uebrigens sind ein paar sehr weit,gediehene Separatfriedensfühier nicht beachtet (Vicomte de Guichen, die Linie Fr. W. Foerster-Field-Herron, S. 676). Kerenskij kommt viel zu gut weg. Einwendungen größeren Umfangs hätten wir anzumelden: gegen die zu beiläufige Schilderung der arabischen Politik Großbritanniens und Frankreichs (nichts über den Picot-Sykes-Vertrag, Lawrence of Arabia unerwähnt), gegen die Ünter-schätzung der Rechtsgültigkeit des Björkö-Vertrages (die russische Kontrasignatur rührte nicht von „einem Admiral“ her, den sich Nikolaus II. in die Kajüte kommen ließ, sondern vom Marineminister Birilev, und sie war nach damaligem russischem Staatsrecht verbindlich); gegen die Schilderung der Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk (der Name des wichtigsten Mannes auf deutscher Seite, General Hoffmann, wird nicht einmal genannt; dfe ukrairiisclre Regierung erscheint nicht als das bloße Werkzeug der Mittelmächte, das sie war, und die verhängnisvollen Folgen des sogenannten Brotfriedens für die Habsburgermonarchie, deren Todesurteil er war, tritt nicht hervor) Endlich fehlt eine Würdigung des' in extremis geschlossenen deutsch-russischen Vertrags vom 27. August 1918. Mit diesen paar Vorbehalten sei die Kritik an Einzelheiten beendet.
Ungetrübt von allem Widerspruch, den wir zu diesem oder jenem Kapitel erheben, bleibt die dankbare Anerkennung der Gesamtleistung. Der Aufbau des Werkes ist mustergültig, von der Schönheit einer Symphonie. Vom Aufstieg Amerikas über Asiens Erwachen geht der schicksalhafte Weg zur Krise Europas und zu derem akuten Gipfelpunkt, dem ersten Weltkrieg. Kernstücke der tiefen Einschau sind die bewundernswerte Vorgeschichte des Weltkrieges, von Agadir zu Sarajevo, dann die dramatische Erzählung der letzten vier Wochen des sterbenden Friedens. Sehr hohes Lob geziemt den Kapiteln über die USA, Frankreich und die deutsche Innenpolitik. Wie im eisten Band beansprucht das sorgsam und mit raffinierter Treffsicherheit ausgewählte Bildmaterial, 83 Tafeln, besonderen Beifall. Diese Photographien Sind mehr als schmückende Zutat; sie ergänzen aufs eindringlichste den Text und sie sprechen mitunter eine deutlichere Sprache, als das die beste Schreibe vermöchte. Ein gutes Register der Personen erleichtert die Benützung des dickleibigen Bandes. Zur dreizehn Seiten umfassenden Liste der Quellen und der Literatur des von Salis geschilderten Zeitabschnittes haben wir grundsätzlich unsere volle Anerkennung zu spenden. Wesentliche Lücken klaffen nur in be-:ug auf Oesterreich-Ungarn und auf alles Slawische. Hier auch nur das Wichtigste nachzutragen, ist uns nicht verstattet. An drei Beispielen sei immerhin erwiesen, daß da für kommende Auflagen eine Revision geboten ist. Zur internationalen Entwicklung 1905—1914 fehlen: Zajonckovskijs, Notovic', Debo-rins, russische Standardwerke, Albertinis „Origini“. Bei der bosnischen Krise und dem Mord von Sarajevo vermissen wir das skandinavische Hauptwerk von Wittrock (Oesterrike-Ungarn i bosniska Krisen, 1939), Miljukovs „Balkanskij krizis“. Sosnoskys „Balkanpolitik Oesterreichs“, L. Pfeffers kapitale „Istraga u Sarajevsko atentatu“ (193S). Endlich hätten wir über den Zerfall Oesterreichs mindestens diese Bücher ins Verzeichnis aufgenommen: die Franz-Ferdinand-Monographien von Kiszling, Franz Georg und Kabisch, die Kaiser-Karl-Biographien von Werkmann, Zessner, die allgemeinen Zusammenfassungen von Kann „The multinational Empire“ (zwei Bände. 1950), Nowak „Der Sturz der Mittelmächte“, Jäszi „Dissolution of the Habsburg Monarchy“ (1929), feiner über die Tschechen die tschechischen, umfänglicheren Originalausgaben von Benes' „Svetovä välka“, Opocensky, und M. Paulova („Dejiny Maffie“, 2 Bände 1938/39), Peroutka (Budovani statu 1933), über Ungarn die Memoiren von Kärolyi, Win-dischgrätz und Erzherzog Josef, über Polen Bobrzyn-skis „Wskrzeszenie Panstwa Polskiego“, Seydas „Polska na przelomie dziejöw“, Perdelwitz „Die Polen im Weltkrieg“, Sokolnicki „Polska w pamiet-nikach Wielkiej Wojny“, die Erinnerungen von Bi-liftski und Daszynski. Unbedingt wären noch die Briefe Tiszas (in der ungarischen Originalausgabe), das Tagebuch Josef Redlichs, die Aufzeichnungen Andrässys, Auffenbergs, Macchios, Pomiankowskis und Josef Stürgkhs zu erwähnen.
Univ.-Prof. Dr. Otto Forst de Battaglia
Die deutsche Sprache im Spiegel der französischen.
Von Wolfgang P o 11 a k. Wiener Sprachgesellschaft 195 5. Preis 10 S.
In einem auf Antrag der Wiener Sprachgesellschaft herausgegebenen Heftchen im Umfang von einem Druckbogen beleuchtet der Verfasser die strukturellen Unterschiede der beiden Sprachen. In Aussprache und Wortschatz ist das Deutsche wesentlich uneinheitlicher als das Französische. Dem im 17. Jahrhundert entstandenen Ideal einer eleganten, klaren Gesellschaftssprache, das noch heute in
Frankreich Geltung hat, stehen sprachlicher Subjektivismus und Eigenbrötelei im Deutschen gegenüber. Betonung und Satzmelodie sind in den beiden Sprachen verschieden, und während das Deutsche infolge seiner mehr synthetischen Struktur ohne Aenderung des Satzbaues jedes Wort durch Starkton hervorheben kann, muß das Französische, das rhythmische Gruppen bildet, zu syntaktischen und lexikalischen Mitteln greifen, um einem Satzglied Nachdruck zu verleihen. Das deutsche Zeitwort ist spezialisierter als das französische, dem einfachen französischen Hauptwort steht oft ein deutsches Kompositum gegenüber: die Bedeutung des einzelnen Wortes ist im Französischen mehr an den Satzzusammenhang gebunden als im Deutschen.1 Etymologische Zusammenhänge werden in den weniger homogenen französischen Wortfamilien nicht so deutlich wie im Deutschen. Das Französische, das seit dem 17. Jahrhundert bemüht war, das Erbe des Lateinischen anzutreten, wurde, als es sich des grundlegenden Unterschiedes von synthetischer und analytischer Sprachform bewußt wurde, zu jener geregelten Wortfolge gezwungen, deren Ergebnis die berühmte klassische Klarheit seines Ausdrucks ist, während für den deutschen Sprachbau die romantische Sprachauffassung von Wichtigkeit geworden ist mit ihrer Vorliebe für Bildhaftigkeit und Metaphern. Die Beispiele, mit denen der Verfasser seine Leitsätze belegt, sind sehr instruktiv.