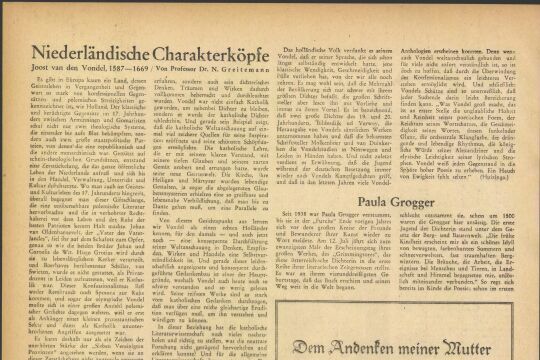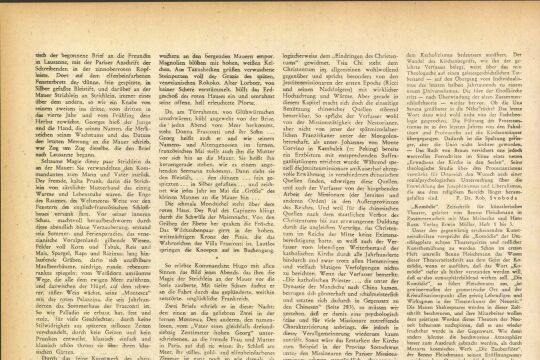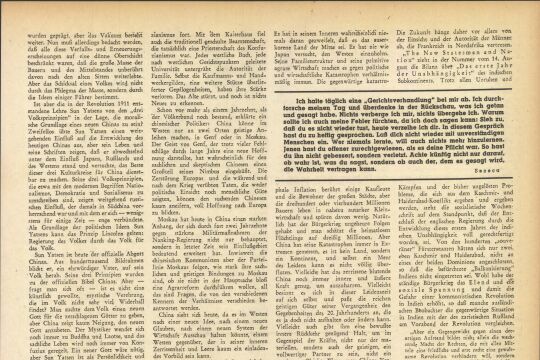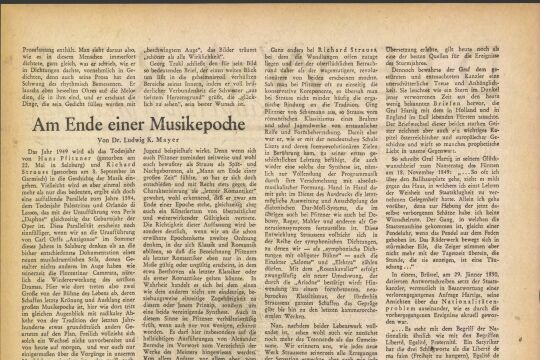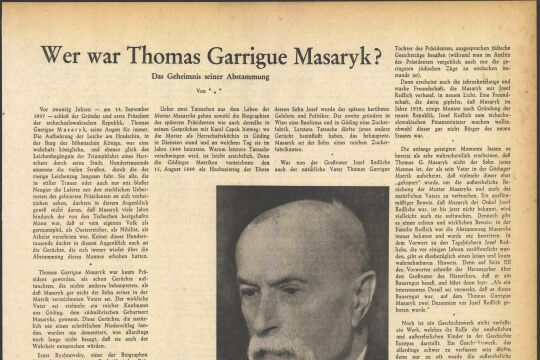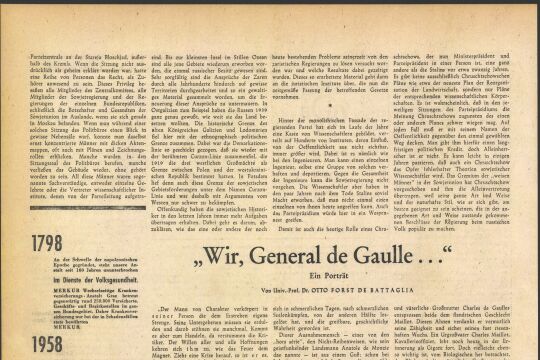DIE SCHWEIZER, gewohnt an ragende Gipfel, lieben es dennoch nicht, wenn einer aus.ihrer Mitte zu hoch über eben diese, sehr “anständige, Mitte hinausstrebt, und am wenigsten, wenn er ihnen zu spüren gibt, daß er den meisten Eidgenossen um die Länge eines an — den hergebrachten Urteilen widersprechenden — Gedanken reichen Hauptes voraus ist. Besonders denen wird von der öffentlichen Meinung übel mitgespielt, die mit ihren Anschauungen in der Vergangenheit allzu tief wurzeln und die dabei, ohne daß es die Zeitgenossen ahnten, weit eher der Nachwelt etwas bedeuten als Politiker, Dichter, Künstler, die den Beifall der Mitlebenden finden. Die genialen Basler Jakob Bachofen, der Entdecker des Mutterrechts, und Jakob Burck-hardt, der unsterbliche Autor der „Renaissance“ und der „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“, Philipp Anton von Segesser, der Schöpfer einer originellen Staatslehre, sind in ihrer Heimat nicht zu d e r Geltung bei den Schweizern ihrer Epoche gekommen, die vorab den beiden Erstgenannten jenseits der eidgenössischen Grenze schon früh geworden ist. Auch von Johannes Müller, von Albrecht von Haller und von Friedrich von Hurter läßt sich feststellen, daß sie vom Ausland her in ihrem Vaterland Ruhm erwarben. Derlei geistige Reisläufer sind ein Gegenstück zu den ungezählten Schweizer Heerführern und hohen Offizieren, denen es zu Hause an der Möglichkeit fehlte, ihren Tatendrang zu befriedigen, und denen die in der Fremde errungenen Würden und Besitztümer Grundlage für das hernach an der Stätte ihrer Geburt erlangte Ansehen bildeten.
Gonzague de Reynold hat für die, durch eine . flache . Geschichtsklitterung, pft. geschmähten Schweizer Kämpfer in auswärtigen Armeen gar manche Lanze gebrochen. Er stammt selbst von einem illustren Krieger ab, der in Frankreich den Marschallstab empfing und den heute eine Schweizer Gedenkmarke ehrt. Er ist der gesinnungsmäßige Nachfahre der Haller und Johannes Müller, der Segesser und Jakob Burckhardt, mit dessen Familie er übrigens durch die Heirat einer Tochter mit dem bekannten Schweizer Diplomaten und gewesenen Hochkommissar des Völkerbundes in Danzig, dann Präsidenten des Roten Kreuzes und zuletzt Gesandten in Paris Carl Burckhardt, verschwägert ist. Der Herkunft nach gehörte Gonzague de Reynold in den Kreis der noch zu Ende des Mittelalters aus der Bauernschaft ins städtische Patriziat, dann in den Landadel aufgestiegenen Hüter echtester Schweizer Traditionen, der Träger einer verfeinerten, aus den beiden Quellen französischer und deutscher Geistigkeit genährten Kultur. Am 15. Juli 1880 im seit Jahrhunderten seinem Geschlecht eigentümlichen Schloß Cressier ob Morat, im Kanton Freiburg, geboren, hat er am altberühmten College St. Michel zu Freiburg, das von Geistlichen geleitet wird, die Grundlagen einer wahren humanistischen Bildung erhalten. Die Pariser Sorbonne, Zürich und Bern, schließlich Freiburg im Breisgau, formten den wachen, eindrucksamen jungen Aristokraten, der aus der von ihm gleichwohl geliebten Enge seiner Kleinwelt, in die er hineingeboren war, in die Weiten des europäischen Raumes und auf die Höhen schöpferischer Forschung begehrte. Aus Ursprung, aus Lehr- und Wanderjahren und aus dem ihnen folgenden Erdenwallen Gonzague de Revnolds erklären sich sowohl die tragische Zwiespältigkeit in seinem Wesen, die er, willensstark und weise, durch eine alle Gegensätze überdachende Synthese zu überwinden trachtet, als auch der Widerspruch, in den er zu seinen schicksalhaften Genossen gerät, an denen er doch mit jeder Faser hängt und in ihm, dem Überlegenen, aus der Art Geschlagenen und trotzdem zutiefst seiner Art Verhafteten, nicht den bewundernswürdigen Mahner und Zeugen erkennen wollen. Gezweiung herrscht in diesem Dichter und Denker, der von fernher deutschredender Alemannen Nachfahre ist, den die französische Aura völlig umhüllt, der aus ihr zeitweilig ins rauhere deutsche Klima flüchtet und den dann wieder die lateinische Komponente seines Gemüts überwältigt. Er befreit sich vom inneren Kampf, indem er die Verschmelzung germanischer und romanischer Wesenheit im Schweizertum erkennt, dem er ganz zu eigen ist. So treu aber der Herr auf Cressier seinem Haus und seinem Dorf, seinem Kanton bleibt, ob er auch, und je mehr er sich, der Schweizer Gemeinschaft eingeordnet fühlt, so treu beharrt er der Eidgenossenschaft, ob er auch und je mehr er sich, als Schweizer und als Hüter des Erbes zweier Sprachnationen, als Europäer empfindet. Und wiederum verflüchtigt sich alles scheinbar das Einfügen in ein größeres Ganze Störende, vor dem Bewußtsein, daß Ausgleich der Kontraste kein Aufgeben seiner selbst und daß Sicheingliedern in einen Verband einander Zugeordneter keinen Verzicht auf Sonderart mit sich bringen muß. In sich, in seinem großartigen und mannigfaltigen Werk hat also Gonzague de Reynold eine Harmonie vollendet, deren gedanklicher Inhalt vom formschönen Sprachkleid adäquat umhüllt wird. Doch die Disharmonie zwischen dem wortmächtigen Künder einer im strengsten Wortsinn konservativen Weltanschauung einerseits und seiner Zeit der Untergänge und der Umbrüche anderseits ist nie gelöst worden.
DER HERR AUF CRESSIER ist seinen Standesgenossen als Gelehrter, als Universitäts' Professor unheimlich. Er hat sich, statt nur dem edlen Waidwerk, der Politik und der überlieferten Geselligkeit des adeligen Landlebens zu huldigen, zu sehr dem europäischen Geist verschrieben, und sein scharfer Witz, sein Pariser Esprit hat dazu mitgeholfen, daß der blendende Redner, der bezaubernde Tischgefährte dennoch als Enfant terrible seiner ausgebreiteten Familie verpönt wurde. Der Genfer Privatdozent, der Berner, der Freiburger Professor, das korrespondierende Mitglied des Institut de France, der Ehrendoktor der kanadischen Universität Montreal, der Vizepräsident des Ausschusses für geistige Zusammenarbeit beim Völkerbund, der Träger des portugiesischen Camoes-Preises, der glänzendste Schweizer Schriftsteller französischer Zunge und einer der erleuchtetsten Köpfe der europäischen Gegenwart, hat er wenigstens in der bewundernden Anerkennung der Wissenschafter und der Dichter, der Politiker und der Kritiker seines Landes Ersatz für den Verlust mancher ihm an sich gesicherten Sympathien erfahren. Ach, M. de Reynold-Cressier wurde für die Society ein Tintenmensch, ein Literat und ein Foliantenwälzer; für die derlei verabscheuenden Tintenmenschen, Literaten und Foliantenwälzer aber blieb Universitätsprofessor Dr. h. c, Dr. Louis de Gonzague de Reynold der Graf von Reynold-Cressier, der Weltmann und Schloßbesitzer, der — allzu gut gekleidet, wie die Fama erzählt mitunter auch monokelbewehrt —, seine Vorlesungen nur so aus dem Ärmel schüttelt, statt sie im Schweiße seines Antlitzes aus einem Notizblatt herabzustammeln. Er war der Hon-nete-Homme, der sein ungeheures, fast ungeheuerliches Wissen aufs anmutigste hinter eleganten Prägungen barg, der die Geschichte als nacherlebte Vergangenheit und die Geschichtsschreibung als Kunst begriff; der von den Quellen über die ihnen abgelauschten Tatsachen zur fesselnden, das Einst sichtbar und fühlbar heraufbeschwörenden Erzählung vorstieß. Und dem dies alles im Grunde nur zweierlei Zweck hegte: zu ergötzen und zu belehren.
GONZAGUE DE REYNOLD begann damit, daß er sich selbst Rechenschaft über seinen eigenen Standort zu geben versuchte. Er fand sich als Schweizer, weil sein Heimatkanton durch Geschichte und geographisches Verhängnis in die Eidgenossenschaft gehörte. Und er erspürte das Wesen der Schweizer Art aus der in vieljähriger Forschung täglich erneuerten Begegnung mit den unmittelbaren Vorfahren — wir zögern zu sagen, mit den „grands ancetres“ des im neunzehnten Jahrhunderts neugeprägten Helvetertums: in der „Histoire litteraire de la Suisse au XVI1IC siecle“, 1909 und 1912 in zwei umfänglichen Bänden erschienen.
Immer wieder, aus dem Mikrokosmos, gelangt er, durch sich stets weitende Kreise, in den Makrokosmos. Zunächst in den Kreis der Eidgenossenschaft, von der er begriff, sie sei „nicht eine unausgeglichene Zusamme'nballung, das Werk des Zufalls und der Politik, sondern eine Nation“; man irrte, erblickte man in ihr „nur ein politisches Ganzes, während alles in ihr einen besonderen Geist enthüllt“, den der Alpen und des von ihnen geformten Menschen der Hochberge. Und so versteht man es, daß hier ein Volk zur unzerstörbaren Einheit verschmolzen ist, durch ein Gebot der geographischen Umwelt, nicht aber kraft rassischen oder sprachlichen Verhängnisses. Daß eben diese Einheit zum selbstverständlichen Gesetz in jedem einzelnen der Gemeinschaft wurde durch ein kollektives Geschichtsbewußtsein, das die Nachfahren an die in demselben Raum gebannten Ahnen fesselt. Von der Familie zur Gemeinde, von ihr zum Kanton und von dem zur Eidgenossenschaft führen die unzerreißbaren Bande. Deshalb ist der reinste Föderalismus die natürliche, die einzig denkbare Staatsform der Schweiz. Dieser Staat, in dem sonst miteinander LInvereinbares im Zeichen gemeinsamer Interessen und gemeinsamen Empfindens den schönsten Ausgleich findet, soll nun dem Universum ein Beispiel und eine verpflichtende Mahnung sein. Sie genügt, „um aus einem kleinen Volk eine große Nation zu machen“ Denn die Sendung eines Staates ist nicht etwa nur die, zu verwalten, noch die, zu regieren, sondern sie ist zivilisatorisch, sittlich.
DAS LOB SEINER HEIMAT, die Analyse des Schweizer Geistes und seine Verteidigung, sie bilden den Inhalt der langen Reihe von Büchern, deren herrliche Sprachform der Politiker und der Kulturhistoriker dem Dichter Gonzague de Reynold dankt. „Contes et Legendes de la Suisse heroique“, in mehreren Auflagen zwischen 1913 und 1947 erschienen, „Cites et Pays suisses“, 1914 bis 1920 in drei Bänden veröffentlicht, 1948 in endgültiger Ausgabe zu einem Band vereinigt, „La Democratie et la Suisse“ (1929), „Le Genie de Berne et l'Ame de Fribourg“, 193 5 aus der Verschmelzung zweier vordem selb-.jStändigensjSc'brifreij. entstanden,, „.Gmscience de la Suisse“, eine Sammlung von Artikeln aus der „Gazette desibausanne“, am Vorabend des zweiten Weltkrieges veröffentlicht, „Grandeur de la Suisse“ (1940), „Cercles concentriques“ (1943) wären etwa die wichtigsten Zeugnisse aus dem Werk des mahnenden und bekennenden Eidgenossen.
Wir können nicht im einzelnen alle die, aus historischen Rückblicken erschauten. Hauptthesen de Reynolds berichten. Für das Maß seines scharfen Urteils, mindestens auf nicht allzu ferne zeitliche Entfernung, möchten wir indessen zwei Vorhersagen wiederholen, mit denen er sich kaum als allzu übler Prophet erweist. Die eine stammt aus dem Jahre 1939 und lautet: „Wenn ein neuer europäischer Krieg ausbrechen sollte, in der Form eines Kreuzzuges gegen die totalitären Staaten, wenn dieser Krieg lang dauerte, dann ist es weise dies vorherzusagen: die Niederlage Europas und den Sieg Asiens. Asien, das ist Sowjetrußland. Es wird den Gegnern des Reiches helfen, doch es wird seine Kräfte in Bereitschaft halten, für den Augenblick, da Europa erschöpft sein wird. Es wird vor allem auf dem asiatischen Kontinent handeln, wo das britische Reich Indien verlieren dürfte“. Und „den Nationalismus und den Faschismus niederschlagen, das wird in keiner Weise die gegenwärtige Entwicklung der Welt abschließen. Man wird nur die Probleme verschieben, ohne sie zu lösen. Der zweite Weltkrieg wird zur Ursache den ersten haben; er wird den Keim zum dritten legen“. Die zweite Prophetie geschah 1940, im Augenblick der größten Siege des Dritten Reiche?: „Der Nationalsozialismus wird das Los aller deutschen Einheitsbestrebungen haben. Sie hängen von einem oder von wenigen Sterblichen ab. Sie sind heftig, den Deutschen selbst aufgedrungen. Sie erzielen rasch Erfolg, sie schwellen schnell an und sie zerplatzen. Es folgt dann eine neue Periode... der Zerstückelung oder der Anarchie: dann beginnt der Prozeß aufs neue.“
HÄTTEN WIR, NACH DIESEN PROBEN, nicht einige Ursache, auch folgendem Satz Gonzague de Reynolds einiges Zutrauen zu weihen: „Der Niedergang wird fortdauern, solange man nicht den höllischen Zauberkreis durchbricht, in den sich die Welt seit dem 19. Jahrhundert verirrt hat ... Die einzig mögliehe Lösung heißt: zurück zum Ausgangspunkt, von dem man sich auf den schlechten Weg begeben ha't; zurück zum Christentum, zum wahren, authentischen!“
Um diesen Kerrigedanken zu erhärten, ist Gonzague de Reynold dazu geschritten, sich und uns darüber Rechenschaft abzulegen, woher Europa gekommen ist und was dessen Inbegriff ausmacht. Diesem Vorhaben, zu dem in mancher Hinsicht die wundervolle, geistsprühende Untersuchung über Barock und Klassizismus, ,Le XVIIIe Siecle“ den Auftakt bildete, ist die bisher sieben Bände umfassende Darstellung des europäischen Werdens und Seins entsprungen, „La Formation de l'Europe“. Zwischen 1944 und 1954 sind einander gefolgt: „Qu'est-ce que l'Europe“,, ,Le Monde grec“, „L'HeMenisme“, „L'Empire Romain“, „Les Celtes“, „Le Monde Russe“, „Les Germains“, „Le Toit Chretien“.
„Auf einer vorhistorischen Grundlage, die ihrerseits auf dem geographischen Schauplatz ruht, erheben sich im Lauf der Zeitalter und der Jahrhunderte ein griechisches Erdgeschoß, ein römischer, ein germanischer Stock und darüber, sie vollendend und sie bedeckend, ein christliches Dach. Mir obliegt es, den Schlüssel zu finden, die Pforten zu öffnen, den Leser ins Innere dieses Baus zu geleiten und, nachdem ich die Fensterladen zurückgeschlagen habe, auf daß Licht eindringe, den Plan zu erklären, indem ich den Leser über die Stiege vom Keller bis zum First emporführe“. So umschreibt in einem eindrucksamen Gleichnis der Autor sein Bemühen. Er hat es vollkommen erfüllt. Kein zweiter, nicht einmal Christopher Dawson und schon gar nicht Toynbee, ist so sehr von politischer Einsicht in die großen Zusammenhänge beseelt; nur mit Huizinga teilt de Reynold die Gnade höchster wortkünstlerischer Begnadung. Der unvergeßliche Rene Grousset übertraf ihn an stupender Gelehrsamkeit und an Ausdehnung des auch die asiatischen Hochkulturen mitumfassenden Horizonts. Doch als Gesamtleistung ist die „Formation de l'Europe“ unübertroffen. Denn sie stützt sich auf die Errungenschaften der letzten Forschungen und sie rückt damit vor ältere Synthesen. Sie ist aus e i n e m Guß, gelenkt von folgerichtigen Leitmotiven; sie schlägt den widersprechenden Leser durch den Reiz der Darstellung in ihren Bann und vor allem, sie ist kein Fragment geblieben. Demgegenüber verblassen Schattenseiten: Unkenntnis oder Vernachlässigung der nicht in west- oder mitteleuropäischen Sprachen erschienenen Werke, daraus erklärbare Versehen in osteuropäischen Dingen, Zurückdrängen wirtschaftlicher Momente neben der von Gonzague de Reynold mit allem Fug gegenüber der materialistischen Betrachtungsweise betonten Rolle der Ideen, des geopoliti-schen und des blutmäßigen Einflusses. Ein so überragender Historiker bestätigt indessen seinen Rang und seinen Wert sogar an den neuralgischen Punkten seines Schaffens. Wir erstaunen, wie sehr auch dort, wo er in Einzelheiten irrt, der scharfblickende Beobachter das Gesamtbild richtig zeichnet; wie er aus mitunter falschen oder unzureichenden Voraussetzungen zum treffenden Schluß gelangt, vordringlich im Rußlandbuch.
HABEN WIR ABER NICHT ZUVIEL vom Politiker und vom Historiker berichtet und, ungeachtet mehrmaliger Hinweise, den Schriftsteller, den Dichter und Sprachkünstler, den Moralphilosophen zuwenig gewürdigt? Er selbst hat ja den, der von der Vergangenheit erzählt, über deren Helden erhoben. Der König, auf dem des Sängers Fluch lastet, von dem kein Sang, kein Heldenbuch meldet, ist versunken und vergessen. „Par les armes ont peut acquerir de la gloire, mais la gloire sans plume en oubli se dissout.“ Huldigen wir also dem Meister der knappen, das Wesen und, wo es sich ziemt, ins Herz treffenden Formulierung, dem Gebieter über Wort und Satz, ihm, durch den erst die Ideen und das Geschehnis, die Menschen und die Gemeinschaften fortleben im Begreifen der Nachgeborenen.