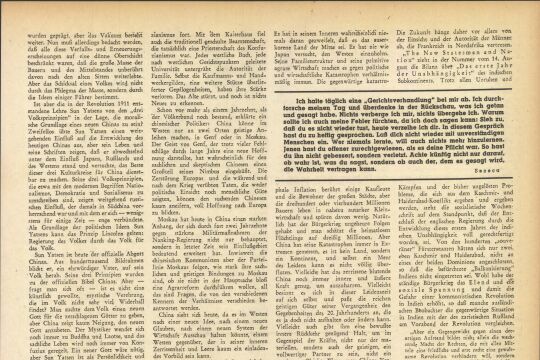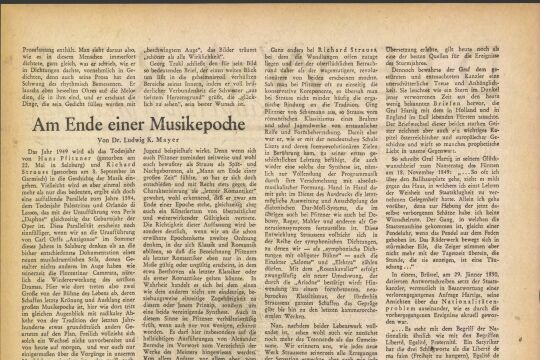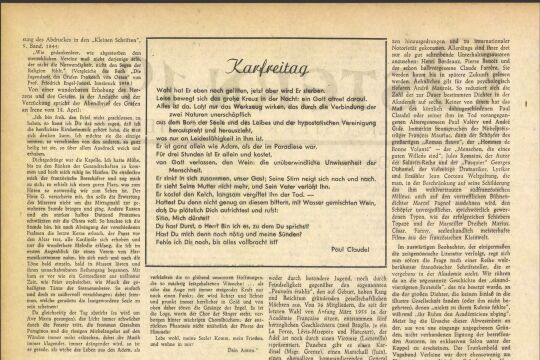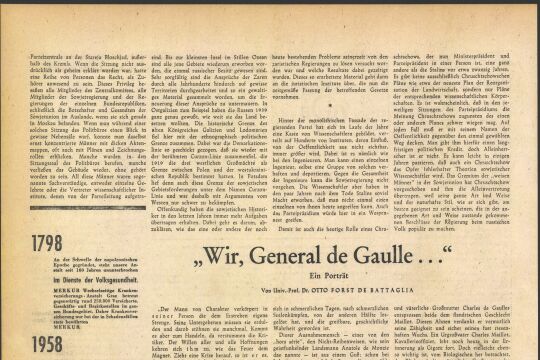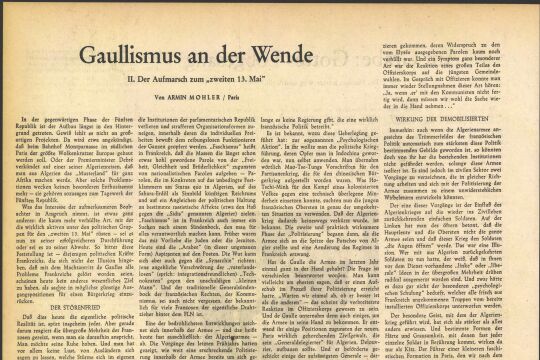ES GIBT IN ALLEN LÄNDERN Menschen, denen Personen und Institutionen, die als erhaben gelten oder sich als erhaben dünken, ein Greuel sind. Sie sind wie von einem inneren Zwang besessen, derartige Objekte der allgemeinen Bewunderung durch das Mittel des Spottes, der Persiflage, der Karikatur, wenigstens für einen Teil der Öffentlichkeit vom Piedestal der Unfehlbarkeit herabzuholen und sie der Sphäre normaler Sterblicher mit allen ihren Irrtümem, geheimen Leidenschaften, Eitelkeiten und Schwächen wiederzugeben. In Kulturbereichen, wo das Menschliche über allen Institutionen wie Staat, Gesellschaft, Partei und Gesetz steht, kann dies Unternehmen der Spötter und Persiflanten die Stellung einer allgemein anerkannten und vom Vertrauen der Mehrheit getragenen Persönlichkeit nicht erschüttern. Im Gegenteil — vom Tabu des „Übermenschen” entkleidet, wird der Staatsmann, Heerführer oder Schriftsteller dem Durchschnittsbürger nur vertrauter, ohne daß seine Autorität in seinem spezifischen Aufgabenbereich eine Schmälerung erführe.
Wer Frankreich seit langem kennt, weiß, daß das Lästern und Spotten über die Staatsautorität und ihre Exponenten kein Privileg der Kabarettisten und Karikaturisten ist, sondern schon als traditionell begründete gewohnheitsrechtliche, die Gemeinschaft umfassende Einrichtung bezeichnet werden muß. Wer erinnert sich nicht der Unabhängigkeits- erkärung der im Pariser Stadtzentrum liegenden Saint-Louis-Insel, die in den zwanziger Jahren auf Grund des Prinzips des Selbstbestimmungsrechts der Völker an den zu ihr führenden Brücken Zollschranken errichtete und Steuerzahlungen an den französischen Staat verweigerte? Erst die Drohung mit der Sperrung der Strom- und Wasserzufuhr seitens der Pariser Stadtverwaltung vermochte jenem Ulk, den die gesamte Bevölkerung mitmachte, ein Ende zu setzen. Später erhielt symbolhafte Bedeutung für die französische Freiheitsauffassung der Freispruch eines Soldaten durch ein Militärgericht, der sich aus Protest gegen die ihm lästig gewordene Verpflichtung, Vorgesetzten ständig eine Ehrenbezeugung erweisen zu müssen, das Wörtchen „merde” in seine rechte Handfläche hineintätowieren ließ. Die Richter streckten vor seinem Argument die Waffen, daß das Gesetz keinen Passus kenne, der einem freien Bürger Tätowierungen gleich welcher Art und an gleich welcher Stelle seines Körpers verbiete.
IN DEN JAHREN VOR DEM ZWEITEN WELTKRIEG wurde der Präsident der französischen Republik, Albert Lebrun, wegen des Tremolos in seiner Stimme von den Karikaturisten fast immer weinend dargestellt: Bei allen Reden fielen erbsengroße Tränen aus seinen Augen und bildeten Pfützen zu seinen Füßen. Den mehr als zwei Meter großen Ministerpräsidenten Pierre- Etienne Flandin pflegten die Zeichner gelassen auf den Eiffelturm hinabblicken zu lassen, während sie dem besonders eitel geltenden Staatsmann Paul Reynaud wegen seiner geringen Körpergröße einen Zwergenkomplex andichteten und es nicht lassen konnten, ihn in Damenhalbschuhen mit überhohen Stöckelabsätzen dem Millionenheer der Zeitungsleser vorzuführen.
Nach Kriegsende wurde de Gaulle sehr bald zum Hauptobjekt der Satiriker und Karikaturisten und ist es sowohl in der Vierten, als auch in der Fünften Republik bis zum heutigen Tage geblieben. Rein äußerlich bot der General den Graphikern durch seine körperlichen Dimensionen und vor allem durch seine überlange Nase keine Probleme; auch gaben seine hochfahrende Art, sein Hang zum Schauspielertum und sein Narzißmus dankbare Anhaltspunkte für die komische Darstellung der Person. Schwieriger war es dagegen, ein inneres Verhältnis zur rätselhaften Gestalt zu finden, die fast in allen Punkten den Idealvorstellungen eingefleischter Demokraten widersprach. Niemand kann behaupten, daß er im üblichen Sinne Popularität genießen würde, zumal der Durchschnittsbürger instinktiv fühlt, daß dem General der durch die Notwendigkeit der Public Relations erzwungene Kontakt mit der Masse im Grunde peinlich und zuwider ist. Er steht als Symbol und nationales Aushängeschild wegen seiner historischen Rolle im Kriege außerhalb der Diskussion, doch sein Wesen trägt dazu bei, daß die meisten Franzosen zögern und in Verlegenheit geraten, wenn man sie darnach fragt, ob sie sich eindeutig zu ihrem Staatschef bekennen könnten. Als der Schriftsteller Pierre Viėnot einmal vor dem Kriege gefragt wurde, wer der größte Schriftsteller Frankreichs sei, erwiderte er: „Leider Victor Hugo.” Ähnlich geht es dem Bürger mit de Gaulle: Er schwebt wie eine Standarte hoch über den Institutionen und den Niederungen der Tagespolitik, seiner Sendung bewußt und von Zukunftsvisionen getragen, doch oft selbst für seine jahrelangen Mitstreiter und Bewunderer so unbegreiflich, daß sie ihn lieber im Pantheon als im Elysėe sehen würden.
SO HAT SICH WIE von selbst ein Karikaturschema entwickelt, das den Staatschef entweder als absolutistischen Monarchen aus Frankreichs großer Zeit wiedergibt, wobei er quasi zur Reinkarnation des Sonnenkönigs wird, oder als einsamen, weltfremden Grübler, der zwischen verstaubten Büchern griechischer Philosophen und römischer Klassiker — den Blick verklärt in eine andere Welt gerichtet — über die Verbesserung der Verhältnisse auf der Erdkugel nachsinnt, die natürlich ihm allein Vorbehalten ist. In dem seit Jahren allwöchentlich erscheinenden „Hofberichten” der satirischen Zeitschrift „Le Canard en- chainė”, die sich laufend an die Tagesereignisse halten, wird die Gegenwart ins 17. Jahrhundert zurück verlegt: Der General wird als „Le Roi” bezeichnet, während seine Ehefrau — Madame Yvonne de Gaulle — den Namen „Madame de Maintenant” trägt, in Anlehnung an die berühmte Geliebte Ludwig XIV., Marquise de Maintenon, mit der sich der König 1684 heimlich trauen ließ. Der Premierminister und die Kabinettsmitglieder führen das Scheindasein von Hofschranzen und Lakaien, die sich liebedienernd den Launen des Königs bedingungslos unterwerfen und sich im übrigen untereinander in einem ständigen Intrigenkampf um das Wohlwollen des Monarchen befinden.
SO HEISST ES IM „Hofberich! von Ende Juli — damals war gerade ein Buch Merry Brombergers über Premiermindster Georges Pompidou erschienen —, daß der „Marquis de Pompidou” der Stern dieses Sommers sei. Überzeugt, daß der König sich im Herbst zu einer „radikalen Abdankung” entschließen werde und bestärkt durch die Information seiner Späher im Elysėe, wie auch durch die besondere Gunst, deren er sich bei Madame de Maintenant erfreute, mache er aus seiner Ambition, die Nachfolge des Königs anzutreten, kein Geheimnis mehr. Ungeachtet aller Kabalen und Anschwärzungen seiner Gegenspieler, darunter des „Chevalier Giscard Destaing” und des Grafen von Paris, bringe es „der Marquis” fertig, daß nur noch von ihm gesprochen werde. Man lasse zu seinem Lobe bestellte Romane schreiben, in denen er hinter der Maske eines weichen Kätzchens als ein Übermensch mit glorreicher Zukunft geschildert werde. Seine Leute bemühten sich mit großem Kostenaufwand um die Verbreitung dieser Bücher und verursachten gelegentlich peinliche Pannen; dies sei vor kurzem der Fall gewesen, als mehrere Gazettenschreiber eines dieser Werke zu ihrer Überraschung von einer Karte begleitet erhielten, die den Aufdruck „Mit den Empfehlungen der Presseabteilung des Herrn Premierministers” getragen habe.
ALS DER STAATSCHEF vor einiger Zeit seine jüngste Fernsehansprache an das französische Volk hielt, warb der „Canard” mit der Balkenüberschrift: „Nehmen Sie die Gelegenheit wahr: Wir sind die einzige Zeitung, die die Rede de Gaulles nicht bringt!” und am Vorabend von St. Charles lautete der Titel über sieben Spalten: „Morgen St. Charles — es lebe Aznavour!”
Bei der Pressekonferenz, die der General im Februar abhielt, fragte Ihn ein Journalist: „Wie fühlen Sie sich, Herr General?” Der Angesprochene entgegnete aufgeräumt, der Fragesteller möge sich beruhigen: Auch er werde den Weg allen Flei sches nehmen und eines Tages sterben. Dies gab der satirischen Zeitschrift „L’Os ä Moelle” („Der Markknochen”) — Devise: „Gegen alles, was dafür ist — für alles, was dagegen ist” — den Gedanken, eine von Andeutungen auf die „Force de Frappe” strotzende „ärztliche” Analyse des allerhöchsten Gesundheitszustandes zu geben, die in der Folgerung gipfelte, daß der Präsident der Republik von seinem Schnupfen vollkommen geheilt scheine. Auf der gleichen Seite bringt das Blatt eine Aufstellung von Fragen, die dem General bei der Pressekonferenz Zwar vorgelesen wurden, die er jedoch nur ganz summarisch beantwortet habe. Darunter befindet sich — unter Anspielung auf die sich nur schleppend vollziehende Amnestie für Strafakte im Zusammenhang mit der Algerienaffäre — die folgende Frage: „Sind Sie Anhänger einer Amnestie für Akte, die vor dem Edikt von Nantes begangen wurden, soweit die verewigten Täter bestimmten besonders verdienstvollen Kategorien angehören?” Ein anderer Journalist habe angeblich wissen wollen, was de Gaulle von der Kandidatur des Humoristen und geistigen Inspirators des „Markknochens”, Pierre Dac, bei den bevorstehenden Staatspräsidentenwahlen halte.
PIERRE DAC, EINER DER Senioren des französischen Humors und ehemaliger Präsident sämtlicher „Verrückten-Vereinigungen” Frankreichs, hat im Februar eine als Persiflage gedachte politische Partei, das Mouvement Ondulatoire Unifiė (M. O. U.), die „Vereinigte Wellenbewegung” itts Leben gerufen. Das Wort mou bedeutet im Französischen auch „weich”. Die ganze Geschichte ist eine Verspottung großer Worte und erhabener Gesten und könnte am besten mit einer Narrenmanifestation des Kölner Karnevals verglichen werden. Pierre Dac ließ sich, martialisch dreinblickend und die Rechte eruf einen Stoß Bücher, darunter zwei Pariser Telephonbücher, gestützt, als Präsidentschaftskandidat photographieren, er gab Interviews und hielt sogar eine Pressekonferenz ab, in der er — getreu dem großen Vorbild — und mit gespielter Feierlichkeit und betontem Ernst — Fragen der Journalisten beantwortete. Dies sah etwa wie folgt aus: Frage: „Herr Dac, wie wird, im Fall Ihrer Wahl zum Präsidenten der Republik, Ihre Haltung gegenüber der Todesstrafe sein?” Antwort: „Ich beabsichtige dieses Problem — seiner Bedeutung und dem Wesen unserer Bewegung entsprechend — klar, eindeutig und radikal zu lösen. Ich trete im Prinzip für die Beibehaltung der Todesstrafe ein, doch werde ich damit die Bedingung verknüpfen und ihre gesetzliche Verankerung erzwingen, daß sie niemals vollzogen werden darf.”
DER GEDANKE PIERRE DACS ist nicht ganz neu. Schon vor dem zweiten Weltkrieg hat der intellektuelle Sonderling Ferdinand Lop. von den Studenten des Quartier Latin ermuntert, die „Lopistenpartei” gegründet und versucht, als Präsidentschaftskandidat Anerkennung zu finden. Er trieb den Spaß so weit, daß er am Wahltag von mehreren Gendarmen mit Gewalt aus dem Versailler Schloß entfernt werden mußte. Vor einigen Jahren wandelte der deutsche Kabarettist Werner Finch auf seinen Spuren und gründete kurz vor den Bundestagswahlen die Partei der „Radikalen Mitte”, deren Abzeichen eine Sicherheitsnadel war, die unter dem Revers getragen werden mußte („man kann nicht wissen, wie es mal eines Tages kommt”). Doch während Lop und Dac — ebenso wie der durch seine Taubenparodie berühmt gewordene De-Gaulle-Imitator Henri Tisot — als Streiter gegen den tierischen Emst in der Politik dankbar begrüßt wurden, überschüttete die bundesrepublikanische Presse den Komiker Finck mit Vorwürfen, den Staat und seine sakrosankten Einrichtungen in unbotmäßiger Weise zu verhöhnen; so wurde der „Radikalen Mitte” mit der Verweigerung des Rechts auf Narrenfreiheit nach kurzer Existenz das Lebenslicht, das so kurz gebrannt hat, wieder ausgeblasen.
VIELLEICHT IST DAS SPÖTTELN UND Lästern über den regierenden Durchschnitt, ebenso wie die Sucht, die höchste Staatsautorität in Pantoffeln zu zeigen, das Privileg einer innerlich wirklich freien Nation — mögen sich auch diese Manifestationen auf die kabarettistische Ebene, das mehr oder weniger geistreiche Wortspiel und die Karikatur beschränken. Spielt das Objekt de Gaulle in diesem Zusammenhang eine ganz besondere, völlig aus dem üblichen Rahmen fallende Rolle? Man wird dies bei näherem Hinsehen kaum behaupten können. Gewiß, seine Unnahbarkeit vermag ihn nicht im üblichen Sinne beliebt zu machen, auch löst seine Sprunghaftigkeit und Verstiegenheit bei den nüchtern und sachlich denkenden Franzosen eine gewisse Komplexität aus, weil diese Eigenschaften unterbewußt ein stilles Schamgefühl bei ihnen wecken. Auf der anderen Seite bewirken seine Handlungen nicht selten zutiefst menschliche Reaktionen: man lacht über ihn, wie die Kinder im Marionettentheater mit anerkennender Schadenfreude über den Kaspar lachen, der seinen körperlich viel stärkeren Partnern und Gegenspielern mit der Peitsche auf den Kopf haut. Man kann hier von einer Freude jenseits von gut und böse und auch jenseits aller Logik sprechen. Ähnlich geht es den Franzosen mit der selbstsuggerierten Größe, die im Grunde einem kollektiven Wunschtraum entspricht. Indem man über die „Grandeur” und ihren markantesten Repräsentanten, der in sich selbst die Inkarnation der Nation ei blickt, spottet, lacht man über eiger Schwächen und gewinnt unbewul Distanz zu sich selbst. Die Methc den der Chansonniers und Kabarel tisten reichen dabei vom leise Nadelstich der Ironie bis zur die aufgetragenen, doch stets erheitern den Persiflage.