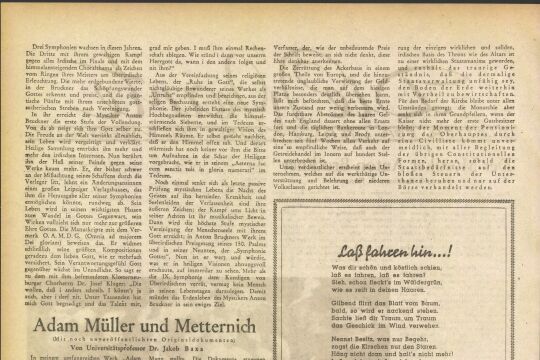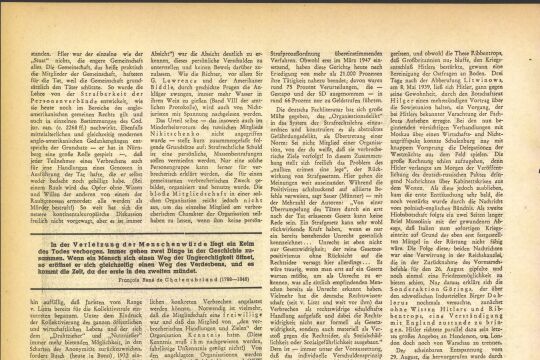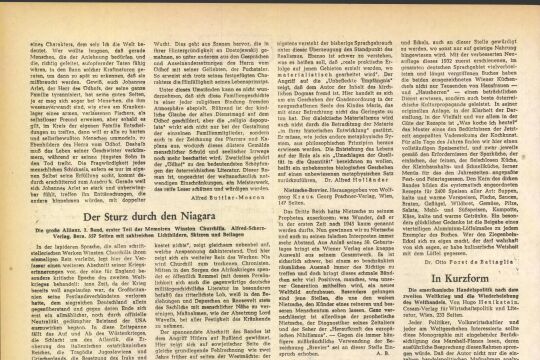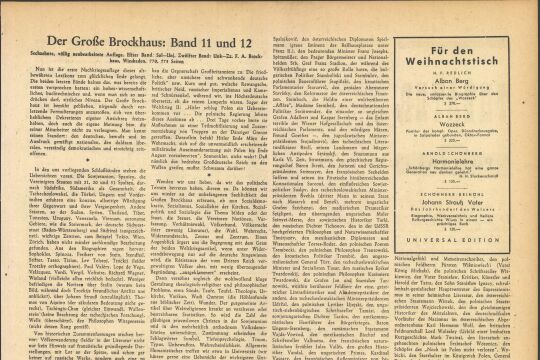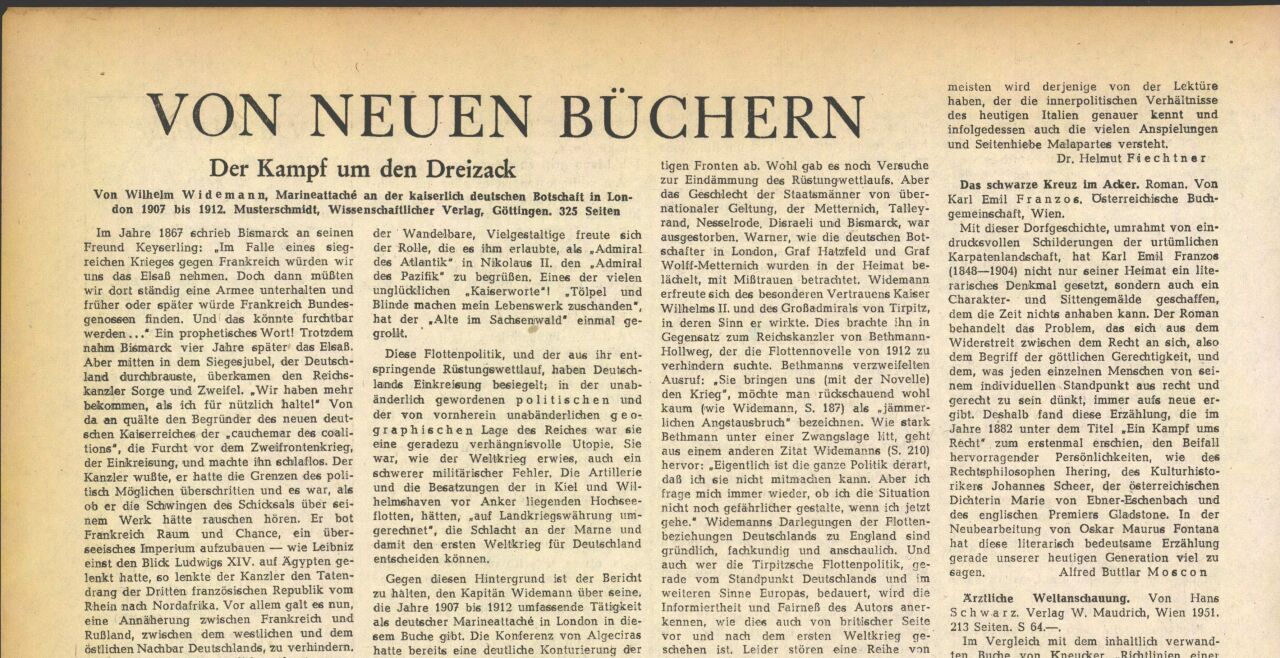
Im Jahre 1867 schrieb Bismarck an seinen Freund Keyserling: „Im Falle eines siegreichen Krieges gegen Frankreich würden wir uns das Elsaß nehmen. Doch dann müßten wir dort ständig eine Armee unterhalten und früher oder später würde Frankreich Bundesgenossen finden. Und das könnte furchtbar werden… Ein prophetisches Wort! Trotzdem nahm Bismarck vier Jahre später das Elsaß. Aber mitten in dem Siegesjubel, der Deutschland durchbrauste, überkamen den Reichskanzler Sorge und Zweifel. „Wir haben mehr bekommen, als ich für nützlich halte! Von da an quälte den Begründer des neuen deutschen Kaiserreiches der „cauchemar des coali- tions , die Furcht vor dem Zweifrontenkrieg, der Einkreisung, und machte ihn schlaflos. Der Kanzler wußte, er hatte die Grenzen des politisch Möglichen überschritten und es war, als ob er die Schwingen des Schicksals über seinem Werk hätte rauschen hören. Er bot Frankreich Raum und Chance, ein überseeisches Imperium aufzubauen — wie Leibniz einst den Blick Ludwigs XIV. auf Ägypten gelenkt hatte, so lenkte der Kanzler den Tatendrang der Dritten französischen Republik vom Rhein nach Nordafrika. Vor allem galt es nun, eine Annäherung zwischen Frankreich und Rußland, zwischen dem westlichen und dem östlichen Nachbar Deutschlands, zu verhindern. Diese Gefahr erschien freilich entfernt genug: das autokratische Zarentum und die „Republik der Advokaten“! Die russisch-preußische Freundschaft, gestützt auf die nahe Verwandtschaft der Herrscherhäuser, gestärkt durch die kluge preußische Politik im Krimkrieg und beim Polenaufstand 1863, konnte als unerschütterlich gelten. Da fiel Rußland in den Balkan ein und das Ende der europäischen Türkei schien gekommen. Die Truppen des Zaren standen vor Konstantinopel, während im Bosporus eine kampfbereite britische Flotte ankerte. Bismarck verhinderte die drohende europäische Konflagration auf dem Berliner Kongreß. Aber der Fürst irrte, wenn er nach diesem diplomatischen Erfolg zu seinen Beamten sagte: „Jetzt fahre ich Europa viere- lang vom Bock!“ —- den gerade eben war Rußland, das sicherste Pferd, aus seinem Gespann ausgebrochen. Bismarck suchte Stütze an einem Block der Mitte. Der Dreibund entstand, der durch die Stärkung des Balkanrivalen Österreich wiederum Rußland verstimmte. Nür einem Mann vom staatsmänni- schen Format, von der unvergleichlichen diplomatischen Geschicklichkeit Bismarcks, konnte es gelingen, Rußland durch einen neuen Vertrag wieder an seine Seite zu bringen. Es war der Rückversicherungsvertrag vom Jahre 1884. Als vier Jahre später russische Unterhändler mit dem Anerbieten einer Verlängerung dieses Vertrages in Berlin erschienen — da eben wurde Bismarck aus dem Amte gejagt. Seine Nachfolger aber schreckten davor zurück, „gleichzeitig mit fünf Kugeln zu jonglieren .
Damit war es eine Frage der Zeit geworden, wann sich auf der Landseite der Ring um Deutschland schließen würde. Aber noch stand ja, dank der von Bismarck sorgfältig gepflegten Beziehungen zu England, die See offen. Und wenn das Deutsche Reidi seine ganzen gewaltigen militärischen Kräfte auf die Landmacht vereinigte, dann konnte wohl ein Angriff selbst zwei so starker Gegner, wie es Frankreich und Rußland waren, als aussichtslos erscheinen. Um dieser unersetzbaren maritimen Deckung willen hatte Bismarck bei der Verteilung Afrikas viel weniger gefordert, als er bei der überragenden Position Deutschlands hätte verlangen können. „Meine Karte von Afrika ist in Europa. Hier liegt Frankreich, dort Rußland. Und dazwischen Deutschland.“ Vor allem hatte er sich beharrlich dem Aufbau einer Hochseekriegsflotte widersetzt. Und nun war, vor der Jahrhundertwende, England der „splendid Isolation“, die sich einer Vereinsamung näherte, müde und trachtete, die damals noch freundschaftlichen Beziehungen zu Deutschland in festere Formen zu bringen. Aber dem „neuen Kurs“ in Berlin gelang es, auch diesen letzten Trumpf zu verspielen. Es war die Zeit der ersten Hochblüte der nationalen Phrase, der „schimmernden Wehr“ und der „gepanzerten Faust“, und wer Vernunft predigte „biß auf Granit“. Man sah in Berlin in den britischen Anregungen ein Zeichen von Schwäche und winkte deutlichst ab. Wilhelm II. hatte gerade den Trumpf erfunden, seine von ihm mit Haßliebe bedachten britischen Verwandten auf ihrem eigensten Gebiet zu übertreffen: er griff nach dem Dreizack. Es kann hier nicht der ganze Komplex von verdrängten Wunschträumen und Schwächen, von hąlb verstandenen und falsch eingeschätzten Realitäten entflochten werden, der Wilhelm II. dazu drängte, das einzige mit wirklicher Konsequenz zu betreiben, das die letzte neutrale Weltmacht ins gegnerische Lager führen mußte: die Flottenrüstung. Aber der Wandelbare, Vielgestaltige freute sich der Rolle, die es ihm erlaubte, als „Admiral des Atlantik“ in Nikolaus II. den „Admiral des Pazifik“ zu begrüßen. Eines der vielen unglücklichen „Kaiserworte“! „Tölpel und Blinde machen mein Lebenswerk zuschanden“, hat der „Alte im Sachsenwald einmal gegrollt.
Diese Flottenpolitik, und der aus ihr entspringende Rüstungswettlauf, haben Deutschlands Einkreisung besiegelt; in der unabänderlich gewordenen politischen und der von vornherein unabänderlichen geographischen Lage des Reiches war sie eine geradezu verhängnisvolle Utopie. Sie war, wie der Weltkrieg erwies, auch ein schwerer militärischer Fehler. Die Artillerie und die Besatzungen der in Kiel und Wilhelmshaven vor Anker liegenden Hochseeflotten, hätten, „auf Landkriegswährung umgerechnet“, die Schlacht an der Marne und damit den ersten Weltkrieg für Deutschland entscheiden können.
Gegen diesen Hintergrund ist der Bericht zu halten, den Kapitän Widemann über seine, die Jahre 1907 bis 1912 umfassende Tätigkeit als deutscher Marineattache in London in diesem Buche gibt. Die Konferenz von Algeciras hatte bereits eine deutliche Konturierung der europäischen Lager gebracht — allmählich zeichneten sich für den Kundigen die künftigen Fronten ab. Wohl gab es noch Versuche zur Eindämmung des Rüstungwettlaufs. Aber das Geschlecht der Staatsmänner von übernationaler Geltung, der Metternich, Talley- rand, Nesselrode, Disraeli und Bismarck, war ausgestorben. Warner, wie die deutschen Botschafter in London, Graf Hatzfeld und Graf Wolff-Metternich wurden in der Heimat belächelt, mit Mißtrauen betrachtet. Widemann erfreute sich des besonderen Vertrauens Kaiser Wilhelms II. und des Großadmirals von Tirpitz, in deren Sinn er wirkte. Dies brachte ihn in Gegensatz zum Reichskanzler von Bethmann- Hollweg, der die Flottennovelle von 1912 zu verhindern suchte. Bethmanns verzweifelten Ausruf: „Sie bringen uns (mit der Novelle) den Krieg“, möchte man rückschauend wohl kaum (wie Widemann, S. 187) als „jämmerlichen Angstausbruch“ bezeichnen. Wie stark Bethmann unter einer Zwangslage litt, geht aus einem anderen Zitat Widemanns (S. 210) hervor: „Eigentlich ist die ganze Politik derart, daß ich sie nicht mitmachen kann. Aber ich frage mich immer wieder, ob ich die Situation nicht noch gefährlicher gestalte, wenn ich jetzt gehe.“ Widemanns Darlegungen der Flottenbeziehungen Deutschlands zu England sind gründlich, fachkundig und anschaulich. Und auch wer die Tirpitzsche Flottenpolitik, gerade vom Standpunkt Deutschlands und im weiteren Sinne Europas, bedauert, wird die Informiertheit und Fairneß des Autors anerkennen, wie dies auch von britischer Seite vor und nach dem ersten Weltkrieg geschehen ist. Leider stören eine Reihe von Schreib- und Druckfehlern die Lektüre.
Fliegen — Mein Leben. Von Hanna Reit sch. Pilgram-Verlag, Salzburg. 312 Seiten.
Die bekannte Segelfliegerin Hanna Reitsch erzählt hier ihre Lebensgeschichte. Das Buch ist somit ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des deutschen Segelfluges. Doch Hanna Reitsch hat nicht nur als erste Frau sehr wichtige Pioniertaten für den Segelflug gesetzt, sondern auch vor und während des zweiten Weltkrieges als Versuchsfliegern! vor allem der V-Waffen eine Rolle gespielt, welche die kleine Studentin aus Hirschberg in Schlesien wohl kaum bei Beginn ihrer sportlichen Laufbahn ahnen konnte. Dieser Teil ihres Lebensberichtes ist leider für die Geschichtsschreibung wertlos, ja zum Teil gefärbt. Es sei nur mit einem Satz darauf hingewiesen, daß Frau Reitsch als eine der wenigen Augenzeugen die letzten Tage in der Reichskanzlei anläßlich ihres Fluges nach Berlin erlebte. Ihr Bericht über die letzten Tage der deutschen Luftwaffe und die Rolle, welche der Kreis um Feldmarschall Greim dabei spielte, wird stark korrigiert durch die bereits 1945 veröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen des letzten Generalstabschefs der Luftwaffe, General Koller, welche Frau Reitsch offenkundlich nicht beachtet hatte.
Jakob Stainer, der Geigenmacher zu Absam.
Die Lebensgeschichte nach urkundlichen Quellen. Von Walter Senn. Sehlem-Schriften. 87. Band. Herausgegeben von R. Klebeisberg. Universitälsverlag Wagner, Innsbruck 1951. 138 Seiten.
Auf Grund des ziemlich weithin zerstreuten Urkundenmaterials zeichnet der Verfasser das Wirken des großen Tirolers, des Gründers und unerreichten Meisters des deutschen Geigenbaues, Jakob Stainer (1617? bis 1863). Bisher lagen nur kleinere Abhandlungen über den Absamer Geigenmacher vor, die sowohl die Lebensgeschichte des Meisters als auch die Beschreibung und Beurteilung seiner Instrumente verzeichnet und irrig Wiedergaben. Diese geschichtlich einwandfreie Untersuchung ist nicht nur ein Gebot der wissenschaftlichen Forschung — das Leben und Wirken der großen italienischen Geigenbauer wurde in mehreren Veröffentlichungen bereits gewürdigt —, sondern eine Dankesschuld und Anerkennung des großen Tiroler Meisters. Eine weitere Publikation über Stainers Instrumente sowie eine Abhandlung „Stainer und die Literatur stellt der verdienstvolle Verfasser in Aussicht.
Die Geburt Christi. Eine Trilogie der Deutung. Von Ludolf K a ß n e r. Eugen-Rentsch- Verlag, Erlenbach-Zürich.
Auch in diesem Werk Rudolf Kaßners begegnen wir einem Metaphysiker ganz seltener Prägung, der auf sehr persönlichen Wegen zu einzelnen Schlußfolgerungen der „Philosophie du sens commun“ gelangt. Für den Durchschnittsleser ist es schwer, diesem Denker zu folgen, weil er sich nicht der üblichen Kategorien bedient und sich auch eine eigene philosophische Terminologie geschaffen hat. Im Anfang vermutet man in ihm einen modernen Gnostiker, aber bald glaubt man, bei ihm einige Ansätze einer philosophia christiana zu entdecken. Die außerordentlich klare und schöne Sprache verleitet den ahnungslosen Leser zu der Annahme, daß er die Gedankengänge versteht, aber immer wieder stellt sich heraus, daß Kaßner ihn im Stich gelassen hat, so daß am Schluß nur noch vereinzelte wunderbare Axiome und Sätze übrigbleiben, die wie ungefaßte Edelsteine glänzen, Eindrucksvoll ist der dritte Aufsatz mit dem Versuch eiher „Metaphysik“ des ideologischen Eisernen Vorhangs.
Aus dem Kampf um die Schule. Von P. Peter Friedrichs S. J. (Das christliche Deutschland 1933 bis 1945, Katholische Reihe, Heft 11), Herder, Freiburg 1951.
An Hand einer geschlossenen Reihe von Dokumenten und Verhandlungsberichten aus den Jahren 1936 bis 1940 wird der Kampf des nationalsozialistischen Deutschland gegen die Privatschulen an dem konkreten Fall des Abbaues des Gymnasiums am Lietzensee in Berlin-Charlottenburg aufgezeigt. Einerseits soll hiedurch die Öffentlichkeit Deutschlands wie auch des Auslandes ein richtiges Bild von den Methoden und der Taktik bekommen, mit denen man damals, ohne auf die zugrunde liegenden weltanschaulichen Gegensätze einzugehen, den Kampf nur im formalrechtlichen Bereiche auszufechten versuchte, wobei es bewundernswert ist, mit welcher Tatkraft die Verhandlungen von kirchlicher Seite betrieben wurden, andererseits werden aus der vorliegenden Darstellung manche Vorkommnisse im derzeitigen Schulwesen Ostdeutschlands verständlich, die ganz deutlich zeigen, daß der Kampf um die Privatschule noch nicht beendet, sondern nach der nationalsozialistischen Ära nur in ein neues Stadium getreten ist. Der Fall des Gymnasiums Lietzensee ist nur ein Beispiel unter vielen in der Kette jener Maßnahmen, deren Ziel die Ausrottung der katholischen Kirche in Deutschland sein sollte, ein Beispiel aber auch dafür, daß ein solcher Versuch an dem Glaubenseifer und der Treue der katholischen Bevölkerung scheitern mußte.
Geschichte von morgen. Von Curzio Malap.arte. Stahlberg-Verlag, Karlsruhe, 210 Seiten.
Der sehr ernste „utopische“ Hintergrund dieser „realistischen Satire“ (wie der Untertitel lautet) ist dieser: der europäische Kontinent ist von den Russen überrannt. Schwedens Neutralität wurde respektiert, in Spanien wird noch gekämpft. Das übrige Europa ist sowjetisiert. Auf den heftigsten Widerstand stießen die Eroberer in der Alpenreduite, nachdem sie von Württemberg und Vorarlberg in der Schweiz einmarschiert waren. Die Kommunisten in den eroberten Ländern haben nichts zu lachen: sie werden Opfer der Säuberungsaktionen und der sowjetischen Staatsraison. Auch Italien steht unter russischer Herrschaft. Und hier beginnt die Satire. Alle bekannten Politiker leben noch: De Gasperi, Togliatti, Einaudi, der Polizeiminister Scelba und Missiroli, der das Problem der verschiedenen Säuberungen dadurch löst, daß er — ein alter und eingeschworener Gegner aller Menschen, die für oder gegen etwas ßind — alle Politiker und Parteigänger einsperren läßt: Kommunisten und Antikommunisten, Faschisten und Antifaschisten … Auch ist es den Italienern gelungen, den russischen Kommunismus zu assimilieren, so auch den Stachanowismus. Die menschlich-zivilisierte Parole des italienischen Dopolavoro proletario lautet: „Erst Erholung, dann Arbeit.“ In dieser Art wird von Malaparte das makabre Thema behandelt: mit kabarettistischem Witz, Zynismus, Ironie. Am meisten wird derjenige von der Lektüre haben, der die innerpolitischen Verhältnisse des heutigen Italien genauer kennt und infolgedessen auch die vielen Anspielungen und Seitenhiebe Malapartes versteht,
Das schwarze Kreuz im Acker. Roman. Von Karl Emil Franzos, österreichische Buchgemeinschaft, Wien.
Mit dieser Dorfgeschichte, umrahmt von eindrucksvollen Schilderungen der urtümlichen Karpatenlandschaft, hat Karl Emil Franzos (1848—1904) nicht nur seiner Heimat ein literarisches Denkmal gesetzt, sondern auch ein Charakter- und Sittengemälde geschaffen, dem die Zeit nichts anhaben kann. Der Roman behandelt das Problem, das sich aus dem Widerstreit zwischen dem Recht an sich, also dem Begriff der göttlichen Gerechtigkeit, und dem, was jeden einzelnen Menschen von seinem individuellen Standpunkt aus recht und gerecht zu sein dünkt, immer aufs neue ergibt. Deshalb fand diese Erzählung, die im Jahre 1882 unter dem Titel Ein Kampf ums Recht“ zum erstenmal erschien, den Beifall hervorragender Persönlichkeiten, wie des Rechtsphilosophen Ihering, des Kulturhistorikers Johannes Scheer, der österreichischen Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach und des englischen Premiers Gladstone. In der Neubearbeitung von Oskar Maurus Fontana hat diese literarisch bedeutsame Erzählung gerade unserer heutigen Generation viel zu sagen.
Ärztliche Weltanschauung. Von Hans Schwarz. Verlag W. Maudrich, Wien 1951. 213 Seiten. S 64.—.
Im Vergleich mit dem inhaltlich verwandten Buche von Kneucker Richtlinien einer Philosophie der Medizin’ zeigt dieses Buch den Forschritt, den die universalistische Betrachtungsweise in der Medizin innerhalb weniger Jahre gemacht hat: von der positivistischen und mechanistischmaterialistischen Auffassung, die Kneucker sogar das Wort „Seele“ geflissentlich vermeiden läßt, bis zu jener, die das Buch von Schwarz erfüllt. Schwärz kommt darin dem alten hippokratischen Ideal des philosophischen Arztes nahe. Von verschiedenen Seiten her mehren sich die wissenschaftlichen Beiträge zu einer universalistischen Medizin, es seien hier nur die Namen Tournier, Weizsäcker, Siebeck und andere erwähnt.
Schwarz geht den Problemen auf den Grund. Daher lehnt er den .Evolutionismus“ ab, der zu einem falschen Menschenbilde geführt hat. Auf der Grundlage einer universalistischen Anthropologie gelangt der Verfasser zu einer vertieften Grundlegung der ärztlichenEthik.
Am Schlüsse setzt der Verfasser sich mit den beiden großen Erlösungsreligionen auseinander: dem Christentum und dem Buddhismus. Beiden gemeinsam ist die den Arzt bewegende Frage nach dem Sinn des Leidens. Schwarz charakterisiert die beiden verschiedenen Antworten auf diese Frage treffend. Der abendländische Leser kann leicht entscheiden, welche Antwort ihn mehr befriedigt: die buddhistische oder die christliche.