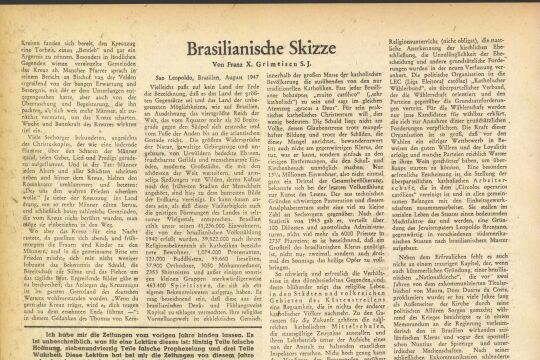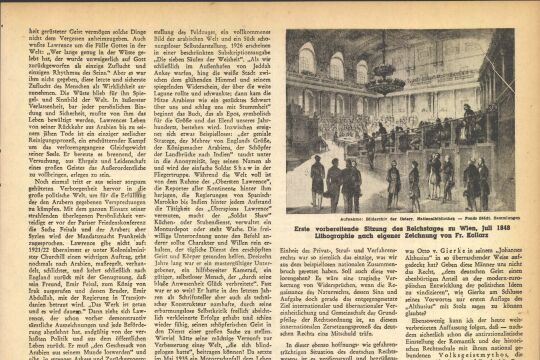Seit vor mehr als einem Jahr der englische Historiker Professor Geoffrey Barrac- 1 o u g h — der vor kurzem auch eine bemerkenswerte Geschichte Deutschlands veröffentlichte — in einem Rundfunkvortrag die Frage aufwarf „G i b t e s e i n e ,a b e n d- ländische Überlieferun g’?“, ist dieses Problem von den bekanntesten englischen Forschern und Denkern im britischen Rundfunk von allen möglichen Seiten behandelt worden. Die abschließenden Vorträge hielten nunmehr Lord Rüssel und Arnold T o y n b e e. Aber während der Philosoph Rüssel für die Zukunft Europas einen neuerlichen Triumph von Toleranz und wissenschaftlichem Denken erhoffte, kehrte im letzten Vortrag der Universalhistoriker Toynbee wieder zu der von Barraclough aufgestellten These zurück, daß es eine abendländische Überlieferung überhaupt noch nicht gäbe. Denn, wie der Titel seines im „Listener“ vom 30. September abgedruckten Vortrags lautete: „Eine aben.dländischeTradition ist erst im Werden.“
Alle Sprecher hätten das wesentliche Merkmal der westlichen Überlieferungen in der individuellen Freiheit gesehen, mit zwei Ausnahmen, von denen einer Taylor die europäische Geschichte nicht als eine Entwicklung zu individueller Freiheit, sondern zum „Totalitarianismus“ betrachtete, während der andere Canon Demant darauf hinwies, daß der Westen in neuerer Zeit nicht Freiheit, sondern Technologie in die übrigen Weltteile exportiert habe.
„Das Gesetz und die freien Institutionen, auf die der Westen so stolz ist, erwuchsen, wie er uns erinnerte, in einem moralischen Klima, das vom Christentum geschaffen wor- den war, doch die Technologie, die ein Nebenprodukt von Gesetz und Freiheit gewesen, ist abgelöst worden von dem religiösen und kulturellen Boden, auf dem das westliche Gesetz und die westliche Freiheit erwuchsen. Ünsere Technologie ist losgelöst worden, und da sie getrennt von ihrer ursprünglichen geistigen Herkunft verbreitet wurde, ist sie destruktiv geworden.“
Toynbee gesteht, daß er mehr mit diesen beiden kritischen Ansichten als mit den allzu optimistischen der anderen Redner übereinstimme.
„Gibt es so etwas wie die abendländische Überlieferung“? Es gibt, dessen bin ich sicher, eine christliche Überlieferung; aber wenn Mr. Christopher Da ws on sagte, daß die abendländische Tradition nicht mehr noch weniger sei als die Tradition des Christentums, so fand ich, daß ich hier, soweit ich mich erinnern kann, zum erstenmal nicht mit ihm übereinstimme. Ich möchte vor allen anderen Dingen gerne gerade darin mit ihm übereinstimmen, aber ich kann seine Gleichsetzung von .westlich“ und .christlich“ nicht mit den Tatsachen, wie ich sie sehe, in Einklang bringen. Ich glaube nicht, daß es jemals eine abendländische Überlieferung gegeben bat; ich glaube vielmehr, daß es immer ein abendländisches Schlachtfeld gegeben hat, auf dem eine christliche Überlieferung und eine damit unvereinbare heidnische Überlieferung um die Herrschaft über die abendländischen Seelen gekämpft haben. Die Geschichte dieses Kampfes ist, wie ich meine, die Geschichte des Abendlande s.“
Die abendländische Menschheit hätte die Welt nicht mit einer neuen Sicht GotteSj sondern mit einer dämonischen Technik unterworfen, einer Technik, die als Preis für ihre Beherrschung den Verkauf der menschlichen Seele fordere. Dadurch aber hätten wir vielleicht unser Erstgeburtsrecht verkauft.
„Wir Menschen des Abendlandes schulden alles, was wir sind und was wir erreicht haben, dem Christentum. Wenn christliche Missionäre nicht gekommen wären, um uns das Evangelium in diesem abgelegenen Winkel Asiens zu predigen, der unsere Heimat war und noch ist, so würden wir der Welt gewiß nie unseren Stempel aufgedrückt haben. Halbvergessene christliche Tugenden liegen an der Wurzel nicht nur unserer wertvollen Freiheiten, sondern auch unserer schrecklichen Macht. Das Christentum war die Gelegenheit des Abendlandes, aber der Mensch ist immer frei, seine Gelegenheiten wegzuwerfen; und wir Abendländer haben unter der ständigen Versuchung gelebt, uns abzuwenden von der Anbetung des Gottes, dessen göttliche Gewalt uns im Christentum als selbstaufopfernde Liebe offenbart wurde. Wir waren versucht, in die Verehrung eines alten Götzen namens Leviathan zurückzügleiten — des Götzen einer kollektiven menschlichen Macht, die sich nicht als Liebe, sondern als organisierte brutale Gewalt offenbart. Wir haben die Freiheit, unsere Seelen dem Leviathan zu verkaufen; und wenn wir sie schließlich verkaufen, so wird das nicht das Begräbnis des Christentums, wohl aber unser eigenes sein. Das Christentum kann für sich selbst sorgen. Eine christliche Überlieferung bestand, bevor man von unserer abendländischen Kultur hörte, und ich persönlich hege keinen Zweifel, daß das Christentum noch die geistige Kraft sein wird, die es ist, auch wenn diese unsere westliche Kultur untergehen sollte. In der Geschichte einer Religion, deren Sendung es ist, alle Nationen zu erreichen und das Evangelium jeglichem Geschöpf unter dem Himmel zu predigen, muß das abendländische Christentum, das für uns Menschen des Abendlandes die ganze Welt bedeutet, nicht mehr sein als ein örtlicher und zeitlicher Rastplatz."
Die Worte, die Paulus und Barnabas nach der Apostelgeschichte zu den Juden von Antiochia sprachen, könnten in unserer Generation vielleicht zu uns gesprochen werden: „Siehe, wir wenden uns ab von euch westlichen Ex-Christen zu den Indern und Chinesen.“
„So scheint es mir, als ob das Abendland heute in einer Waage gewogen würde. Es gibt eine christliche Überlieferung, mit der die Zukunft ist, aber es gibt keine abendländische Überlieferung — noch nicht. Die abend- ländiche Überlieferung ist noch im Werden, und ihr Werden ist in unsere Hand gegeben. Wir können sie christlich machen oder wir können sie heidnisch machen. Der Kampf geht weiter. Es hängt von uns ab.“
„Eine Frage Europas an die Engländer“ enthält die in Stuttgart erscheinende Zeitschrift „Christ u n d W e 11" 2. Oktober. Das Blatt geht aus von der Zurückhaltung der führenden Männer der englischen Labour-Regierung gegenüber den Plänen einer europäischen Föderation, wobei Attlee und Bevin vor allem auf die in diesem Monat zusammentretende Empirekonferenz verwiesen haben.
„Die Motive der Labour-Partei sind häufig aus der zu Churchill bestehenden Konkurrenz abgeleitet worden. Es mag sein,
daß solche Komplexe eine Rolle spielen, die sich auch auf anderen Gebieten zeigen. Aber kann man das Labour-Kabinett für so subjektiv halten, daß es allein aus parteitaktischen Erwägungen unzugänglich für moderne außen- . politische Ideen geworden wäre? Amerikanische Beobachtungen mögen mehr ins Gewicht fallen, die die ablehnende Haltung der Labour- x Politiker gegen europäische Pläne darauf zurückführen, daß die Planwirtschaft in England die Einfügung des halbsozialisierten britischen Wirtschaftssystems in ein größeres Ganzes sehr erschwere. Diese amerikanischen Kritiker folgern, daß jede sozialistische Wirtschaft einen nationalistisch-abschließenden außenpolitischen Kurs nach sich ziehen muß, weil der komplizierte Mechanismus der Planung und Wirt-schaftssteuerung keinerlei Einbuße der einzelstaatlichen Souveränität gestattet, sondern im Gegeneil zu einer Übersteigerung der staatlichen Hoheit führt. Jeder Sozialismus, so folgern die Amerikaner, führe zum ,Nationalsozialismus“, und auch bei der Labour-Party sei dies nicht anders, die früher der Hort internationaler Gedankengänge gewesen sei.“ Warnende Stimmen wiesen darauf hin, daß die doch nicht unbegrenzte Marshall-Hilfe den Sinn hatte, „eine europäische Selbsthilfe in die Wege zu leiten, die mit einer engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Mar- shall-Länder beginnen muß, was ohne einen politischen Rahmen nicht möglich ist, wie die Schwierigkeiten bei der Verteilung des Marshall-Etats recht drastisch gezeigt haben“.
Vier objektive Schwierigkeiten stünden der Idee eines europäischen Zusammenschlusses heute vor allem entgegen: die machtpolitische Konstellation, die wirtschaftliche Zerreißung Europas durch den Eisernen Vorhang, die fortbestehende Haßpsychose, die der Hitler-Krieg gegen Deutschland erzeugt habe, und schließlich die Dauergefahr kommunistischer Sabotage in Westeuropa.
„Keine dieser vier hauptsächlichen Schwierigkeiten, denen die Verwirklichung einer europäischen Union begegnet, ist unüberwindlich. Die 300 Millionen Europäer, zu denen weitere 100 Millionen Menschen hinzukommen, die in den afrikanischen Kolonien Westeuropas leben, sind ein so gewaltiger Faktor, daß es wohl nie zu einer Kraftprobe mit der Sowjetmacht käme, wenn sie unter amerikanischer Garantie zusammengeschlossen wären." Dieselbe Nummer der vom Evangelischen Verlagswerk herausgegebenen Zeitschrift enthält einen Beitrag von Dr. Eugen Gersten- m a i e r, dem Leiter des Evangelischen Hilfswerkes, unter dem Titel „K i r c h e im Ghetto? — Kirche in der Welt“, worin die Notwendigkeit eines aktiven Wirkens in der Welt gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt betont wird.
„Es ist das Vorrecht der Christen, Wunden zu verbinden, Barmherzigkeit zu üben und Trost zu spenden. Aber es ist nicht minder das Recht, ja die Pflicht der Christenheit, dem Streit zu wehren, Wunden zu verhindern, für die Gerechtigkeit in den Kampf zu gehen und verzweifelte Lebensbedingungen zu, Lebens- möglichkeiaten zu wandeln. Es ist ein spezifisch männlicher Dienst, der dafür gefordert ist, und es ist kein Zufall, daß unsere Diakonie des Heilens und Verbindens im wesentlichen von Frauen geübt wurde und geübt wird Ob wir es wollen oder nicht, das Politische ist unser Schicksal, das Schicksal unserer Zeit, unserer Generation und der kommenden, das Schicksal unserer Kultur, unseres Lebens. Kirche und Öffentlichkeit begegnen sich heute weit mehr im Medium des Politischen als im Medium des Kulturelle n.“ „
Das Oktoberheft von „La Revue Hommes ‘et Mondes“ bringt einen Artikel von R. M. Alix, „Deutsches S c h i c k s a 1“, der die bisherige Deutschlandpolitik der Alliierten einer scharfen Kritik unterzieht und ihr völliges Scheitern feststellt.
„Man muß Europa schaffen, man muß es großzügig errichten, ohne zu feilschen, ohne zu zaudern. Ein Europa, wo das siegreiche Frankreich Deutschland die friedliche Erfüllung seiner Ziele bieten kann, ein für die Deutschen offenes Europa, ein Europa ohne seine veralteten und dummen Grenzen; Europa ist der Friede. Wenn sich die Einheit der Deutschen in einem freien und großmütigen Europa erfüllt, wenn die deutsche Ausdehnung sich im Schoße eines Europa vollziehen kann, das die Arbeit und den Fortschritt anerkennt und lohnt, dann werden wir nicht mehr befürchten müssen, die wilden Gesänge der gefangenen Walküre wieder zu hören. Europa schaffen heißt dem Pangermanismus jede Rechtfertigung, jeden Vorwand nehmen. Man muß zu wählen wissen: entweder wir vernichten, um die deutsche Zukunft zu zerbrechen, die Deut- sehen oder, im Gegenteil und weniger utopisch, wir versuchen, dieses Paradoxon zu verwirklichen: daß alle Deutschen sich vereinigt fühlen können, ohne daß die Einheit Deutschlands jemals verwirklicht wird. Kurz, die Ära der Menschen eröffnen und jene der Nationen schließen.“
Dasselbe Heft enthält unter dem Titel „Blick über die Welt“ einen Beitrag des ehemaligen französischen Ministerpräsidenten Pierre-Etienne F 1 a n d i n, der nach einem Rundblick auf die politische, wirtschaftliche und soziale Weltlage feststellt, daß trotz unleugbarer Besserung, vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet, die Bilanz im ganzen doch noch passiv ist. An die Stelle der nationalen seien vor allem soziale Kämpfe getreten.
„Der Krieg hat den europäischen Nationalismen einen furchtbaren Schlag versetzt. Der Untergang des Hitlerismus und des Faschismus, dieser beiden Formen des deutschen und italienischen nationalistischen Paroxysmus, das Zurückweichen der britischen Weltmacht und der brutale Absturz Frankreichs, das allgemeine Gefühl einer notwendigen Revision des Begriffs der nationalen Souveränität in der erweiterten Form’ einer europäischen Föderation, die weitverbreitete Überzeugung der eigenen Ohnmacht, sich gegen das Übergewicht der amerikanischen und russischen Kräfte zu verteidigen, haben die national Zusammengehörigkeiten Europa geschwächt. Die nationalen Gemeinschaften in Europa lösen sich auf, da sie das Vertrauen in die Zukunft einer bevölkerungspolitischen oder territorialen Expansion selbst in der Form eines Imperiums verloren haben und sfch nicht mehr im Schutz von Grenzen fühlen, die zumindest zu verteidigen, wenn schon nicht unverletzbar sind. Die materiellen E r ob e r u n g e n erscheinen den Völkern im’ Innern der Staaten verlockender und sicherer. Der Kampf der Klassen ist an die Stelle der nationalen Kämpfe getreten."
Nichts sei leichter, als bei den Unzufriedenen, und, das sei immer die große Mehrheit, das Gefühl zu erregen, daß sie aüsgebeutet würden. Außerhalb Europas aber, wo der europäische Beitrag bewußt oder unbewußt vergessen, die Rolle des Europäers mehr und mehr unterschätzt, die des .Eingeborenen überschätzt würde, entwickle sich der Klassenkampf zum Kampf der Rassen. Das Ergebnis sei hier wie in Europa die Auflösung der bestehenden Ordnung. Europa und Frankreich hätten jedoch noch eine Aufgabe, zu deren Erfüllung allerdings in erster Linie eine Wiederherstellung, des Vertrauens und der Ordnung nötig sei.
„Die Unordnung der Geister ist viel schwerwiegender als die Unordnung der Dinge. Selbst wenn man die letztere abstellen könnte, würde die Fortdauer der ersteren bald aufs neue die Beziehungen der Bürger zum Staat und die der Bürger untereinander verwirren und dadurch zu neuer Unordnung führen. Es gibt eine Hierarchie der Ordnung. Die moralische Ordnung bestimmt alle anderen. Ungerechtigkeit und Unbilligkeit stören die Funktionäre tyrannischer Regime kaum, da sie durch die Furcht herrschen. Dort aber, wo der als frei erkannte Bürger seine freiwillige Mitarbeit zur politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ordnung leisten soll, die auf der Abstimmung seiner Pri- yatdnteressen mit dem allgemeinen Interesse beruht, dort darf nichts sein Gefühl für Gerechtigkeit und Billigkeit verletzen. Diese Regel aussprechen heißt das, was in Frankreich geschieht, verurteilen. Der Staat "besteht nicht mehr, weil ihn die Parteiungen zerstückelt haben. Der Nation droht dasselbe Schicksal, und selbst das Volk wird zerrissen werden, wenn aus dem französischen Bewußtsein nicht eine neue Verbindung von Tradition und Fortschritt erwächst, die jedem die Frucht seiner Anstrengung und den Lohn seiner Arbeit gewährt in der erweiterten europäischen Solidarität der Arbeit, der Technik und des Geistes der Freiheit.“
Die von Francesco Flora in Mailand herausgegebene Monatsschrift „La Ra s- s e g n a d’ Italia“ enthält neben einem Essay des englischen Dichters Stephen Spender über „Das Modernein der modernen Dichtung“ und einem Aufsatz von Arminio Jauner über „Burckhardt und Italien“ eine kritische Untersuchung von Raffaello F r a n- chini „Über den methodologischen Begriff einer Geschichte der Philosophie“, worin sich der Verfasser gegen jeden Versuch einer von der allgemeinen Geistesgeschichte getrennten Philosophiegeschichte wendet.
„Eine Geschichte dar Philosophie, selbständig und unterschieden von den anderen Formen der Geschichtsschreibung, ließe sich nur rechtfertigen, wenn man das Denken als einzige Realität anerkennen und so beim Panlogismus stehenbleiben wollte. Aber es ist klar, daß die methodologische Konzeption der Philosophie, direkte Folge und zugleich Voraussetzung des Studiums der geistigen Formen, der Geschichte des Denkens einen Sinn und eine Dialektik der Entwicklung verleiht, der- zufolge jeder Denker nur in der Geschichte zu verstehen ist, als ein Augenblick der moralischen und politischen Geschichte. Kann man zum Beispiel das Studium Hegels von dem der deutschen Romantik trennen? …“
Gewiß werde sich eine so aufgefaßte Geistesgeschichte nach Betonung und Fragestellung deutlich etwa von einem Werk der politischen Geschichte unterscheiden, „aber dieser Unterschied, das ist klar, liegt auf der Ebene der Quantität und nicht auf jener der Qualität“.
Ausgehend von der Sonderschau der französischen Impressionisten in Venedig, sucht in derselben Zeitschrift Francesco A r c a n g e 1 i den entscheidenden Beitrag des Impressionismus zur Kultur unserer Zeit zu bestimmen:
„Unsere Kultur und unsere Teilnahme an einer seelischen. Wandlung, durch welche die Bedeutung des menschlichen Handelns viel beweglicher geworden ist und eine unendliche Ausstrahlung in’ die Welt offenbart, eine im-mer innerlichere und beseeltere Auffassung von der Natur, das Gefühl eines ewigen Hin- und Herfließens zwischen uns und dem Wfeltall, all das wird uns nicht mehr gestatten, zu dem verlorenen Paradies der griechisch-römischen Klassik oder der italienischen Renaissance zurückzukehren. Selbst wenn wir keineswegs ausschließen, daß auch ein zeitgenössischer Künstler noch der Mittelpunkt formaler Beziehungen und eines vollendeten Gleichgewichts werden kann, so würden wir , uns dennoch sehr ferne von ihm fühlen, wenn wir innerhalb dieser Gemessenheit nicht gewisse Schwingungen spüren würden, seien sie auch langsam und tief, die dort geboren sind, wo jene Gemessenheit nicht mehr gilt. Das ist unsere ehrliche Überzeugung, und deshalb fühlen wir, daß der Impressionismus kein Abschluß ist, sondern ein füt immer geöffneates Fenster zu einer neuen menschlichenbimen- ion.“