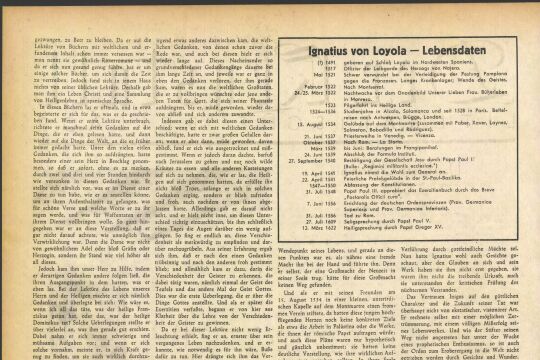Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Aus der Mappe eines Weisen
Aus Spinoza-Renaissance (Jänner 1933) zu den Spinoza-Schriften von Stanislaus von Dunin-Borkowski S. J.
Der Spinozismus hat zweifellos durch die Jahrhunderte, die sich kämpfend mit ihm auseinandergesetzt haben, eine läuternde Wirkung auf den Gottesbegriff unzähliger, auch wirklich frommer Menschen geübt, so daß er reiner, von anthropomorphen Zutaten freier, größer, erhabener und unserer ausgeweiteten Naturerkenntnis angemessener geworden ist.
Bei diesen Arbeiten des gelehrten Jesuiten ist vor allem die große Ehrfurcht hervorzuheben, mit der er dem Menschen und Denker Spinoza und der Aufrichtigkeit seines Wahrheitssinnes begegnet. Das ist nicht Taktik, um dann um so eindrucksvoller bekämpfen zu können, es ist lautere Liebe zum Gegenstand sowohl der biographischen als auch der philosophisch-kritischen Bemühungen. Der herkömmliche apologetische Beigeschmack fehlt diesen Büchern ganz . . . Innerhalb der katholischen Literatur ist das ein schöner, nicht genug zu preisender Gewinn. Einem allzu nachsichtigen Kult wird der Verfasser trotzdem nicht verfallen, wie beispielsweise diejenigen, die sich heute noch immer fürchten, Spinozas auf Unkenntnis beruhende Urteile über gewisse christliche Dogmen und über große Denker wie Piaton und Aristoteles deutlich einzugestehen und als Schwächen zu bezeichnen, die sie zweifellos sind. Im Gegensatz hiezu nimmt er Spinoza gegen diejenigen seiner Gegner in Schutz, die ihn einen Atheisten nennen, und seiner Beteuerung, es sei ein Irrtum zu glauben, er habe Gott und die Natur als ein und dasselbe erklärt, keinen Glauben schenken, indem er schreibt: „Es ist kritisch und psychologisch sinnlos, mit einigen modernen Interpreten anzunehmen, diese Worte Spinozas seien eitel Geflunker; im Grunde sei er dennoch Atheist und Materialist gewesen. Das heißt ihn zum Lügner stempeln.“
Daß der Philosoph die christliche Lehre des Dogmas nicht glaubt und erklärt, er verstehe nicht, was es heiße, „Gott habe die Menschennatur angenommen“, was für ihn gerade so widersinnig ist, als wenn man sage, der Kreis habe die Natur des Quadrats angenommen, beweist, daß er, der hier eine Wesensverwandlung annahm an Stelle einer hypostatischen Vereinigung, die christliche Lehre und Spekulation trotz seiner katholischen Jugend nicht kannte.
Aus: Richelieu (Oktober und November 1935).
Erst nach den moralischen und wirtschaftlichen Erschütterungen des Weltkrieges von 1914 bis 1918 fing man an, den Politiker an sich zum, Gegenstand von Untersuchungen zu machen. Mit jener empiristisch-positivistischen Methode, die man auf anderen Gebieten als unzureichend eingeschränkt, ja aufgegeben hat, versuchte man nunmehr den Begriff des Politischen neu zu fassen, mit anderen Worten, aus den aktuellen Zuständen der politischen Praktiken abzulesen, was Politik überhaupt sei. Was aber wird mit solchen Abstraktionen erreicht? Das Politische wird vom Moralischen getrennt, es gibt keine Moral in der Politik mehr, es gibt nur noch eine Politik auch in der Moral, das heißt Überzeugungen, wie weit such moralische Argumente und Motive geeignet seien, die Zwecke der Politik zw fördern.
Heute, da das Religiöse entpolitisiert, das heißt aus den Verwicklungen der Politik und der unmittelbaren Mitverantwortung herausgelöst ist, um auf dem geradesten Weg, den es gibt, nämlich durch den der Religion in ihrer reinen Form zurückgewonnenen Menschen, alles politische Wesen mit der Zeit wieder heil und gesund zu machen, verstehen wir es vielleicht besser als je, daß wie im Einzelleben, so auch in der Geschichte ohne den Begriff der felix culpa nicht auszukommen ist...
Die Religion hatte in den „Religionskriegen“ als einigende Macht versagt, und so griff man zu einem anderen Glauben, der aber Europa von da an noch tiefer zerspellte, zum Glauben an die nationale Berufenheit, bei dem jedes einzelne Volk für sich und gegen jedes andere steht. Richelieu hat die Religion dem Gedanken der Nation untergeordnet und damit die Idee einer Glaubenseinheit in Europa endgültig zerstört. Ein hugenottischer Franzose galt ihm mehr als ein katholischer Spanier: in dieser Formel vollzog er die Lossagung von einem im Glauben geeinigten und befriedeten Europa . . .
Das Rätsel dieses Mannes (des Kapuzinerpaters Joseph) zu lösen, gibt es keinen anderen Weg, als in ihm und dem Kardinal ein Werkzeug der Vorsehung zu erblicken mit der tragischen Mission, die Loslösung der katholischen Sache und der Kirche aus den politischen Verstrickungen vorzubereiten und die innere Unverträglichkeit des Reichgottesgedankens und seiner Bindungen an die machtpolitischen Streitigkeiten der Welt schicksalhaft darzutun.
Aus dem Nachruf auf Peter L i p p e r t S. J. (Feber 1937).
Er war kein apollinischer, er war vielmehr ein äsopischer Mensch der äußeren Hülle nach, aber er war ein Mensch von hohen geistigen Graden, ein ganz ungewöhnlicher Mensch, und da er Priester war, auch ein“ ganz ungewöhnlicher Priester, und da er Jesuit war, auch ein ganz ungewöhnliches Mitglied seiner vielgestaltigen „Gesellschaft Jesu“. Er fiel gleichsam aus allen diesen soziologischen Kategorien heraus und war dennoch, was er war, immer ganz, aber in seiner Art.
Er wußte, daß man ihn einen Pessimisten nannte, und 'ächelte darüber. Unvergeßlich ist mir, wie er nach einem Vortrag, den ich, von der Studentengruppe „Südmark“ eingeladen, in München über das Thema „Katholische Aktion und der Student“ hielt, als erster an mich herantrat, mir die Hand drückte und äußerte: „Sie haben vollkommen recht, und ich danke Ihnen. Wenn ich das gleiche gesagt hätte, man hätte wieder einmal über den Pessimisten die Achsel gezuckt.“ Der Vortrag, der sechs Jahre zurückliegt, schloß nämlich mit einem Ausblick auf die nahe Zukunft, auf das, was heute Gegenwart ist, und fand den Sinn der Katholischen Aktion in einer innerlichen Vorbereitung auf das Martyrium als die letzte Besieg elung des Bekennertums.
Aus „F e“ n e 1 o n“ (Jänner und Feber 1938).
(Gründe der Ablehnung Fenelons im nationa-listisdien Frankreich.)
. .. wir haben die Action Francaise erlebt mit ihrer Revision der Geschichte aus dem Geiste eines Nationalismus, der sich nicht scheute, von den entnervenden und schwächenden Einflüssen des Christentums zu sprechen, und in dem sich vorbereitete, was wir heute vor Augen haben. (Zu Fenelons „Abenteuer des Telemach“.) So berückend auch die Idee der Monarchie darin vorgetragen und verherrlicht war, Sätze wie die folgenden genügten, daß jedermann die Anwendung auf den Absolutismus Ludwigs XIV. machte: „Wenn die Könige allmählich kein anderes Gesetz mehr gelten lassen als il.ren unbeschränkten Willen und ihren Leidenschaften keine Zügel mehr anlegen, so vermögen sie alles; aber durch diese Allmacht untergraben sie die Grundpfeiler ihrer Herrschaft, sie entbehren der festen Regeln und der Regierungsgrundsätze; sie haben kein Volk mehr, es bleiben ihnen nur noch Sklaven, und selbst diese vermindern sich von Tag zu Tag. Wer wird ihnen die Wahrheit sagen? Wer diesem Strome Ufer setzen? Nichts leistet mehr Widerstand; die Weisen fliehen, verbergen sich und seufzen. Nur eine plötzliche und gewaltsame Umwälzung vermag dieser aus ihren Ufern getretenen Macht wieder ihren natürlichen Lauf zu weisen.“
(Die Leser von 1938 wußten, in welchem Sinne dieses Zitat zu verstehen sei. Es wirkt erschütternd heute erst recht.)
Aus „Fenelon und Frau von Guyon“ (April und Mai 1939).
Durch den von Masson wieder ans Licht gezogenen Briefwechsel, so sagen sie, werde endgültig klar, daß nicht bei Fenelon die geistliche Führung gelegen habe, sondern daß er der „dirige“ von Frau Guyon gewesen sei. Wie anders läsen sich dagegen die geistlichen Briefe des gealterten Bossuet am die Schwester Cornuau: wie männlich! Als ob Männlichkeit ein religiöser Ruhmestitel wäre! Fenelon konnte sehr autoritär sein, wo er der Gebende und Verantwortliche war. In diesem Punkte stand er Bossuet nicht nach, aber er hatte im Gegensatz zu ihm die Demut, das Göttliche überall anzuerkennen, wo ihn innere und äußere Kriterien nicht zweifelhaft machten, daß sich offenbare. .. Niemals hätte er, wie Bossuet Frau Guyon gegenüber es tat, vermocht, sich einen „Kirchenvater“ an nenne. Er bildete sich auf seine Männlichkeit nichts ein, wo es sich um das Wirken Gottes m den Seelen handelte. Und in der Tat ist ja die weibliche Psyche religiöser als die Männliche. „Auf einen begnadeten Mann“, so sagt ein neuerer aszetischer Schriftsteller von Rang, „wird man leicht drei Frauen zählen können, bei denen diese übernatürlichen Gaben außer Zweifel stehen.“ Das sei, so fährt P. Mesdiler S. J. fort, die Ansieht der heiligen Theresia, und diese habe sie vom heiligen Petrus von Alcantara, der erklärt habe, „nach seiner Erfahrung mochten die Frauen in dieser Hinsicht mehr Fortschritte als die Männer.“
... Einer Frau wie der Gräfin Mont-beron, die ihm ob ihrer Ängstlichkeit Sorge macht und die zw reinen Liebe zu eraeben er bemüht ist, gesteht er eines Tage, er Hebe Gott über alles Maß, aber mir solange, als er diese Liebe nicht suche. Sobald er sie soehe, finde er sie nicht mehr, und er fährt fort, befremdlich f&r die vielen: „Was mir wahr schemt, wenn ich es auf den ersten BEck denke, wird in meinem Mund zur Luge, wenn ich es aussprechen will.“ Das ist das Schicksal eines Geistes, der, wie Goethe weiß, daß „die Aussprüche des Verstandes rmr einmal gelten, and zwar in dem bestimmtesten Fall“, und schon unrichtig werden, „wenn man sie auf den nächsten anwendet.“ Dieses Mißtrauen in der Kongruenz von Denken und Sprechen erfüllt anch Fenekm. Seine geistige Organisation erinnert in diesem Betracht durchaus an die des deutschen Dichters. Ein Wort Goethes wie dieses am Jacobi: „Man lernt nichts kennen, als was man liebt“, wäre ganz nach Herzen gewesen.
(Sdilufswort des Verfassers.)
Die christliche Religion besteht in der Liebe zu Gott, alle anderen Religionen wurzeln in der Furcht. Je selbstloser die Liebe wird, je freier von jeder Berechnung, ja von der Hoffnung sogar, je mehr wird sie eigentliche Liebe, Liebe an sich, Liebe um der Liebe willen. Diese Liebe in sich und anderen zu entzünden und so rein zu madien, daß kein Interesse der Eigenliebe sie mehr trübt, war das große Anliegen Fenelons, aber auch der Ausgangspunkt schwerer und weittragender Mißverständnisse zwischen ihm und Bossuet. Das hehre Objekt des Kampfes konnte nicht verhindern, daß die Frage um die reine Liebe mit Streit ausgetragen wurde. Und doch ist dieser Streit vielfach mehr um Worte, als um die Sache geführt worden; denn im Sinne Fenelons, und, so seltsam es klingen mag, auch Ions und, so seltsam es klingen mag, auch im tiefsten Sinne Bossuets. .. lag es, daß die Liebe Gottes uneigennützig und — ungetrübt selbst durch Hoffnung — vollkommen selbstlos sein solle. Die Herzen der Kämpfenden wurden verwundet, die Liebe ward beleidigt und ging doch aus dem Kampfe siegreich hervor.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!