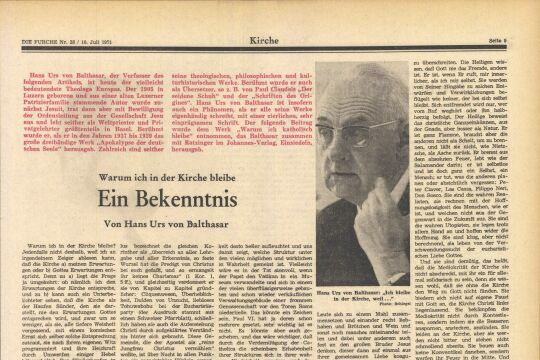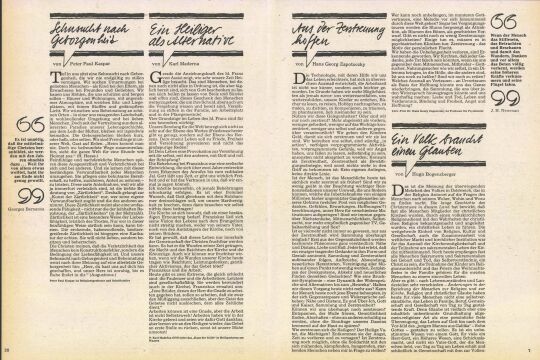Sir Karl Raimund Popper, der berühmte in Wien geborene, in England lebende Wissenschaftstheoretiker und Philosoph, bekennt einmal in einem Interview: „Ich habe zu zeigen versucht, daß die Grenzziehung zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft keineswegs dasselbe ist wie die Grenzziehung zwischen sinnvoller Sprache und Sinnlosigkeit. Daß Wissenschaft sinnvoll ist, gebe ich natürlich zu, aber daß alles, was unwissenschaftlich ist, auch sinnlos ist, habe ich immer für grundfalsch gehalten.“ So verteidigt Popper, auch gegenüber Wittgenstein, daß es echte philosophische Probleme gibt, die alle Menschen interessieren. Wer daher philosophische Fragen stellt - nach dem Sinn des Lebens, nach der Seele und ihrer Unsterblichkeit, nach Gut und Böse, nach Gericht und Jenseits - „beruft sich auf ganz ursprüngliche Visionen der Wirklichkeit, von dem, was der Mensch ist und wie seine Stellung im Gesamten der Wirklichkeit zu denken ist. Das erstreckt sich weit über alles, was ein Gelehriger auswendig lernen kann; wirft Fragen auf, die nicht zu beruhigen sind mit Antworten, die man schnell aus dem Taschenkatechismus hervorholt. Das reicht dorthin, wo alle sprachlos werden, weil die Bemühungen der Vernunft an Grenzen stoßen. Es gibt Ausdehnungen, die wir berühren, aber nicht ermessen können, mit keinem Lineal“, schreibt Bernhard Welte in seinem Buch „Der Ernstfall der Hoffnung“.
Es geht um philosophische Fragen, die naturwissenschaftlich nicht beweisbar, trotzdem aber glaubwürdig sind, wie Robert Musil einmal schreibt, die, fährt er fort, nicht unkritisch oder irrational, wohl aber mit einem wissenden Ahnen und ahnenden Wissen anzugeben sind.
Hierher gehört vor allem die Wahrnehmung von der Tiefe des Todes und der Mut, sich ihr auszusetzen.
Über den Tod geht nichts.
Kein Springbrunnen überspielt ihn. Keine Musik deckt ihn zu.
Er ist, wenn er ausholt richtig und richtig zuschlägt,
Ein gewaltiger Zerstörer.
Mit ihm in Beziehung gebracht Sind Aufgaben Kinderrasseln Und Pflichten Halme aus Stroh für Seifenblasen.
Was hier Marie Luise Kaschnitz sagt, zieht sich durch die ganze zeitgenössische Dichtung, in deren Zentrum immer wieder die Frage nach dem Sinn des Lebens im Angesicht des Todes steht. „Ich bin das Immerzu-ans-Ster- ben-Denken“ (Ingeborg Bachmann). Es ist der Ernstfall des Todes, der die Menschen im allgemeinen in Unruhe hält, der für den Christen im besonderen „Der Ernstfall der Hoffnung“, seiner christlichen Hoffnung, bedeutet. Bernhard Welte, der Freiburger katholische Theologe, der sich mit den t Grehzfragen der Theologie und des modernen Denkens einen internationalen Namen geschaffen hat, faßt in seiner gleichnamigen Schrift, die aus einem Vortrag „Gedanken über den Tod“ entstanden ist, die Probleme zusammen, die uns der Tod aufgibt und stellt sie unter das Thema der christlichen Hoffnung. Dunkel des Nichts, Drohung des Gerichtes einer ausgleichenden Gerechtigkeit, Trost der Hoffnung, geschöpft aus ihrer Erfüllung durch die Treue Gottes, das ewige Leben sind Themen, die klar und eindringlich, ohne zu simplifizieren, zur Sprache gebracht werden.
Es sind Themen, die gern an den Rand des Bewußtseins gedrängt werden - mitunter auch von Theologen - weil sie angeblich den Blick für dieses Leben und diese Welt trüben, die sie ans Jenseits veruntreuen.
Dadurch wird die Offenbarung Christi oft nur verstanden als ein Durchbruch des Menschen auf seine Menschlichkeit und sonst nichts. Gott, Transzendenz, Himmel und Hölle, dieser ganze mythisch-theologische „Überbau“ wird entmythologisiert. „Jesus aber wird in diesem Stil zum bloßen Einweiser in die Humanität, der in Freiheit und Liebe handelt und schließlich alle Menschen zu seiner Form bringen will. Oder er wird als der Bote des neuen gesellschaftlichen Löbens gesehen, der für die Durchsetzung seiner Absichten auch die Gewalt benützt hat, der große Revolutionär, der unter den heutigen Umständen auch eine Maschinenpistole gebrauchen würde.“ So schreibt der Linzer Theologe Gottfried Bachl in seinem. Buch „Über den Tod und das Leben danach“, dem sich diese Darlegungen anlehnen. In aller Ausführlichkeit verarbeitet er die Themen um die Letzten Dinge, in einem Denken, das sich den aus dem modernen Zeitbewußtsein anstehenden Problemen aufgeschlossen und mutig stellt. Progressiv im wahren Sinn, das heißt sich an den fortgeschrittenen und ständig fortschreitenden Wahrheitseinsich- ten orientierend, ohne jener Progressivität zu verfallen, die mit ihren Unfehl- barkeitsallüren diese Themen und damit nur ihre eigene Unwissenheit, wenn nicht gar schon Dummheit, arrogant zudeckt.
Leib und Seele, Unsterblichkeit der Seele, Seelenwanderung, Gericht, Apokalypse, Auferstehung, ewiges Leben sind Dinge, die nach neuem Verstehen verlangen. In aller Offenheit stellt Bachl die traditionellen Deutungen (mit ausführlichen Textzitaten) unserem heutigen Bewußtsein gegenüber, das sich eben geändert hat, unter dem Einfluß wissenschaftlicher Erkenntnisse fortgeschritten ist. Man kann den Kopf nicht in den Sand stecken. Marx und Bloch werden ebenso kritisch untersucht wie die politische Theologie und das soziale Engagement unkritischer Anpassung, die das siebente Gebot gern zum ersten Gebot umfunktionieren möchte. Trotz kritischer Offenheit, auch kirchlichen Dokumenten gegenüber, wird nichts von der Substanz preisgegeben, wird .^kritische Solidarität“ gewahrt. Besonders hervorgehoben gehört die Sprache: anspruchsvoll, in bedächtigen und gelungenen Formulierungen, geschult an der Literatur, keinerlei Phrasengeklingel, ohne modische Slogans und Gags, ohne Reklametricks. Bachl propagiert nichts, er sucht, selbst betroffen und den Leser betroffen machend, nach Wahrheit.
Alle Welt und alle Arbeit an ihr, alle Liebe zu den Menschen steht unter einem Vorbehalt, jenem des Todes, bzw. seiner Überwindung. Kein Mensch, keine soziale Ordnung vermag ihn zu beseitigen. Füreinander sterben kann man, aber nicht miteinander. Jeder stirbt* allein. Christus allein gibt Antwort, weil in ihm Gott, der ein Gott der Lebenden und nicht der Toten ist, gegenwärtig den Tod besiegt und damit allem die Qualität der Hoffnung verliehen hat.
Darin liegt auch eine Bejahung des Lebens und der Welt, weil der Glaubende, mit Christus bewußt oder unbewußt verbunden, über alle Todesangst hinweg seine Identität in der Zeit entdecken und gewinnen kann. „Kann“, das heißt, ihm ist die freie Entscheidung überlassen, alles als ein Grab der Sinnlosigkeit anzusehen oder die Erde als einen Anfang zu erblicken, die Erde als ein in sich geschlossenes System oder als einen Übergang zur Vollendung zu betrachten.
Weder Flucht noch Aufgehen in der Welt, sondern Tun und Lassen zugleich ist das schwierige Unternehmen des Glaubenden, das nicht vom Gesetz des Habens oder Habenwollens, eines gewalttätigen Engagements bestimmt ist.
sondern von der freien Hingabe eines ahnenden Wissens und Hoffens, eines liebenden Vertrauens an jenen „in Jesus geschehenen Einsatz Gottes für den Menschen“. „Die Einübung in die Liebe und das Sterben gehören zusammen.“ „Jesus hat in dem ganzen Vertrauen, mit dem er sein Verhältnis zum Vater gelebt hat, den endgültigen Trost über das Leid und das Böse vorausgenommen, und seine Epiphanie zu Ostern ist die Erscheinung des Trostes. Sein Weg enthält den Willen und den Mut zum Weg des Menschen in der Geschichte. Das darf nicht übersprungen werden.“
Diese Bemühung des Christen in der Nachfolge Christi die Frage nach dem Tod zu beantworten, richtet sich daher^ auf eine rechte Humanisierung der menschlichen Ordnungen, nicht auf deren Veränderung, und berührt damit den Kern aller Reformen, die nie auf Strukturverbesserungen und soziale Reformen reduziert werden können. „Jesus vereinigt also in Person das Vordringen des Menschen und das Hereindringen Gottes; er ist die Kommunion Gottes mit dem Menschen, sodaß beide Wirklichkeiten ihr unverkürztes Recht haben.“
Diese Humanisierung wird nur dort glaubhaft wo sie diese Kommunion nachvollzieht: Gegenseitigkeit der Liebe, wachsende Anerkennung der gleichen Ursprünglichkeit und dadurch Freiheit, die eigene und die des andern, erlangend. Die revolutionären Impulse der Welt- und Gesellschaftsveränderer opfern wohl auch, aber die Geschichte hat ihr Pathos Lügen gestraft. In ihnen stehen die Menschen nicht in freier Bejahung einander gegenüber, sondern sind einer vernichtenden Opferung ausgeliefert, die zur Entfremdung führt. „Wir dürfen nicht übersehen, daß Menschen, die für die Freiheit der Absichten und Ziele eifern, sich nicht scheuen, über Leichen zu gehen, wenn andere ihrer unanfechtbaren guten Meinung entgegentreten.“
Jeder Mensch aber, der den Tod und die Toten nicht achtet, ist im Begriff die Lebenden zu ermorden, ist schon die Lehre der Sophokleischen Antigone. Der Mensch ist mehr als seine sichtbare Existenz, er ragt über sie hinaus: Der Zwang der von der Enge der Weltzeit ausgeht, der die Transzendenz in der Geschichte erreichen möchte, deformiert den Menschen und seine Gesellschaft. „Dagegen hält das Christentum mit der Hoffnung auf die Auferstehung sowohl den Raum der Freiheit offen, in dem der Mensch nicht das Absolute sein noch es zuwege bringen muß, als auch das Pathos einer universalen Solidarität Hoch; sie muß nicht vor dem Tod resignieren.“ So entsteht eine umfassende Ökumene der Geister aus Geschichte und Gegenwart, außerchristlichem und christlichem Denken, aus dem Geist einer Philosophie, die sich den Fragen nach den Letzten Dingen stellt, die nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, entsteht ein wahres Kapital an Trost für den oft des Glaubens überdrüssig, wenn nicht gar schon unfähig gewordenen Menschen unserer Zeit.
Zeugnisse bekräftigen es. „Texte zum Nachdenken“ (Herausgegeben von Gertrude und Thomas Sartory), die unter dem Titel „Heimgang“ diese Letzten Dinge nicht bloß illustrieren, sondern meditierend bewältigen, aus westlichem und östlichem Christentum, aus Judentum und modernem Denken die ars moriendi lehren, die Kunst rechten Sterbens, und münden in den Epilog gottergriffener Menschen „der Unsterblichkeit gewiß“: „Nicht Gespenstererscheinungen vermitteln die Gewißheit, daß bereits Verstorbene noch existieren. Die Gewißheit, daß der Sterbende seinen Tod überlebt, gründet anderswo: in der Erfahrung des eigentlichen Kerns des menschlichen Wesens in seinem Zusammenhang mit dem Hauch, dem Licht, der Wärme Gottes. Unabhängig auch von Argumenten. Denn nicht die Stichhaltigkeit der Argumente gründet Gewißheit, sondern weil er einmal den Kern seines eigenen Wesens in seiner wesenhaften Beziehung zu Gott erfahren hat“ („Meditationen über die Großen Arcana des Taro“).
„Wenn ich gestorben bin, kommt zu meinem kleinen Grab! Kommt nur, wenn ihr Zeit habt, und je öfter, desto besser. Alles, was euch auf der Seele lastet, wenn es euch nicht gut geht, oder ihr habt etwas, das euch betrübt - kommt zu mir und bringt euren Kummer mit an mein kleines Grab. Fallt zur Erde nieder, und erzählt mir alles wie einem Lebenden, und ich werde euch hören, und dann wird euer Kummer schnell verflogen und ganz vorüber sein! Für euch lebe ich noch und werde ewiglich leben.“ (Der hl. Staretz Serafim von Sarow.)