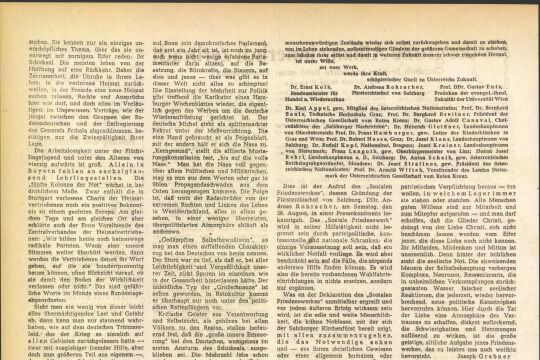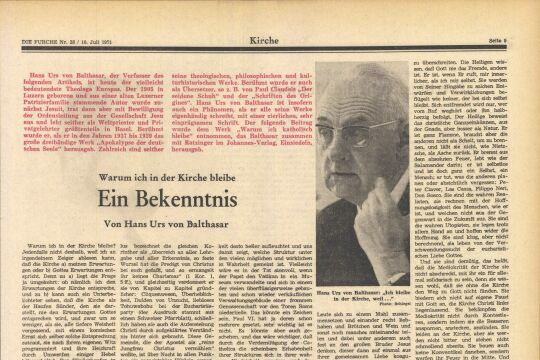„Besser Verstummen, als Geschwätz“
Was christliche Literatur ist, gilt als sehr umstritten. Die einen sagen sie tot, es gebe sie nicht mehr, die andern sprechen von „einer neuen Woge christlicher Dichtung“. Gisbert Kranz, der durch seine zwei Bände „Europas christliche Dichtung“ bekannt wurde, stellt eine imposante Reihe christlicher Dichter der Gegenwart aus aller Herren Länder in „Die christliche Dichtung heute“ zusammen. Sieht man auch hier genauer hin, liest man die Rezensionen, erhält auch dieses Unternehmen seine Fragezeichen. So zum Beispiel untersucht Dorothea Solle, die Autorin des politischen Nachtgebetes, in ihrem Buch „Realisation, Studien zum Verhältnis von Theologie und Dichtung nach der Aufklärung“ die zentrale Funktion der Verwendung biblischer Sprache in Büchners „Woyzek“. Büchner aber ist bei G. Kranz nicht zu finden.
Was christliche Literatur ist, gilt als sehr umstritten. Die einen sagen sie tot, es gebe sie nicht mehr, die andern sprechen von „einer neuen Woge christlicher Dichtung“. Gisbert Kranz, der durch seine zwei Bände „Europas christliche Dichtung“ bekannt wurde, stellt eine imposante Reihe christlicher Dichter der Gegenwart aus aller Herren Länder in „Die christliche Dichtung heute“ zusammen. Sieht man auch hier genauer hin, liest man die Rezensionen, erhält auch dieses Unternehmen seine Fragezeichen. So zum Beispiel untersucht Dorothea Solle, die Autorin des politischen Nachtgebetes, in ihrem Buch „Realisation, Studien zum Verhältnis von Theologie und Dichtung nach der Aufklärung“ die zentrale Funktion der Verwendung biblischer Sprache in Büchners „Woyzek“. Büchner aber ist bei G. Kranz nicht zu finden.
Dazu kommt, daß die Christen beziehungsweise die offiziellen Denker des Christentums, die Theologen, selbst nicht mehr zu wissen scheinen, was christlich ist. Die Diskussionen um das ausdrückliche und anonyme Christentum, um das religionslose Christentum, um die Pro-fanität, die Verweltlichung, Ent-sakralisierung, Entmythologisierung, ja um die Gott-ist-tot-Theologie, wie sie heute im Schwange sind und mehr als Slogan denn als sachliche Auseinandersetzung benützt werden, bezeichnen das deutlich. Absolut-heitsansprüche haben alle großen Weltreligionen gestellt, sind also nicht spezifisch christlich. Was heißt heute noch Absolutheitsanspruch des Christentums, der katholischen Kirche vor allem, wenn er, nach den heutigen prominenten Theologen, gar nicht mehr verifiziert, sondern höchstens nur noch subjektiv geglaubt werden kann. Ich habe auch nicht nachgeforscht, ob die heute hier lesenden Dichter ihre Sonntagspflicht erfüllen, um sie als christliche ausweisen zu können.
. ii>Qgt «nan iatw «. ti'JOD c«
Dichtung und Glaube: diese Thematik ist ungemein schwierig. Besteht der Glaube nur darin, daß man gewisse Glaubenssätze bekennt, oder glaubt nicht auch ein von Skepsis
gequälter, von der Leidenschaft des Zweifeins erfaßter, ein suchender Mensch? Oft schmerzlicher als ein Geborgener? Viele sind draußen, die drinnen sind, und viele drinnen, die draußen sind, sagt der große Augustinus. Von ihm stammt auch jenes schöne Wort: es gibt eigentlich nur einen wahren Glauben, vom Beginn der Menschheit bis an ihr Ende, und seit Christus und für den Christen heißt er der christliche. Nun, ich möchte daher vom spezifischen Thema des Dichters ausgehen, von der Sprache, um nicht in der Diskussion des christlichen Dichters umherzuirren. Zur Sprache hat der Dichter ein besonderes, ja überhaupt sein Verhältnis. Und wenn es heißt: Im Anfang war das Wort, müßten es eigentlich auch die Christen haben. Damit sind wir auch bei Dichtung und Glaube und Christentum.
Der „Jedermann“ von heute ist Handkes „Kaspar Hauser“, könnte man sagen. Mit der Sprache baut sich dieser Kaspar Hauser seine Welt auf, verbaut sie sich aber auch wieder. Verantwortung vor der Sprache ist Sache des Dichters und sollte auch Sache des Gläubigen sein, der sich dem Logos verbunden weiß. Günter Eich, der deutsche Dichter, meinte einmal: Von Gott kann man nicht sprechen, wenn man nicht weiß, was Sprache ist. Tut man es dennoch, so zerstört man seinen Namen und erniedrigt ihn zur Propagandaformel.
Wenn Ingeborg Bachmann den bedeutenden Vers schreibt: „Wenn ich
in diesem meinem Schweigen ein Wort finde, ist es in mein Leben gegraben wie ein Abgrund“, ist das für mich christlicher als wenn es beim christlichen Schmalz rhythmischer Messen in allen Ecken „Danke, danke!“ singt. Je primitiver und geschmackloser, um so christlicher, scheint der Grundsatz des christlichen Hinüberwechseln von Sakral zu Profan zu sein.
Daß in dieser repräsentativen Ausstellung österreichischer Kultur auch dem Wort der entsprechende Platz
eingeräumt wird, ist daher höchst anerkennenswert; wenn man auch oft von Seiten kirchlicher Persönlichkeiten zu hören bekommt: daß sich mit Literatur nur einer beschäftigen kann, der nichts zu tun hat, keine aktive Seelsorge betreibt. Nun, bei solchen Aussprüchen dürfte der Heilige Geist in Österreich in „Flaschen“ abgefüllt worden sein. Mit dem Zeitgeist kokettierende Attrak-tivitätshascherei macht noch kein neues Christentum, schon gar nicht, wenn dieser Zeitgeist aus der Zeit von vor fünfzig Jahren herangeholt wird. Was jedem gerade an guten Gedanken einfällt, wird schon für würdig erachtet, beim Gottesdienst verwendet zu werden. Bis in die Wandlungsworte hinein, wie ich zum Beispiel von einem Wiener Arzt
hörte, der mir sagte, daß es seinem zuständigen Zelebranten des Gottesdienstes mitunter passiere, daß ihm auch die richtigen Wandlungsworte auf die Lippen kommen.
Hier wäre eine recht verstandene Entsakralisierung wirklich am Platz; wenn D. Solle von Realisation spricht und an Paul Tiüich. anknüpft: in der Profanität künstlerischer Gestalt verbirgt sich das, was uns unbedingt angeht. Nur ist diese Profanität nicht zu verwechseln mit Primitivität oder gar jener enthumanisierenden Formlosigkeit, die als neueste Aktualität hochgeschaukelt wird, von der viele Christen meinen, sie müßten sich ihr verschreiben, um attraktiv zu bleiben. Wir NichtChristen, schreibt Augstein, der „Spiegel“-Redakteur, in seinem Jesus-Buch, können nie so blasphemisch sein, wie die Christen mit ihrem Jesus-Christus-Superstar oder Godspell. Und vom Jesus und seine Hawerer schreibt Hans Heinz Hahnl, der die Sparte der Literatur in der „Arbeiter-Zeitung“ (nicht im Kirchenblatt!) betreut und selbst Dichter ist:
„Das Buch der Bücher hat ein
junger Dichter in das Rotioelsch der Unterwelt übersetzt, das die Literaten
schreiben, um dem Volk näherzukommen und seiner unverbrauchten
Ausdrucksgewalt. Der Missionar der Kraftausdrücke hat, wie man hört, auf einer Literaturtagung sieben Bekehrungen erzielt: sechs haben ein Kollektiv gebildet und übersetzen den Koran ins Schwäbische; einer sächselt die Edda.“ Immer noch gilt, was Leon Bloy einmal sagte: Zwischen einer prachtvoll geschriebenen Seite und einer anderen Seite, welche dieselben Gedanken in platten Phrasen ausspricht, wählen die Christen instinktlos die Phrasen. Der ungewöhnliche Unverstand und die Abkehr von dem, was schön ist, hat bei ihnen etwas Abwegiges. Das Schöne paßt ihnen halt so gar nicht zur „guten Nachricht“ von den „Wohligkeiten“, wie seit neuestem die acht Seligkeiten heißen. Entweder bedienen sie sich einer feierlichen Amtssprache oder, aus Fremdwörtern und Journalismus zusammengelesen, aufgepäppelter Gemeinplätze oder, wenn es hochkommt, eines Kunsthandwerk-Vokabulars und liturgischer Gebrauchslyrik. Doch: in der Sprache wird sich der Mensch erst seines Menschseins bewußt, macht Handkes Kaspar Hauser deutlich. Sprache ermöglicht überhaupt erst das Sein, philosophiert der eben verstorbene Martin Heidegger. Das gilt erst recht vom Logos. Ganz im Sinne des Johannes-Prologs, zu dem der Neutestamentier Heinrich Schlier meint: alles, was es gibt, verdankt dem Wirken des Wortes sein Dasein. Wie man auch immer den Satz „in ihm war das Leben“ erklären mag, immer wird deutlich, „daß das Leben alles dessen, was geworden ist, im Wort beschlossen ist, daß alo das anfängliche Wort, indem
es ergeht, das Leben vermittelte. Dieses Wort sagt das Leben all dessen aus, was gestorben ist, ist den Menschen zugleich als Licht gegeben.“ So ist es verständlich, wenn nach Schlier dem Prolog „eine Dichtung zugrunde liegt, ein Stück kultisch liturgischer Dichtung, ein Hymnus auf den Logos, gesungen ursprünglich von der versammelten Kirche, die sich zum Logos bekennt“.
Und das Licht leuchtet in der Finsternis, gerade auch in jene Finsternis, die ein mißbrauchtes Wort erzeugt. „Unsere Sicht ist wie im Winter, so dicht fallen die Worte“, meint ein zeitgenössischer Dichter. Wenn wir heute das Wort im Wortgottesdienst, noch dazu in einer allen verständlichen, also auch von allen kontrollierbaren Landessprache so. in die öffentichkeit stellen, müssen wir uns auch in besonderer Weise der Verpflichtung des Wortes bewußt bleiben. Hier vor allem gilt: Du sollst den Namen Gottes nicht eitel nennen, und sollst nicht plärren und viele Worte machen wie die Heiden. In einem Zeitalter des Geredes und der Wortuhr, das eben dadurch zu einem Zeitalter der Indiskretion geworden ist, steht die Versuchung zur Prostitution des Logos täglich auf unseren Schwellen der Herzen und der Häuser und der Kirchen. Pastorale Redseligkeit überhandnehmender Funktionäre, meint einmal Ed-zard Schaper, mischt so oft in Gottes Milch böslich Gips. Dialoge und Diskussionen, die schon als Wunderdrogen zur Süchtigkeit verführt haben, gehen ins Leere, wenn sie zu Wortschlampereien ausarten. Das hat nichts mit Fleischwerdung oder Menschwerdung des Wortes zu “tun, hier werden nur zu oft alte sakrale Klischees gegen neue profane Klischees ausgetauscht, untermalt mit kleinbürgerlichen Sentimentalitäten in stigmatisierter zweiter Besetzung: Händchenhalten, Friedensküßchen geben, Fürbittengeschwätz; der Gipskitsch der Herzen Jesu und Maria unserer Großväter mit den dazugehörigen Schmalzmelodien feiert fröhliche Urständ.
Deutung und Dasein und Glauben in und aus dem heutigen Wort klingt anders. Ingeborg Bachmann, unsere leider zu früh verstorbene Lyrikerin will durch ihre Dichtung neue Fassungskraft, scharf von Erkenntnis. Gegen eine „Gaunersprache“, die man für alles und jedes parat hat, die in Leerformeln alle Situationen meistert, schlimmer noch: die alles ausdefiniert hat und von den geschickten Mechanikern bedient wird, den Menschen das eigenständige Denken abnimmt, ihn manipuliert, wie wir heute sagen. „Dann spring noch einmal auf und reiß die schimpfliche Ordnung ein, ruft sie, damit die Welt die Richtung ändert. Keine neue Welt ohne neue Sprache!“ Besser verstummen, als unglaubwürdiges Geschwätz. Wenn ich in diesem meinem Schweigen dann ein Wort finde, ist es in meinem Leben begraben wie ein Abgrund. Dieses Verstummen allein kann eine
„Atemwende“ herbeiführen, meint Paul Celan. Diese Wortaufschüttungen haben die Welt zur Unlesbarkeit entstellt und den Glauben vermurt. Die Sprache muß durch dieses Verstummen hindurch, durch all die tausend Finsternisse todbringender Rede, um sich erst einmal zu orientieren, um zu erkunden, wo „ich mich befand, und wohin es mit mir wollte“. Christine Busta, unsere große Lyrikerin, führt Sprachgewicht auf der Zunge, ganz Gedicht aus Geduld und Härte. Mühsam Silbe um Silbe müssen wir wieder erlernen, uns zu verständigen über die Welt. Die Sprache, der du im Wort bleibst, wird nicht geredet, sie wird erlitten. Keine Weltverbesserungsprogramme zu entwerfen, ist ihre Aufgabe, mit religiösen aus der Politik an den Haaren herbeigezogenen Slogans, sondern sich in das Netz der zwischen- und mitkreatürlichen Beziehungen einzuknüpfen. „Uns ist das Wort gegeben, um Honig und Wachs zu bereiten, Brot und Wein, und die schöne verletzliche Welt heimzuholen ins Herz.“
Das sind die Probleme, die die heutigen Dichter haben. Frisch, fromm, fröhlich, frei platzen die Christen mit ihrem landessprachlichen Enthusiasmus in diese ernste und aufwühlende Problematik um die Sprache, wie der bekannte Elefant im Porzellanladen. Gegen alle Entleerung der Sprache, die früher oder später zur Unglaubwürdigkeit wird, geht die Dichtung auf den Kern der Sprache. Im besonderen
ist sie heute zur Existenzfrage geworden, in ihr sind Heils- und Glaubensfragen in jedem Falle mit-einbeschlossen, wenn man den Glauben eben nicht als eine brave, den alten oder auch den neuen Katechismus memorierende Eigenschaft begreift. Nur wo diese Spannung zur Auslegung des Sinnes von Leben, Lieben, Bleiben und Sterben treibt, wo die Sprache, nach Heidegger, Bahnen wesentlicher Weisungen, in die sich alles Entscheiden fügt, weist, in die Bahnen von Geburt und Tod, Segen und Fluch, Leid und Freude, sich dahinein alles verdichtet, ist Dichtung die Sprache, die alles andere Sprechen ermöglicht. „Eine all unserer Daten eingedenk bleibende Konzentration“, nennt Celan solches Sprechen. „Kontemplative Vergewisserung des Wesentlichen“, sagt Karl Jaspers. Hier begegnen sich Dichtung und Glaube. Nicht umsonst hat Christus im Neuen Testament, genau wie die großen Weltreligionen in ihren Mythen und Dichtungen, seine Lehre in Parabeln und Gleichnissen, also in die Form von Dichtung gefaßt, weil es anders gar nicht möglich ist, von den ersten und letzten Dingen zu sprechen, oder wie unser Altmeister Rudolf Henz in seiner kleinen Apokalypse sagt, um über Alpha und Omega Bescheid zu wissen. Es gibt genug Veröffentlichungen, die den Christen ins Gewissen reden, und zwar von zeitgenössischen und auch jungen Autoren, zum Beispiel „Fällt Gott aus allen Wolken?“ (Schrifsteller über Religion und Sprache), „Kritik an der Kirche“, oder neuestens „Der unverbrauchte Gott“ (neue Wege der Religiosität). Aber die meisten theologischen .Praktiker“ haben mit dem letzten Examen auch das letzte Buch verabschiedet.