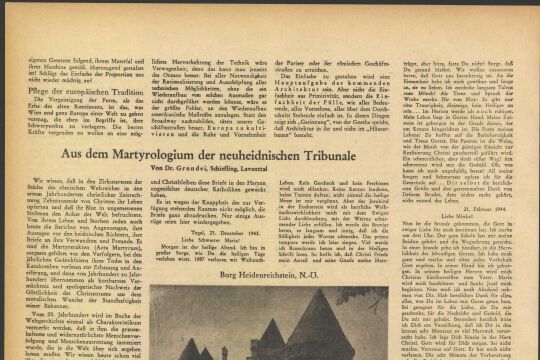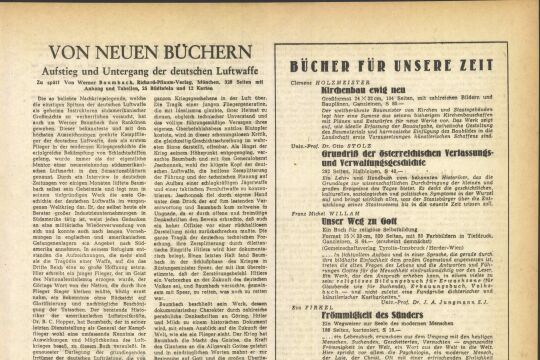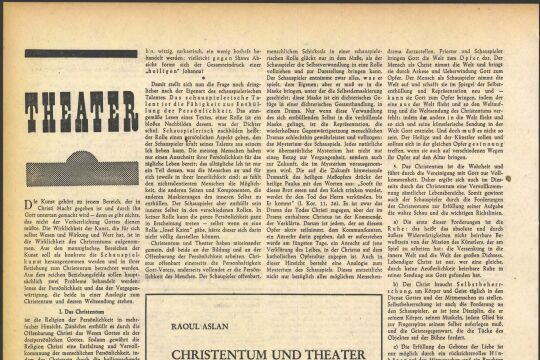R. M. Rilke schreibt einmal an den „jungeji Dichter“: „Von allen meinen Büchertn sind mir nur wenige unentbehrlich, |und zwei sind sogar immer unter meinen Dingen, wo ich auch bin. Sie sind auch Jiier um mich: die Bibel und die Bücher des großen dänischen Dichters J. P. Jacobson.“ Von diesem nahen Umgang mit der Bibel ist ein beträchtlicher Niederschlag im Werke des Dichters zu finden; Davids Klage, Josuas Landtag, Christi Höllenfahrt, Die Auferweckung des Lazarus, Die Liebe der Magdalena usw. Oder die wunderbar feinsinnigen, wenn auch dogmatisch nicht einwandfreien Betrachtungen des „Marienlebens“. Dazu kommt noch das wirklich tiefgehende Rußlanderlebnis mit seinem orthodoxen Christentum, dem die innigen Gebete des „Stundenbuches“ entstammen; die Gestalten des „Engels“ und des „Heiligen“, die noch unveröffentlichten Christusvisionen, die „Geschichten vom lieben Gott“ usw. In derb letzten Jahren seines Lebens noch hat Rilke eine kleine Landkapelle renovieren j lassen und der Einsiedler von Muzot selbst galt bei der Bevölkerung fast wie ein Heiliger. — So ist es nicht zu verwundern, daß rr|an Rilke gern, wie es erst kürzlich eine Wiener Tageszeitung tat, mit dem Christentum in Verbindung bringen möchte.
Solang man bei dieser rein äußerlichen Betrachtung stehenbleibt, weil eben ein Dichter christliche Motive aufweist, mag das noch angehen. Aber eigentlich müßte man bereits hier mit der Zurückhaltung beginnen. Denn abgesehen davon, daß nur wenige dieser „christlichen“ Motive auch inhaltlich christlich durchgeführt sind, distanziert sich Rilke selbstbewußt und klar vom Christentum, wie es zum Beispiel eindeutig die Auseinandersetzung mit Ellen Key gerade über das „Stundenbuch“ zeigt, das diese irgendwie christlich mißverstehen wollte;.
Zusammenfassend läßt sich diese ab lehnerjde Haltung Rilkes dahin bestimmen, daß er die sichtbare Einrichtung des Christentums in der Kirche nicht verstehen kann. Er möchte unmittelbar zu Gott gehen, über sämtliche religiöse Gemeinschaften hinweg, die für ihn übrigens alle auf der gleichen Ebene Hegen, ohne Unterschied, ob es christliche oder jüdische, mohammedanische oder indische Religiosität ist. Er braucht das „Telephon Christus“ und des Christentums nicht. Wenn er dabei auch von seiner „beinah rabiaten Anti-christlichkeit“ schreibt und vor seinem Tod ausdrücklich das Kommen eines Priesters verboten hat, ist er im ganzen und großen doch nicht starr offensiv eingestellt. Er anerkennt die Größe Christi; nur daß dieser Christus Gott sein wollte, schadete seiner Größe, so „verdeckt er Gott“. Und sicher „gibt es auch in der Kirche Gotteswege von seligstem Aufstieg und Von der tiefsten Leistung“, aber das war tinmal, heute ist das nur noch selten und die Kirche ist ein „hoffärtiges, leeres Haus, das wie eine hohle Puppe ist, aus der in dunkler Riesenschmetterling ausgekrochen ist“, sie ist ein „Aufwand ohne Frömmigkeit, Festvorstellung statt Fest“, ein „billiger Trostmarkt“. So bedeutet ihm die Kirche nur einen Umweg im Gehen zu seinem Gott (der anfangs ein pantheisrisch weltimmanenter Gott ist und im Spätwerk in eine ferne Unsagbarkeit als der Ganz-Andere entrückt wird). Sicher mag Rilke damit jenes Durchschnittschristentum richtig charakterisiert haben, das in der Kirche nur eine Versicherung gegen den Ernst und das Leid von Leben und Tod sieht und damit das „Hiesige ans Jenseits veruntreut“, weil es vor dem wirklichen Leben in einem falschen Glauben an die Vorsehung die Augen verschließt, während Rilke sehr richtig Leid und Tod als nicht hinwegzudenkende Werte mitten ins Leben hineinnimmt. Aber eigentlich ist das Christentum nichts anderes als die konsequent durchgeführte Liebe zur Welt, eben das Anliegen Rilkes, gerade als Kirche Christi, der als Gott in der Welt Mensch geworden ist, und als sichtbare Kirche; denn diese Sichtbarkeit besagt ja gerade eine Bejahung der irdischen Welt in ihrer ganzen Weite auch als endlich leidvolle, mehr als jedes rein innere unmittelbare Stehen zu Gott.
Es ist wohl eine Unkonsequenz im Werke Rilkes, daß er hier seine eigenen Gedanken nicht zu Ende geführt hat. Aber vielleicht konnte das der Mensch Rilke gar nicht. Sein Christentum war ihm von klein auf bereits so belastet, daß es wohl über seine Kräfte gegangen wäre, die christliche Welt zu bejahen. Hier muß einmal der Psychologe oder auch Plistoriker das letzte Wort sprechen. Bisher war die Zeit noch nicht reif dazu, jetzt aber, da Rilke bereits in eine gewisse Geschichtlichkeit eingegangen ist, darf man es bald wagen, besonders nach den letzten Veröffentlichungen in der Schweiz, auch darüber wie überhaupt über den Menschen Rilke ein offenes Wort zu sagen. Sicher ist ja, daß Rilke in seiner frühesten Jugend durch seine Mutter ein pietistisch bis krankhaft verbogenes Christentum kennengelernt hatte. Auch das tragisch schwere Erlebnis der Militärschule war leider mit dem Christentum eng verbunden, wie ein Brief an Ellen Key deutlich zeigt, wenn er nach Ablehnung dieses Christentums fortfährt: „Es kam mir eine neue größere und frommere Liebe, irgendein Glaube, der keine Angst mehr hatte ...“
Der tiefere Grund aber einer inneren Beziehung Rilkes zum Christentum muß in den eigentlichen Gedankengängen seines Werkes gesucht werden. Diese sind ohne Zweifel von einer derartigen Tiefe, daß eine erschöpfende Auseinandersetzung nur von einer christlichen Theologie her möglich ist. — Nur der Zentralgedanke soll angedeutet sein.
Der Grabspruch Rilkes ist die endgültige Formel, die der Dichter sich und seinem Werke gegeben hat: „Rose, o reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so viel Lidern.“ Die Rose nennt also der Dichter einen reinen Widerspruch, weil sie Lust und Freude daran hat, unter ihren so vielen Blütenblättern, die bildhaft mit Augenlidern verglichen sind, niemanden zu bergen, das heißt in Fortsetzung des Bildes, von keinem Auge, eben niemandes Schlaf zu sein. Vertieft wird dieses Bild noch dadurch, daß die späte Kulturpflanze der Gartenrose ja keine Frucht hervorbringt und somit der Stempel unter den Rosenblättern eigentlich niemand ist. — Das ist der reine Widerspruch: Überfülle des Lebens der Blüten, rein um ihrer selbst willen, und nicht einmal das, sondern um niemandes willen. Ja gerade, weil es niemand ist, ist es Überfülle an Leben. Wäre es für jemanden, wäre es bereits eingeengt auf diesen Jemand. Für den Menschen, ihn meint ja der Vers, ist es an sich ein Leid und eine Klage, für niemanden da zu sein, aber das wird in der Haltung der Lust am reinen Widerspruch „schönklingende Klage“ oder, wie es die „Duineser Elegien“ und die „Sonette an Orpheus“ nennen: Rühmung; Rühmung des Leides und des Todes. Rühmung ist Gesang und Gesang ist Dasein, irdisch-menschliches Dasein, und das wiederum ist ein „Hauch um nichts“, „das sich im Klang schon rein zerschlägt“. — Konkret ist es dann die Dialektik von Leben und Tod, der der Mensch ausgesetzt ist. Leben im Angesicht des Todes, in und aus dem Tod, der „mitten in uns weint“; doch nicht in Angst und Leid, sondern in Lust und Rühmung, da in ihm eigentlich nur das echte Leben, das Diesseits und Jenseits umgreift, aufbricht.
Hier stehen wir vor dem Tiefsten und Schwersten Rilkescher Dichtung wie auch theologischen Gedankengutes, das christlich ausgedrückt gegenüber dem „reinen Widerspruch“ die „Torheit des Kreuzes“ heißt. Gerade Leid und Tod sind auch in der christlichen Heilsordnung, eben in jener Torheit des Kreuzes, Quell des Lebens. Nur, und das ist das Entscheidende, hat Rilke diese christliche Dialektik vollkommen säkularisiert und trifft damit wohl haarscharf, aber abgrundtief am Christentum vorbei. Das heißt, was Theologie ist und nur sein kann, wird reine Philosophie. In dieser Säkularisierung des Christlichen erreicht Rilkes Dichtung und Weltanschauung ihre eigentliche Wesensproblematik, die über allem ästhetisch künstlerischen Hochstand, der ohne Zweifel anzuerkennen ist, nicht übersehen werden kann. Weiter kann eine Philosophie wohl kaum mehr gehen. Alles Transzendente wird ausgeschaltet (das ist aber nicht als Materialismus mißzuverstehen!); Unser Ruhm ist es, allein „irdisch gewesen zu sein“ und das „einmal und nicht mehr“. „Erde, du liebe, ich will, namenlos bin ich zu dir entschlossen.. .• dein heiliger Einfall ist der vertrauliche Tod.“ „Das tränenströmende Antlitz wird glänzender und das Weinen des Leides blüht.“ Leid und Klage und Tod gehen rein in sich als Rühmung im orphi-schen Gesang auf. Was bleibt, ist jener Niemand, ein Hauch um nichts.
Es ist im letzten eine Hybris, nicht jene Nietzsches, sondern die der Schwermut, welche der Kontingenzerfahrung menschlichen Daseins entspringt. Sie will in sich allein bestehen, ohne von jemandem Trost zu empfangen, auch von Gott nicht. „Liebende müssen einander überstehen“, das gilt von den Menschen wie von Gott. Hieher gehört auch Rilkes Deutung des „Verlorenen Sohnes“ im Malte als „der Legende dessen, der- nicht geliebt werden wollte“. Dahin weisen auch iene Briefzeilen: „Die Anschauung sündig zu sein und des Loskaufes zu bedürfen als Voraussetzung zu Gott, widersteht immer mehr meinem Herzen, das die Erde begriffen hat... alles tief und innig Hiesige, das die Kirche ans Jenseits veruntreut hat, kommt zurück ... Nicht im christlichen Sinn (von dem ich mich immer leidenschaftlicher entferne), sondern in einem rein 'irdischen,tief irdischen, selig irdischen Bewußtsein gilt es, da hier Gesthaute in den weiteren, den weitesten Umkreis einzuführen. Die Forcierung des Herzens, dies und jenes für wahr zu halten, die man gewöhnlich Glauben nennt, hat keinen Sinn.“
Nur von hier aus können letztlich alle „christlichen“ Motive in Rilkes Dichtung gedeutet werden. Der Engel und der Heilige sind ebensowenig christliche Gestalten, wie sein heiliger Franziskus eine ist, der vor allem dazu beigetragen hat, Rilke mit dem Christentum in Beziehung zu bringen. (Auch jener berühmte Weihnachtsbrief an / seine Mutter enthält, wenn man genau zusieht, nichts Christliches.) Franziskus ist rein weit-immanent, ja mensch-immanent im Sinne des Aufgehens im reinen Widerspruch zu verstehen, und genau so der Gott des heiligen Franz, der der Gott des „Stundenbuches“ ist. — Aufschlußreich ist neben den andern Briefen an Ellen Key der bereits erwähnte vom 3. April 1903: „Nach bangen langen Kämpfen gab ich meine heftige katholische Kinderfrömmigkeit preis, machte mich von ihr frei, um noch mehr, noch trostloser allein zu sein...“ — Daran hat sich auch später nichts geändert. Man muß nur an das „Leidland“ der zehnten Elegie denken, in der nach dem „billigen Trostmarkt der Kirche“ die Verse stehen: „Einsam stieg er dahin in die Berge des Urleids, und nicht einmal sein Schritt klang aus dem tonlosen Los.“ Oder der furchtbar tragische Pessimismus in den Worten eines Nachlaßgedichtes: „Mensch ist der, der grenzenlos verliert..