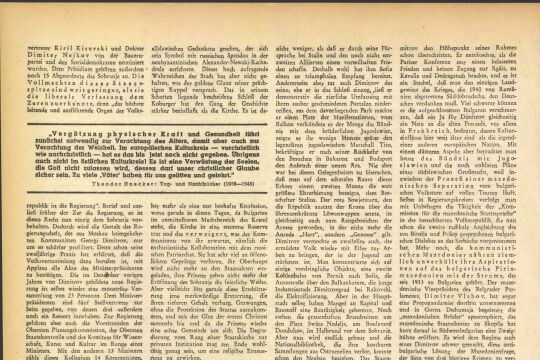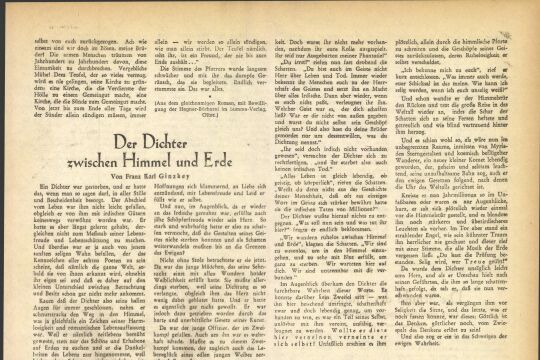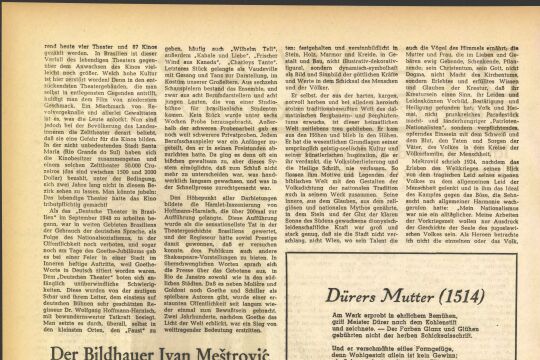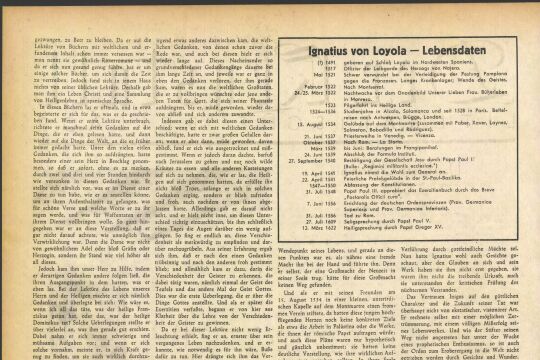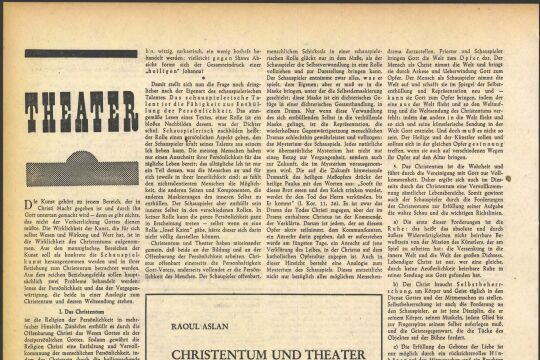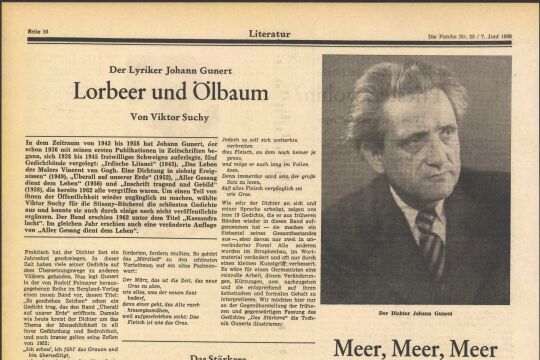Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Dienst am gleichnisschaffenden Wort
Unter dem Titel „Das M o r g e n t o r. Gedichte aus drei Jahrzehnten“ (Styria-Verlag) legte Gottfried Hasenkamp im Frühjahr . dieses Jahres eine Sammlung und Auswahl seiner Gedichte vor. Wir müssen dankbar sein für diese Sammlung, da sie uns besser als die bisher in verschiedenen Verlagen erschienenen und zum Teil vergriffenen Einzelausgaben die Gestalt eines Dichters vor Augen führt, der unserer Zeit Wesentliches zu sagen hat.
Hasenkamp hat einmal bei einer . Rückschau anläßlich seines 50. Geburtstages leicht ironisch über sich selbst geäußert, es habe ihm in seiner lugend nicht aussichtslos gedünkt, Hölderlin auf Dante häufen zu können. Aber es sei dann sehr bald die Stunde gekommen, wo er sich gezwungen gesehen habe, der dichterischen Aussage im Hinhorchen auf das He^z der Dinge einen Ausdruck von eigenem Klang und eigener Prägnanz abzugewinnen.
Dieses Bemühen kulminiert für ihn in dem Versuch, dazu beizutragen, „das Wort der deutschen Dichtung nach Jahrhunderten wachsenden Verfangenseins in die Immanenz wieder symbolfähig für transzendente Gehalte zu machen“. So ergibt sich von selbst, daß Vertreter eines reinen Aestheti-zismus, selbst wenn sie die Eigenwilligkeit unseres Dichters bejahen, ebenso schwer Zugang zu ihm finden wie diejenigen, deren Anschauungen und Erlebnisse nur dem rein natürlichen und rein menschlichen Bereich verhaftet sind und eher nach unten als nach oben schauen. Denn Hasenkamp, der entscheidende und bleibende Antriebe geistiger und formaler Art durch die römische Liturgie empfing, wie sie ihm vor allem, beispielhaft gefeiert, in Maria Laach entgegentrat, sieht die Welt, die Erde und die Menschen auf ihr, ihr Leiden, ihr Schicksal und ihre Freuden immer im Lichte des „Wortes“, das alle irdische Wirklichkeit erfüllt und zugleich verwandelt.
Das gilt zunächst für das Erlebnis der Natur, die immer zugleich zu einer Offenbarung der Ueber-natur wird, und gilt für alles, was „Geburt“ ist. weil auch dieses seinen Sinn nur findet, wenn es sich oberhalb des „Banns der untern Mächte“ als Gleichnis der Wiedergeburt weiß und ausformt. Als Beispiel dafür möge die Gedichtreihe „Der Chiemsee“ dienen. In drei Stufen („Dämonium meridianum“. „Das Gewitter“, „Der Friede“) werden hier Natur,
Landschaft, Tier und Mensch in die Einheit einer Erfahrung zusammengebunden, die vom „Rande der feurigen Stunde“, da „weit in farblosem Dunst sind hingelagert die Berge“, über „gärende Abgründe“, an denen sogar „höhnend gedenkt das Rind des Fluches und seufzt nach Erlösung“, hinführt zu dem Frieden, dessen tragfähiges Symbol das Kreuz des Klosters auf der Fraueninsel ebenso ist wie der Regenbogen des Himmels und der wieder gesammelt ruhende Spiegel des Wassers: „Spiegel der Reinheit, die sich gewann zu Geschwistern die Sterne.“
Die Wiedergeburt, die wir eben als das Grunderlebnis der Hasenkampschen Dichtung zu bezeichnen wagten, ist nicht ohne die Geschichte des Ewigen in der Zeit. So ist es fast notwendig, daß es den Dichter gleichzeitig zu einer geschichts-theologischen Deutung drängt, in die nicht nur die ganze in Xödeswehen und Erwartung liegende Natur, sondern auch die Kultur einbezogen werden, und aus der vor allem die Sendung und Berufung des christlich-deutschen Menschen zum Reich in der letzten weltverantwortlichen Größe und Entsagung, die damit verbunden ist, verkündet. Diese Deutung zieht sich fast durch alle Gedichte. Sie findet ihren ersten endgültigen Ausdruck in der „Salzburger Elegie“, „die diese deutsche Stadt in ihrer für die Vermählung des christlich-römischen mit dem romanischen Geist so symbolischen Stellung als .Siegel des Christ' feierte, als ein Siegel, das der Ring des galiläischen Fischers, der zu Rom unter Michelangelos Kuppel ruht, dem deutschen Antlitz aufgeprägt hat“. Sie wird in ihrer ganzen Fülle und in einer durch die Erfahrung gereiften und geläuterten Aussage wieder aufgenommen in den „Carmina in noete“. Der Dichter schrieb sie in der Nachkriegsgefangenschaft in Großenbrode, als er — ich gebe seine eigenen Worte — „nach sechs langen, von der Versuchung der Verzweiflung, auch am eigenen dichterischen Auftrag, nicht freien Jahren als Soldat... auf die nackte Ausgangssituation des Menschen zurückgeworfen war“, aber gestärkt durch das tägliche Kult erlebnis „der göttlichen Wirksamkeit im allumgreifenden einen Opfer“, gleichzeitig die Muße fand, „vor dem unbestechlichen Auge der Jwigkeit unsere Zeit und uns selber in ihr zu betrachten“. Höhepunkt dieser Dichtung sind die Verse des „Großenbroder Te Deums“.
Hasenkamps Dichtung, dessen Ziel letztlich auf „eine neue Einkörperung des Christlichen im Leib der deutschen Sprache“ geht, ist keine leichte oder leichtfertige Spielerei. Schon der Gedankenreichtum würde sich dem widersetzen; noch mehr aber die jede allzu subjektive Aeußerung zurückdrängende „Entfremdung“, für die der Dichter sein Vorbild in der kirchlichen Hymnik, in der umfassenden Klarheit der Liturgie und in der unentrinnbaren Gewaltsamkeit des prophetischen Zwanges findet. Der gleiche Grund mag es sein, der ihn auf der einen Seite die verpflichtende Form des Sonetts und der Ode oder die streng gefugte und gefügte Architektonik ganzer Gedichtkreise wählen läßt, und der ihn auf der anderen Seite zu einer ungewohnt freien Wortwahl und Wortstellung zwingt.
„Rufet die Engel an, daß euch wie uns sie geleiten mitten durch Woge und Blitz.“
Dieser Vers ist nicht nur Ausdruck einer Zeitspannung; er darf ebenso für die Dichtung wie für den Leser gelten. Denn wie der Dichter nicht zu seinem Vergnügen, sondern in heiligem Zwange schafft, so wird auch der Leser nicht dem wohligen Gefühl überlassen, sondern im heiligen Anruf zur Besinnung aufgerufen. Beide — Zwang des Dichters und Besinnung des Lesers — sind allerdings voller „Lobpreisung und Tröstung“. In seinem Anruf an die Dichter dieser Zeit gibt Hasenkamp diesem Willen Ausdruck.
„Nicht so, meine Brüder!
Was gebt ihr dem Froste, der auf das Blühende fällt, Oder des Wetters Zuckung, die seine Zierde zerreißt, Und den niederbrechenden
Schwarzen Wassern der Schuld und des Schicksals,
Die schneidendgenau das Verderben
Feiernde Stimme zumeist?
Sind wir zum Ruhme nicht, zur Lobpreisung.
Sind nicht, um Trost zu geben, die Dichter bestellt?“
Eine solche Forderung kann nur aus einer Gesinnung erfüllt werden, die gelernt hat, die Erde mit dem Himmel zu verbinden, das heißt „Leben und Sein einzustimmen in die immerwährende Liturgie vor.Gottes, des Dreieinigen, Thron“. Sie wird sich dann allerdings auch automatisch ergeben; denn
„Wer nur
Sänge denn ohne Hoffnung, der jemals
Des Weltgedichtes unsagbarem Singer gelauscht?“
So sprechen aus jedem Gedicht Hasenkamps die Sicherheit und Unbeirrbarkeit eines Menschen, der sich und die Welt in der Vaterhand Gottes geborgen weiß:
„In Deiner Hand sind Auf- und Untergang Der Menschen und der Völker, Herr, von Dir Zu Dir durchmessen sie die dunkle Zeit. Sie fallen ab, zu Tode daran krank. In unseren Fesseln doch erfahren wir. Das Morgentor geht auf.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!