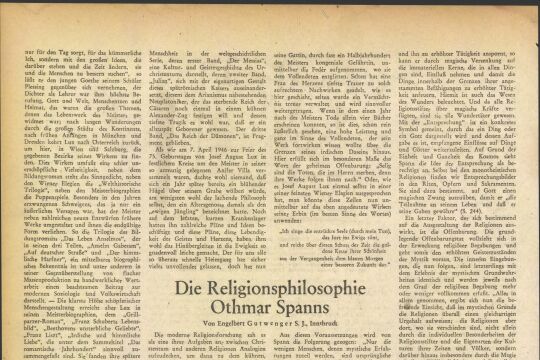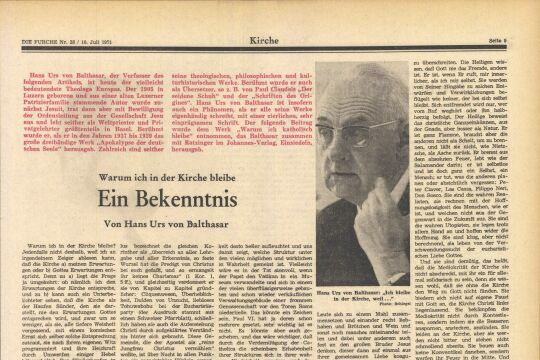Widerspruch und Mehrdeutigkeit spielen sowohl in der Poesie eine zentrale Rolle als auch in der christlichen Religion - in der Heiligen Schrift und auch im religiösen Leben selbst, im Verhältnis religiöser Erfahrungen Einzelner etwa zu den vorgegebenen Glaubensinhalten.
Als ich etwa zwanzig Jahre alt war, empfahl mir ein Freund, Gedichte an Pater Focke zu schicken. Pater Focke nahm meine Gedichte (oder vielleicht auch nur mich selbst) ernst. Jedenfalls kommentierte er diese zweifellos ungelenken und naiven Versuche nicht nur fachkundig und detailliert, sondern auch sehr freundlich. Wir haben uns dann ein paar Mal in der Mensa der Akademie am Schillerplatz (wo er, glaube ich, Literaturgeschichte lehrte) oder im Kaffeehaus getroffen. Auch über Christine Lavant und ihre Dichtung haben wir dabei gesprochen. Es ist vielleicht kein Zufall, dass mir dann viele Jahre später sowohl das Werk dieser Dichterin wichtig wurde als auch das Verhältnis von Religion und Poesie.
Christine Lavants Gedichte stellen den in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wenn nicht einzigartigen, so doch äußerst seltenen Fall eines lyrischen Werks dar, das ästhetisch zu überzeugen vermag, obwohl es durch das Christentum wesentlich bestimmt ist und sich häufig auf dieses explizit bezieht.
Das Außergewöhnliche und Fremde der Lavantschen Gedichte im zeitgenössischen Kontext und ihr dennoch ästhetisch Überzeugendes ist das eine Motiv für meine Auseinandersetzung.
Das andere besteht darin, dass sich über die Jahre hin und durch mein eigenes Schreiben das Gefühl (ich wage nicht, von einer Einsicht zu sprechen) verstärkt hat, Religion und Poesie - zu beider Gedeihen oder beider Verderben - hätten wesentliche Eigenschaften gemeinsam, so dass diesen nachzuforschen für die Erkenntnis beider Bereiche fruchtbar sein könnte. Zunehmend will mir scheinen, dass Religion und Poesie selbst wie auch das Unverständnis und die Gleichgültigkeit beiden Bereichen gegenüber, ja der Widerwillen gegen beide (der allerdings im Fall der Poesie oft gar nicht eingestanden wird), auf eine ihnen gemeinsame Wurzel schließen lassen.
Christentum ist vieldeutig
Bekanntlich ist das Christentum etwas Vielfältiges und Vieldeutiges, ja wohl auch etwas Widersprüchliches oder auch nur Heterogenes und jedenfalls nichts ein für alle Male Festgelegtes. Angesichts dieser geradezu babylonischen Lage sei das Christentum hier als das verstanden, was durch jene Glaubensinhalte bestimmt wird, die ihrerseits Bezugspunkte der Lavantschen Dichtung sind. Nicht zufällig sind es einige der Glaubensinhalte, die häufig als für die meisten christlichen Bekenntnisse und Zeitalter zentral angesehen werden: Es gibt nur einen Gott und er ist allwissend, allmächtig und allliebend und Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Sündenfall (die Erbsünde oder Erbschuld) hat die Vertreibung aus dem Paradies verursacht und damit auch Leid und Sterblichkeit. Jede einzelne menschliche Seele aber ist unsterblich. Die Menschwerdung Gottes in Christus und der Opfertod Christi machen die Versöhnung der Menschen mit Gott möglich. Die Menschen, die Christus nachfolgen und Leid und Sterblichkeit - auch für andere oder anderes - auf sich nehmen, erlangen den Himmel, also ewige Seligkeit.
Der Vielfältigkeit und Vieldeutigkeit des Christentums, aber auch der Unbestimmtheit der Gedichte Lavants entsprechend, ist diese Aufzählung fragwürdig, und man könnte auch darüber streiten, welche jener Glaubensinhalte tatsächlich zentral sind und welche nicht. (Spezifisch katholische Glaubensinhalte, wie die unbefleckte Empfängnis Mariens oder die Realpräsenz Christi in der Eucharistie, ob man sie als für das Christentum im Allgemeinen zentral hält oder auch nicht, sie sind für die Lavantsche Dichtung jedenfalls nicht von entscheidender Bedeutung.)
Den Rahmen des Christlichen vorausgesetzt, scheint es zunächst nicht allzu schwierig, das Gedicht zu paraphrasieren und seinen Sinn zusammenzufassen: Da wird Gott von einem Ich angeredet, das eigentlich genug hätte von dieser Welt, von ihrem Schein, ihrem Sonnenschein und Vogelgesang, von dem Leiblichen, das mit dem Irrtum und mit der Schuld der Seele identifiziert wird. Doch so ungeduldig dieses Ich, diese Seele, ist, den Körper zu verlassen, es gelingt noch nicht. Der Ausweg, der in der Nacht (da das Licht der Sinne sozusagen ausgeschaltet ist) noch fühlbar war, die Freiheit, die schon vertraut schien, wird mit dem ersten, schwachen Morgenlaut eines Vogels wieder verloren. Mit dem Morgen erwachen auch die Sinne, der Leib, die Welt und die Natur mit ihren trügerischen Verlockungen, und die Seele wird wieder in Haft genommen. Deshalb betet das Ich darum, dass ihm die Sinne schwinden und Gott es zu sich nehmen möge. So scheinen die christlichen Vorstellungen von der Hinfälligkeit und Schuldhaftigkeit der sinnlich wahrnehmbaren Welt bestätigt.
Sieht man jedoch das Gedicht genauer an, so ist es vor seinem christlichen Hintergrund gar nicht so leicht zu begreifen. Mag es auch in jenem - aus vielen Lavantschen Gedichten vertrauten - leidensvoll abgründigen Ton anheben und mit der Geste einer demütigen und gebetsähnlichen Zwiesprache mit Gott - Ganz erblinden will ich, lieber Herr / auch nichts hören -, so wird dieser Ton spätestens in der achten Zeile Keine[Not]war mir je zu eigen,/ seit ich flüchtig diesen Leib betrat zweifelhaft und mit ihm die Form direkter, unmittelbarer und gebetsähnlicher Anrede. Eher wird hier erzählt und reflektiert - das Präsens wird vorübergehend durch das Präteritum ersetzt -, und der liebe Herr rückt ferner, ist nicht mehr unmittelbar präsent (oder wenigstens nicht mehr so stark fühlbar).
An dieser Stelle wird Distanz hörbar, und in Übereinstimmung damit nimmt die Redegestik etwas von einem Theatermonolog an, der von Ferne an die Rhetorik der Schlegel-Tieckschen Shakespeareübersetzungen erinnert. Was als flehentliches und gebetsähnliches Anreden Gottes zu beginnen scheint, verwandelt sich in eine Art Theaterrede an Gott. Die zunächst demütig anmutende Anfangsgeste verwandelt sich in die Vorführung eines, wie man meinen kann, im Anreden von Gott unangemessenen Selbstbewusstseins oder einer unangebrachten Souveränität.
Gebet und Revolte
Und eben dies zeigt sich auch in der seltsamen und tiefsinnigen Zwiespältigkeit des Schlangenbildes: Die Schlange ist bekanntlich schon in der Genesis, in der Erzählung vom Sündenfall Adams und Evas, das Symbol für die Verführung und das Böse. In dem Gedicht nun bezeichnet sich das lyrische Ich dennoch als so aufgeregt wie eine Schlange, die sich allzu ungeduldig häuten will, und auch als ruhlos, böse und verstimmt. Schlangenähnlich und böse ist also gerade jenes Ich, jene Seele, die es - in Übereinstimmung mit christlichen Vorstellungen, ja mit christlicher Sehnsucht nach Gott - eilig hat, den Leib und damit die Welt zu verlassen und die darum sogar betet (Gebete zu Gott stößt).
Liest man das Gedicht in diesem unter- oder hintergründigen Sinn, dann besteht es aus Fragen und Behauptungen, die geradezu ihre eigene Negation bedeuten können: Womöglich will dann das Ich des Gedichts gar nicht erblinden und auch nicht nichts hören.
Es ist jedoch nicht das letzte Wort des Gedichtes, dass es auf subtile Weise das Jenseitige und den jenseitigen christlichen Gott verspottet oder gar lästert und dagegen die Schönheit der Welt, des Sinnlichen ins Treffen führt. Denn für eine weitere Reflexion mögen die Bilder wieder gemäß einer durchaus rechtmäßigen christlichen Bedeutung lesbar sein: Man könnte dieses Verhalten des Ich, das sich in schlangenhafter Ungeduld, Ruhelosigkeit, Bösheit und Verstimmung äußert, sehr wohl auch als Irrtum oder Schuld im christlichen Sinn verstehen, als eine Versuchung durch die Schlange. Die damit einhergehende Entwertung der Schöpfung als sinnlos - sinnlos reift der Sonne Morgenrose - ist ja keineswegs selbstverständlich in Übereinstimmung mit christlichen Vorstellungen.
Vielleicht also führt dieses seltsame Zwiegespräch, führen die Fragen und Behauptungen die für das redende Ich selbst unwillkürliche oder unbewusste Selbst-Entblößung eines im christlichen Sinn sündhaften Verhaltens vor. Es könnte sein, dass sich in diesem Gedicht zeigt, wie ein Ich einer bestimmten subtilen Verführung durch die Schlange anheimfällt. Und der anmaßend vertrauliche, so kühle wie souveräne und zugleich hoffärtige Ton des Gedichts verriete dann, dass das halbe Eingeständnis dieser Schuld - im Bild des Ich als Schlange und explizit in dem Vers Wenn ich jetzt Gebete zu dir stoße/ ist es bloß der Seele Ungeduld - die reinste Pose oder Koketterie ist und die Sünde keineswegs aufhebt, sondern, im Gegenteil, verdoppelt.
Angenommen, die erwähnten Glaubensinhalte sind tatsächlich zentral, sind gleichsam die Grund-Sätze oder Axiome des Systems Christentum: Wäre dann vom Christentum nicht zu erwarten, dass jene Grundsätze nicht als mehrdeutig oder gar widersprüchlich gedeutet werden müssen?
Das Christentum ist aber eine Religion, in der Mehrdeutigkeiten und, vielleicht als ihre Folge, Widersprüche oder Paradoxa naheliegen.
Einige bekannte und einfache Beispiele dafür: Wenn Gott allwissend ist und also immer schon gewusst hat, dass Adam und Eva die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis essen würden, wie kann dann der freie Willen des Menschen behauptet werden? Oder: Wenn Gott allmächtig ist und alliebend, dann steht das doch im Widerspruch dazu, dass er auch das Böse geschaffen hat? Wenn er das Böse aber nicht geschaffen hat, dann ist er doch nicht allmächtig. Hat er aber auch das Böse geschaffen, dann ist er doch nicht alliebend. Oder: Wenn Gott alliebend ist, wie kann er dann das Leiden zulassen, etwa das Leiden von nach allen vernünftigen Maßstäben Unschuldigen, wie etwa jenes von Kindern (das ist die bekannte Frage des Ivan Karamasov).
Wie immer unterschiedlich sich Poesie und Religion zum Auftreten von Mehrdeutigkeit und Widerspruch verhalten mögen: der Widerspruch und Mehrdeutigkeit spielen sowohl in der Poesie eine zentrale Rolle als auch in der christlichen Religion - in der Heiligen Schrift und auch im religiösen Leben selbst, in den Gedanken und Taten der Gläubigen, im Verhältnis religiöser Erfahrungen Einzelner etwa zu den vorgegebenen christlichen Glaubensinhalten, aber auch in der Beziehung von Einzelnen zu ihrer kirchlichen Institution.
Im Werk Christine Lavants, das gleichermaßen durch die Forderungen der christlichen Religion wie durch jene der Poesie bestimmt wird, sind nicht zuletzt deshalb die Mehrdeutigkeiten und Widersprüche als Ausdruck gegenläufiger Kräfte und Mächte allgegenwärtig; die meisten ihrer Gedichte entfalten Widersprüche oder Gegensätze in vielfältiger Weise.
Das Ausserordentliche (und in der Literatur der Moderne so Seltene) an den Gedichten Lavants: sie tragen in hohem Maß jene christlichen Widersprüche oder Gegenläufigkeiten aus. Und dass dies auch im Zeitalter ästhetischer Autonomie, das auch das Zeitalter ubiquitärer Säkularisation zu sein scheint, so überzeugend geschieht, könnte das nicht dazu veranlassen, das Verhältnis von Poesie und christlicher Religion als etwas noch keineswegs Abgeschlossenes oder Abgetanes zu denken? Denn wenn es so ist, dass der Bezug auf die christliche Religion als vorgegebene Ordnung zu ästhetisch überzeugenden Werken führen kann, liegt dann nicht nahe, dass nicht nur die Poesie notwendig und (auf ihre eigene Weise) erkenntnisgemäss und wahrheitsfähig ist - was ohnehin häufig und leichtsinnigerweise als selbstverständlich vorausgesetzt wird -, sondern, allen zuwiderlaufenden Befunden zum Trotz, auch die christliche Religion, wenigstens in der Dichtung oder in den Künsten überhaupt?
Wie aber, wenn der gegenteilige Schluss gezogen würde? Wie wenn man daraus, dass eine christlich so stark bestimmte Poesie wie die Christine Lavants ästhetisch überzeugend wirken kann - während das Christentum dennoch als kulturelle Kraft ihrerseits, wenn nicht als tot, so doch als periphär erfahren wird (als nicht erkenntnisgemäss oder wahrheitsfähig und ohne eigentliche kulturelle Notwendigkeit) -, schlösse, dass auch die Poesie - wie für Nietzsche Gott - gestorben oder wenigstens periphär geworden sei?
Mit diesen Fragen wird ein Horizont erahnbar, und der Versuch, sie zu beantworten, lässt vor allem Unbestimmtes und Vieldeutiges fühlbar werden und Paradoxa entstehen, die immer dann zu Tage treten, wenn man das, was man Kultur nennt, als Ganzes zu denken versucht, also gleichsam von aussen zu sehen, während man doch dazu verurteilt ist, an ihr teilzunehmen. Denn es gehört zum seltsam unbestimmten, vieldeutigen oder auch widersprüchlichen Begriff unserer Kultur, dass wir, an ihr teilnehmend, dennoch herauszufinden suchen, wie oder was sie eigentlich ist, so als wäre sie etwas Anderes, ein Gegenstand unserer Erkenntnis, den wir objektiv, von aussen, erkennen könnten Welche Kräfte also diese, unsere Kultur tatsächlich bestimmen, was ihr, um Robert Musils Wort zur lyrischen Dichtung zu zitieren, innerster Brunnen ist, ob sie eher - bildlich für die Poesie, wörtlich für die Religon - eine heilige Kapelle ist oder - wörtlich für die Poesie, bildlich für die Religion - eine Art Gedicht, oder ob sie vielmehr jenes weltliche Haus ist, in dem das Verstandesgemässe und seine Anwendungen Poesie und Religion längst ihres fiktiven und illusionären Charakters überführt haben, das sei hier anheimgestellt.
1 Die Bettlerschale, Salzburg 1959, S. 17.
Ganz erblinden will ich, lieber Herr,
auch nichts hören und die Sonne nimmer
zu mir nehmen in den Zwielichtschimmer,
meine Lippen mögen dürr und leer
wie die Hälften einer Hülse klaffen.
Wehr den Fingern das Zusammenraffen
aller Nöte, um sie dir zu zeigen.
Keine war im Grunde je mein eigen,
seit ich flüchtig diesen Leib betrat.
Nur - es dauert mir schon etwas lange,
und so aufgeregt, wie eine Schlange
sich zur Zeit der Häutung wohl benimmt,
geh ich ruhlos, böse und verstimmt
auf und nieder in dem kleinen Raum.
Was hilft mir der Fink im Birnenbaum?
Sinnlos reift der Sonne Morgenrose.
Wenn ich jetzt Gebete zu dir stoße,
ist es bloß der Seele Ungeduld,
die den Leib als Irrtum oder Schuld
schon zu lange mit sich schleppen mußte.
War's nicht, daß ich einen Ausweg wußte?
Gestern noch und fast bis Mitternacht.
Meine Freiheit schien mir schon vertraut.
Doch des Vogels schwacher Morgenlaut
hat mich wieder in die Haft gebracht.
Christine Lavant, Die Bettlerschale, S. 17
Alfred Focke
P. Alfred Focke SJ war ein Pionier der Grenzüberschreitungen zwischen Theologie und Poesie. 1916 in Teplitz-Schönau geboren, schrieb er nach einer Dissertation über Rilke zahlreiche Studien über moderne Literatur wie auch viele Artikel und Rezensionen für die Furche. Der damalige Feuilletonchef György Sebestyén schrieb am 1. September 1982 über Focke: "Sommer für Sommer durchwanderte er allein die Dolomiten. Diesmal kehrte er nicht zurück. Er ist verschwunden; vielleicht verunglückt, vielleicht einem Herzleiden erlegen. Wir hoffen immer noch: er könnte auftauchen, lächeln, seine Arbeit fortsetzen, als wäre nichts geschehen. Aber die Hoffnung ist gering. Es gilt, Abschied zu nehmen."
Seit dem 15. August war Alfred Focke verschollen. Gefunden hat man ihn erst neun Monate später: unter einem Felsvorsprung kauernd war er von einem Blitzschlag oder vom Herzschlag getroffen worden. Er hatte sich immer gewünscht, in der Bergeinsamkeit zu sterben.
Alfred Focke stand dem alternden Albert Paris Gütersloh bei und edierte dessen zwei letzte Bücher. Er war mit vielen Schriftstellern im Gespräch. Zwei von ihnen, Franz-Josef Czernin und Julian Schutting, erinnern sich für die Furche an Pater Focke.