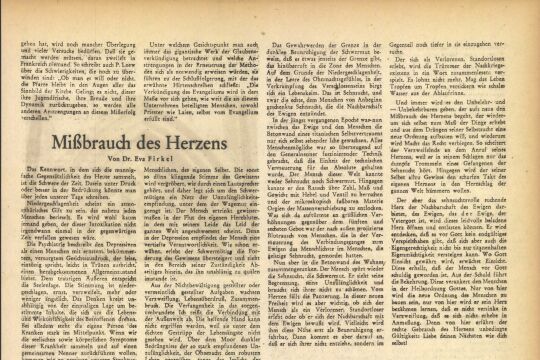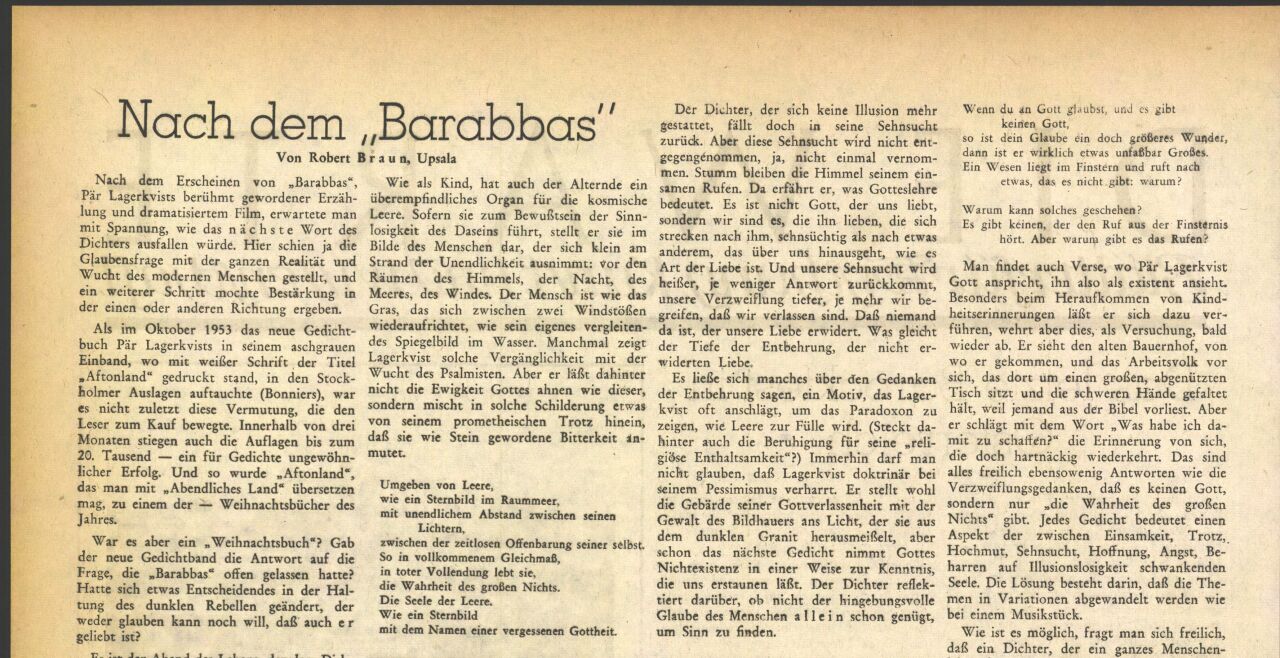
Nach dem Erscheinen von „Barabbas“, Pär Lagerkvists berühmt gewordener Erzählung und dramatisiertem Film, erwartete man mit Spannung, wie das nächste Wort des Dichters ausfallen würde. Hier schien ja die Gjaubensfrage mit der ganzen Realität und Wucht des modernen Menschen gestellt, und ein weiterer Schritt mochte Bestärkung in der einen oder anderen Richtung ergeben.
Als im Oktober 1953 das neue Gedichtbuch Pär Lagerkvists in seinem aschgrauen Einband, wo mit weißer Schrift der Titel „Aftonland“ gedruckt stand, in den Stockholmer Auslagen auftauchte (Bonniers), war es nicht zuletzt diese Vermutung, die den Leser zum Kauf bewegte. Innerhalb von drei Monaten stiegen auch die Auflagen bis zum 20. Tausend — ein für Gedichte ungewöhnlicher Erfolg. Und so wurde „Aftonland“, das man mit „Abendliches Land“ übersetzen mag, zu einem der — Weihnachtsbücher des Jahres.
War es aber ein „Weihnachtsbuch“? Gab der neue Gedichtband die Antwort auf die Frage, die „Barabbas“ offen gelassen hatte? Hatte sich etwas Entscheidendes in der Haltung des dunklen Rebellen geändert, der weder glauben kann noch will, daß auch er geliebt ist?
Es ist der Abend des Lebens, der dem Dichter diese Verse eingibt. Die Gefühle der Leere, des vorahnenden Ausgelöschtseins, der nüchternen Resignation, der wiederaufflammenden Sehnsucht, der Erinnerung und zugleich des Kampfes mit der verführerischen Erinnerung, des vergeblichen und doch wieder zu paradoxer Beruhigung führenden Grübelns, der Angst geben auch hier den Ton an. Das Gedicht „Der Tote“, das in der ersten der fünf Abteilungen steht, bedeutet eine Art Aufbruch.
Alles gibt es, nur ich bin vergangen, alles blieb, det Regenduft des Grases, den ich kenne, Windgebraus in Bäumen, Wolkenflucht, des Menschenherzens Unrast.
Nur die eigene Unrast gibt es nicht mehr.
Oft wird es deutlich, daß es auch hier „Barabbas“ ist, der spricht: der einsame, gleichsam zu dunklem Granit gewordene Titan des Nordens, der auf seinem Ich be- harrt und am liebsten mit den verquälten Fragen, die ihn beschäftigen, allein gelassen sein möchte. Er liebt das Zusammensein nicht. Er fühlt sich auch im Alter als Fremder.
So gibt Lagerkvist mit seinem neuen Buch wieder keine Antwort auf das große Thema, das er in „Barabbas“ angeschlagen hat. Aber es geschieht nicht erst mit diesem Buch, daß dieser Dichter gerade Glaubensfragen stellt und uns doch die Antwort schuldig bleibt. Das gesamte Lebenswerk, das im Schatten des ersten Weltkrieges aufwuchs, steht unter diesem Zeichen. Pär Lagerkvist bewegt sich seit über 30 Jahren auf dem schmalen Grat, der zwischen den Reichen des Glaubens und Nichtglaubens dahingeht.
Freilich bat der Dichter an sich nicht die Aufgabe, diese Dinge zu entscheiden, sondern sie in ihrer Menschlichkeit so darzustellen, daß sie lebensecht wirken. In diesem Sinn finden wir viele lyrische Schönheiten im „Abendlichen Land“. Etwa die Verse, die von seinem ersten großen Kindheitserlebnis zeugen.
Was geschah mir an dem Abend, an dem Hetbstabend, da ich Holz holte für die Mutter?
Ich erinnere mich so gut daran, an keinen Abend erinnere ich mich, wie an diesen.
Damals war’s, da sah ich sie zum erstenmal: die Sterne.
Mit den Holzstücken in den Armen sah ich in den Himmel, und da sah ich sie oben, umgeben von grenzenloser Schwärze.
Ich stand still. Und alles andere war vergangen, was vorher gewesen und was mein Besitz gewesen,
mein kleines Pferd mit den drei Beinen, mein Gummiball,
meine Freude, wenn ich erwachte am Morgen,
das Licht der Sonne, die Steinkugelri und die große Kugel aus Glas, all mein Spielzeug. •
Als ich wieder zur Mutter kam und die Holzstücke auf den Herd legte, merkte man sicher nichts an mir, ganz gewiß nicht.
Als ich mich aber auf den Schemel setzte, weit weg von den ändern, war ich kein Kind mehr.
Wie als Kind, hat auch der Alternde ein überempfindliches Organ für die kosmische Leere. Sofern sie zum Bewußtsein der Sinnlosigkeit des Daseins führt, stellt er sie im Bilde des Menschen dar, der sich klein am Strand der Unendlichkeit ausnimmt: vor den Räumen des Himmels, der Nacht, des Meeres, des Windes. Der Mensch ist wie das Gras, das sich zwischen zwei Windstößen wiederauf richtet, wie sein eigenes verleitendes Spiegelbild im Wasser. Manchmal zeigt Lagerkvist solche Vergänglichkeit mit der Wucht des Psalmisten. Aber er läßt dahinter nicht die Ewigkeit Gottes ahnen wie dieser, sondern mischt in solche Schilderung etwas von seinem prometheischen Trotz hinein, daß sie wie Stein gewordene Bitterkeit inmutet.
Umgeben von Leere, wie ein Sternbild im Raummeer, mit unendlichem Abstand zwischen seinen Lichtern,
zwischen der zeitlosen Offenbarung seiner selbst. So in vollkommenem Gleichmaß, in toter Vollendung lebt sie, die Wahrheit des großen Nichts.
Die Seele der Leere.
Wie ein Sternbild mit dem Namen einer vergessenen Gottheit.
Der Dichter, der sich keine Illusion mehr gestattet, fällt doch in seine Sehnsucht zurück. Aber diese Sehnsucht wird nicht entgegengenommen, ja, nicht einmal vernommen. Stumm bleiben die Himmel seinem einsamen Rufen. Da erfährt er, was Gotteslehre bedeutet. Es ist nicht Gott, der uns liebt, sondern wir sind es, die ihn lieben, die sich strecken nach ihm, sehnsüchtig als nach etwas anderem, das über uns hinausgeht, wie es Art der Liebe ist. Und unsere Sehnsucht wird heißer, je weniger Antwort zurückkommt, unsere Verzweiflung tiefer, je mehr wir begreifen, daß wir verlassen sind. Daß niemand da ist, der unsere Liebe erwidert. Was gleicht der Tiefe der Entbehrung, der nicht erwiderten Liebe
Es ließe sich manches über den Gedanken der Entbehrung sagen, ein Motiv, das Lagerkvist oft anschlägt, um das Paradoxon zu zeigen, wie Leere zur Fülle wird. (Steckt dahinter auch die Beruhigung für seine „religiöse Enthaltsamkeit“?) Immerhin darf man nicht glauben, daß Lagerkvist doktrinär bei seinem Pessimismus verharrt. Er stellt wohl die Gebärde seiner Gottverlassenheit mit der Gewalt des Bildhauers ans Licht, der sie aus dem dunklen Granit herausmeißelt, aber schon das nächste Gedicht nimmt Gottes Nichtexistenz in einer Weise zur Kenntnis, die uns erstaunen läßt. Der Dichter reflektiert darüber, ob nicht der hingebungsvolle Glaube des Menschen allein schon genügt, um Sinn zu finden.
W enn du an Gutt gLubsl, und es gibt keiöen Gott,
so ist dein Glaube ein doch größeres Wunder,
darin ist er wirklich etwas unfaßbar Großes.
Ein Wesen liegt im Finstern und ruft nach etwas, das es nicht gibt: warum?
Warum kann solches geschehen?
Es gibt keinen, der den Ruf aus der Finsternis hört. Aber warum gibt es das Rufen?
Man findet auch Verse, wo Pär Lagerkvist Gott anspricht, ihn also als existent ansieht. Besonders beim Heraufkommen von Kindheitserinnerungen läßt er sich dazu verführen, wehrt aber dies, als Versuchung, bald wieder ab. Er sieht den alten Bauernhof, von wo er gekommen, und das Arbeitsvolk vor sich, das dort um einen großen, abgenützten Tisch sitzt und die schweren Hände gefaltet hält, weil jemand aus der Bibel vorliest. Aber er schlägt mit dem Wort „Was habe ich damit zu schaffen?“ die Erinnerung von sich, die doch hartnäckig wiederkehrt. Das sind alles freilich ebensowenig Antworten wie die Verzweiflungsgedanken, daß es keinen Gott, sondern nur „die Wahrheit des großen Nichts“ gibt. Jedes Gedicht bedeutet einen Aspekt der zwischen Einsamkeit, Trotz, Hochmut, Sehnsucht, Hoffnung, Angst, Beharren auf Illusionslosigkeit schwankenden Seele. Die Lösung besteht darin, daß die Themen in Variationen abgewandelt werden wie bei einem Musikstück.
Wie ist es möglich, fragt man sich freilich, daß ein Dichter, der ein ganzes Menschenleben lang über diese Fragen nicht hinauskommt, sie wirklich ernst nehmen kann. Gewiß ergeben sich aus dieser ständigen Situation des Zweifels bisher unbekannte Aspekte, woraus sich Provinzen der Dichtung gewinnen lassen, die bisher weiße Flecke auf der Karte der Seele gewesen sind. Und gewiß ist auch, daß Pär Lagerkvist zu den Entdeckern und Eroberern gehört, die die schwedische Literatur in diesem Sinn bereichert haben. Auch „Aftonland“ ist eine neue Provinz,
Kann es aber dem Menschen, für den diese Fragen die Existenz selber bedeuten, genügen, daß er Antworten erhält, die nur innerhalb der Poesie gelten? Natürlich werden sich hier der ästhetisch und der religiös Gerichtete verschieden verhalten. Es kann aber nicht geleugnet werden, daß unsere Zeit — aus ihrer Existenznot heraus — auch von der schönen Literatur mehr und mehr die Antwort fordert, die aus dem Kern der Menschlichkeit stammt und sich mit unverbindlichen Aussagen, auch wenn sie genial sein mögen, nicht zufrieden gibt. Wenn die Poesie poetische Antworten auf poetische Fragen erteilt, so mag der Schwebezustand, der dadurch entsteht, seinen besonderen Reiz haben — frühere Jahrhunderte haben ihn ausgekostet —, doch engagiert gerade das Thema des Glaubens den Menschen so bis in sein innerstes Leben, daß er auch von dem diese Fragen wagenden Dichter den gesamten Einsatz voraussetzt. Mit ändern Worten: er wünscht, daß dieser nicht bei seiner privaten Religiosität, im vorliegenden Fall bei einem „religiösen Atheismus“ haltmache, sondern sich selbst mit dem Faktum und der Tradition des Christentums konfrontiere. Daß er die Wahrheitsfrage mit dem Ernst stelle, den mit Versen zu umgehen keine Poesie mächtig genug ist.
Das mögen gewisse Bedenken gegenüber Pär Lagerkvist sein. Von diesen Bedenken aber abzusehen, hieße im Grunde, ihm weniger gerecht werden. Denn erst wenn wir uns damit abfinden, daß diesem aus bestimmten Gründen gehemmten Dichter seine Dichtung teurer als jede religiöse Eindeutigkeit ist, können wir seine Werte besser würdigen. Er hält sich ja in einem Gebiet auf, das man sonst gern schnell, ja voreilig durchmißt, weil der ständig ungelöste Zweifel an einem zehrt, das Leben unfruchtbar macht. Man möchte gern mit den ändern am Ziel sein, ob zur Verwerfung oder Bejahung. Wenn nun Pär Lagerkvist in diesem sonst gemiedenen Gebiet gerade verweilt, ja sich ein ganzes Leben lang seiner Niederung aussetzt, so bedeutet das nicht zuletzt, daß er Werte, die bei religiöser Voreiligkeit verlorengehen, bewahrt. In der Tat holt er seit Jahren Schätze aus der Tiefe seiner Seele herauf, die nicht da wären, wenn er sich dieser Arbeit nicht unterzöge. Das Ahnen der Gottheit, das doch wieder durch seinen hartnäckigen Sinn für Realität zurückgestaut wird, der Schmerz des Verlassenseins und die daraus sich ergebenden, zu fast mystischen Paradoxen führenden Gedanken — Lagerkvists Lyrik ist oft reine Gedankenlvrik —, all dies wird durch seinen langen Aufenthalt im Raume des Zweifels ans Licht gefördert. In diesem Sinn erscheint doch wieder ein Dank für eine Arbeit be - rechtigt, die sonst vielleicht von keinem ändern geleistet würde.