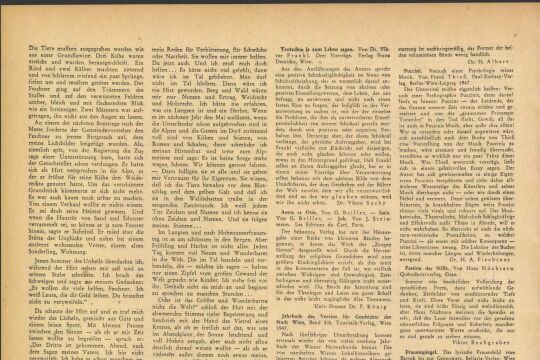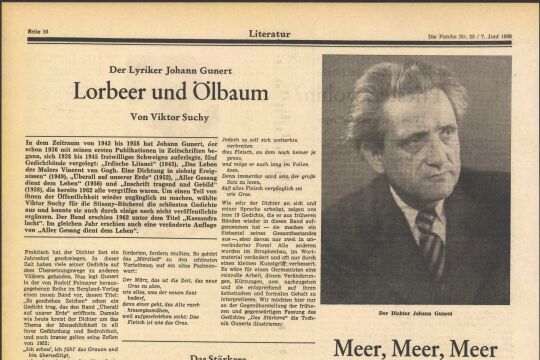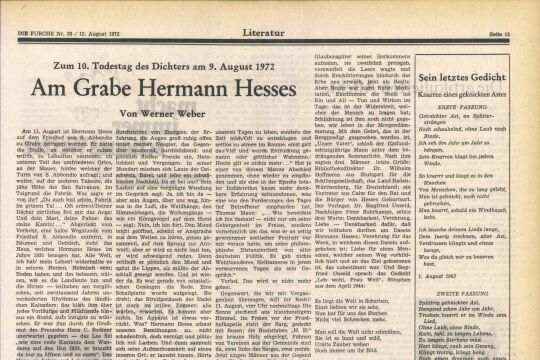Im Jahre 1967 erschien im Heimatverlag Krems als 55. Band einer Reihenproduktion ein schmales Bändchen merkwürdiger Kurzgeschichten unter dem Titel „Der Himmel war lila“. Die sieben kleinen Erzählungen geben den Preisrichtern recht, die 1964 ihrem Verfasser, dem in Villach lebenden steirischen Dichterarzt Heinz Pototschnig den Kurzgeschichtenpreis der Peter-Rosegger-Stiftung verliehen haben. Ein Jahr später bereits erhielt der Dichter den Theodor-Körner-Preis für Literatur und zwei Jahre darauf den Ludwig-Ficker- Gedächtnispreis.
Die Leser und Kenner der von Hans Leb begründeten und Inzwischen leider nicht mehr erscheinenden Literaturzeitschrift „der bogen“ werden ihn als deren Autor und Mitherausgeber, der diese Zeitschrift nach dem Tode Hans Lebs allein weitergeführt hat, noch in lebendiger Erinnerung haben. Sie werden feststellen können, daß seine Prosa, die erst der Roman, an dem der Autor arbeitet, voll entfalten wird, und die in klaren, einfachen Sätzen das Reale zu beschreiben scheint, dennoch mit seiner zunächst verschlüsselt anmutenden Lyrik korrespondiert, denn plötzlich leuchtet aus den einfachen Situationen und den Sätzen, die sie schildern, das Andere, Geheimnisvolle, Fremde, das Irreale und Surreale, eben der „Anemonentraum“ auf, den dieser Dichter in seiner Lyrik sucht und beschwört. Der Arzt, so könnte man vielleicht sagen, auskultiert die Wirklichkeit, befragt ihre Innen- und Hinterwelt mit dem Stethoskop des lauschenden Künstlers und versucht mit den empfindlichsten Sonden ihre Tiefe auszuloten. Das ist der Sinn seiner 1965 erschienenen lyrischen Legende für Stimmen, „Lotungen“. In ihnen und in vielen seiner Gedichte hält er unserer zerrissenen, von tausend Widersprüchen geprägten Zeit so merkwürdig verschlüsselte Sätze entgegen, wie etwa diese:
„Die Flöte im Hollunder war weiß und trunken. In den schwarzen Beeren wohnt ein langer Winter. Auf den Gerüsten der Nacht steige ich ab: niemandes Auge, niemandes Pulsschlag. Sternenhaar flicht Leitern, die der erste Amselpfiff zerreißt. Im Jagdruf der Katze kreuzt mein Schritt den Einhornweg.“
Vor dem Fenster dieses Dichters ist nach seinen eigenen Worten „die Nacht als Muschel gespannt, in der das Echo des Tages brandet“. Wenn wir ihn nach seinem Wollen als Wortkünstler befragen, würde er uns vielleicht mit den Worten aus den „Lotungen“ antworten:
„Das Ohr ins Ohr legen und die toten Stimmen hören aus dem Hufschlag der Wolken und den Mohn nehmen, weil er schwarz ist, wenn die Sonne ihre Hand von ihm gezogen hat “ Denn „den Rest teilen die Sterne“, wie es in einem anderen Gedichtband Pototschnigs heißt. In seinem Versbuch „Nachtkupfer“ erklärt er uns auch, warum dies so sei:
Immer Kurz
fällt der Schatten vom federnden Schaft, ist es Mittag. Nur der Abend in langen Gesprächen preist sich.
Wenn Pototschnig für seine Freunde auch wie ein Kärntner redet, so ist er in Wahrheit doch ein echter Steirer, der am 30. Juni 1923 in Graz zur Welt kam. Die Linien seiner Vorfahren reichen bis ins 16. Jahrhundert einerseits in die kulturträchtige Südsteiermark, anderseits ins obere Murtal. Seine Kindheit hat er allerdings in Kärnten verbracht, seine ärztlichen Studien in Graz, Berlin und Innsbruck absolviert, wo er auch zum Doktor der gesamten Heilkunde promoviert wurde. Wer sein lyrisches Werk, die Versbände „Schatten schrägen ins Licht“, 1961, „Nachtkupfer“, 1962, „Den Rest teilen die Sterne“, 1963, und die bereits zitierten „Lotungen“ als Zeugnisse der „Moderne“ empfindet, der ist zweifellos im Recht, denn es trägt unverkennbar alle Züge des modernen Gedichts: sie kommen vom modernen Dinggedicht, dem die scharfe und genaue Beobachtungsgabe des Autors bei der Gestaltung zu Hilfe kommt, ebensosehr her wie sie die surrealen Elemente des Traums mit ihrer Technik der Assoziationen enthalten. Pototschnig zählt sich durchaus zu den Leuten, „die niemanden überzeugen wollen“, wie er es in seinem Referat auf den St.-Veiter-Kulturtagen bekannt hat, das sich mit den „Wegen und Wesen neuer Lyrik“ befaßt hat. Man kann es in der Nummer vom 3. Dezember 1966 der Schweizer Zeitung „Die Tat“ nachlesen. Darin findet sich die Charakteristik jener Leute, die niemandem ihre Überzeugung auf drängen wollen: „Sie sehen, hören, zeichnen auf und stellen zur Verfügung. So ist es, es ist so — für mich. Zugleich fragen sie: Und du? Wie siehst du es? Was hörst du?“ — Fast könnte man in Analogie zur Kunstform des „personalen Romans“, der das erzählende Ich zum Verschwinden gebracht hat, auch vom „personalen Gedicht“ sprechen, das auch zur „Rollenmaske“ eines Lyrischen gemacht wird, das sich tausend und abertausend Möglichkeiten der Aussage vorbehalten hat. Damit tritt auch das Ich des Dichters gemäß den Gesetzen moderner Lyrik in Pototschnigs Gedichten völlig zurück, es verbirgt sich geradezu in der sowohl erzwungenen als auch selbst gewählten Einsamkeit des modernen Menschen. Etwas von dieser Einsamkeit weht uns auch aus den Kurzgeschichten entgegen, etwa aus der Sylvester-Erzählung „Zero“. Ja, der Dichter erteilt sich noch selber den Befehl zur Einsamkeit.
SEI EINSAM!
Sei Stein und allein.
Hasel,
Eichel,
Nuß schließen sich ein.
Die Süße im Kern ist ohne Geschwister.
Um diese geradezu schicksalhafte Einsamkeit des Menschen, um dieses im Letzten Nicht-zueinander-flnden-Können, auch unter Liebenden, geht es in der lyrischen Legende für Stimmen, die in Bitterkeit endet. Was in ihr in vielfältigen Variationen ausgesagt wird, klingt sehr verschlüsselt, sehr hermetisch. Der Leser wird bei ihrer Lektüre nach Pototschnigs dichtungstheoretischer Ansicht tatsächlich in ein von ,,Span- nungspunkten“ begrenztes „Spannungsfeld“ gestellt:
„Jeder Spannungspunkt“, so lautet die Theorie des Autors, „ist ein Richtstrahler. Jeder Richtstrahler — im Leser oder Hörer — eine bestimmte, gewollte und unausweichbare Assoziation. So wird in ihm ein Grundbild geweckt, dessen Variante — aber nur sie — ihm allein gehört. So wird der Schöpfungsakt des Dichters das Gesicht des Erlebnisses dessen, der es aufnimmt, annehmen.“ Mit anderen Worten, der lyrische Dichter verlangt hier im Grunde dasselbe, das schon Bertolt Brecht von seinem Publikum verlangt hat: „Seine Vorstellung muß der Nachvollzug des schöpferischen Anrufes sein.“ Diesen Anruf erfahren wir auch in Pototschnigs Kurzprosa, deren Hermetik eben erst hinter den real hingesetzten Sätzen, in der mehrbödigen Situation der jeweils dargestellten Wirklichkeiten beginnt. Man lese daraufhin sehr aufmerksam den kleinen Dialog zwischen dem Hirtenmädchen und dem Bienenzüchter in der Erzählung „ und ein Körnchen Salz“, die durch ihre nach klassischen Vorbildern inspirierte ruhige Bildersprache bestätigt, daß dieser der Ästhetik der Gegenwart verpflichtete Dichter die „Moderne“ weder als kritischen noch als werthaltigen Begriff für seine eigene Dichtung gelten lassen will. Er ist vielmehr der Meinung, daß auch die sogenannte moderne Dichtung noch immer an ihre Vorgänger anschließe, da ja jeder Dichter sozusagen auf den Schultern seiner Vorgänger stehe.
Pototschnig zählt zumindest für seine erste Schaffensperiode, die von 1945 bis 1947 reicht, durchaus noch Rilke und Weinheber zu seinen nachahmenswerten Vorbildern. Für die zweite Periode, die nach einer Schaffenspause von 13 Jahren im Jahre 1960 beginnt, ist dann allerdings schon die Bilderund Ausdruckswelt der Gegenwartslyrik, vor allem ihre Assoziationstechnik für sein lyrisches Gestalten maßgebend. Das heißt nun nicht, daß er etwa die alten lyrischen Formen und Ausdrucksweisen, wie Reim und Strophenbau, gänzlich verwirft. In seinem ersten Band, „Schatten schrägen ins Licht“, findet sich beides: das traditionell gereimte Strophengedicht und die freirhythmische, von streng kontrollierten Assoziationen beherrschte Gedichtform. Aber es ist bezeichnend, daß schon eines der ersten Gedichte dieses Bandes deutlich den schöpferischen Weg zeigt, den dieser Dichter nun immer konsequenter nehmen wird: er führt von einem Bild oder Bildeinfall oder auch von einer ihn faszinierenden Wortgruppe über die schöpferische Meditation zu weiteren Bil- dern. Das zeigt besonders schön seipjX f j tiQjjißvn ' •jsmiru
Die Federn des Hähers am Fuße der Eiche sind seine Wünsche.
Blau
mit einem Tropfen Ted zwischen Galläpfeln.
Ein Libellensprung zwischen schwankenden Schilfen ist meine Hoffnung.
Dunkel
läuft der Schatten im flüssigen Licht.
Mein Herz wohnt im Schlehdorn.
Hier gebiert sozusagen der Anblick ganz konkreter Häherfedern alle weiteren Bildaussagen aus der notwendigen Meditation. Der kontrollierende Intellekt schaltet dabei alles Überflüssige aus und zeichnet fast in abstrakten Linien, fast im Sinn einer musikalischen Abbreviatur Weberns, das innere Erlebnis nach. Wenn man nun den Dichter nach den Kriterien seiner Sprachkunst befragt, so nennt er spontan: Musikalität, Bildhaftigkeit und den kontrollierten Gedanken. Er verwendet den Reim nur noch dort, wo er ihm notwendig erscheint und keine hemmende, konventionelle Fessel bildet. Noch aus den chiffrierten und verschlüsselten Gedichten dieses Autors spricht eine tiefe Naturverbundenheit, ein Einklang mit der Landschaft, in der er lebt, mit der Kreatur, für die das Auge des Arztes einen besonders geschärften Blick besitzt. Das Gedicht „Grüner Gott“ legt ein besonders schönes Zeugnis von Pototschnigs Naturfrömmigkeit ab.
GRÜNER GOTT,
ich gebe dir deine Wiesen zurück, den Schleier deiner Lärchen, das Lächeln im Trieb der Fichten, den gebündelten Ernst in den Föhren.
Nimm deine Hand aus den Buchen, ich will ruhlos werden, ich will das Schwert in der Eiche suchen und den Pappeln das Zittern verwehren.
Grüner Gott, warte im Wasser auf mich, ich will den Weiden sagen, daß sie dich wecken, wenn ich komme: ein Lied auf einer Maiflöte zu spielen.
Die gleiche Natur und Dingfrömmigkeit spricht auch au der schon zitierten Kurzgeschichte „ und ein Körnchen Salz“:
„Vor Stunden ist Simon zur Hütte gekommen, den Feldweg herauf, hat seine Hand in den Bach getaucht, dem Wiesel nachgesehen, das, ein brauner, federnder Ball, seinen Weg querte, und seinen Rucksack ausgepackt. Jetzt liegt ein Laib Brot auf dem Tisch, riecht nach Korn und Glut, ist weiß bestaubt von Mehl und gesellt sich dem Salz in der hölzernen Schale neben ihm. Eine Kanne Wein und ein Krug öl hüten das Dunkel in der Ecke, wo der Tisch im rechten Winkel von der Bank umfaßt wird, die den Wänden des Raumes folgt. Neben der Tür, der Feuerstelle zur Seite, sind Knüppel geschichtet, kurz und handlich, während eine blank geriebene Pfanne, rund und eisern, mit langem Stiel an der Wand hängt. Die Stube ist aufgeräumt und blank gefegt und vor der Schwelle liegen helle Kiesel aus dem Bach. Alles ist Simons Werk. Jetil SitÜ bb frW- Ostschälfeh der j tt .'W I O hr an die Bretter de , Bięnensęhl ges egt u rufet | wahrend er auf die Stimmen der Immen hort, die dem Wiesel ihre Tracht bringen. Das Zirpen der Grillen liegt wie ein Netz über dem Hang, an dem zuweilen das träge, baßgefärbte Quaken eines Frosches zerrt. Die Sonne steigt auf den Stufen der Westberge herab. In der Windharfe flüstern die Blätter der Zweige, die Simon von den Birken geholt und an die Tür gesteckt hat, weil die Nacht naht, die dem Pfingstfest vorangeht “
An dieser ding- und naturfrommen Prosa erkennt man den Augenmenschen und von aller Schönheit des Lebens ergriffenen, vom Naturgeheimnis angerührten Lyriker Heinz Pototschnig.
Dem Dichter ist es allerdings im Angesicht so vielen Dunkels in der Welt versagt, immer auf der „Maiflöte“ zu spielen oder den „Anemonentraum“ zu suchen. Er horcht mehr und mehr nach innen, und gar oft will es ihm vor dem innerlich Gehörten und Geschauten die Rede verschlagen, ihm, den Heimito von Doderer einmal als einen „neuen Stern“ begrüßt hat, der im südlichen Kärnten für die Bewunderer lyrischer Dichtung aufgegangen ist und dessen Werk heute dank der Ungunst des österreichischen Verlagswesens nur mehr den Kennern bekannt ist. Pototschnig hat sich wohl nicht mit der hochgespielten Problematik einer manipulierbaren Sprache in der vielfoerufenen „Repressionsgesellschaft“ expressis verbis befaßt, aber auch er weiß um die Gefährdung des schöpferischen Menschen, und an ihn und uns geht seine ernste Mahnung:
In der Nuß
aus zwei hohlen Händen
trage das Licht. Ein gläserner Schmetterling bricht, versucht er die Flügel zu regen. Die leuchtende Flamme sticht, will sie der Atem bewegen. Verbrenne dich nicht!
Kulturnotizen
• Carl Orffs „Carmina burana“ und „Trionfo di Afrodite" werden im Rahmen des Flandern-Festivals am 14. September in Brüssel durch den Chor und das Orchester des Belgischen Rundfunks auf geführt.
• Das Opernhaus Zürich, das in den letzten drei Jahren Hans Werner Henzes „Undine" (Schweizer Erstaufführung), Paul Hindemiths „Mathis,, der Maler", Wolfgang Fortners „Bluthochzeit", Luigi Nonos „Der rote Mantel" (Schweizer Erstaufführung) und Heinrich Sutermeisters „Madame Bovary" (Uraufführung) aufführte, plant für die nächste Saison die Schweizer Erstaufführung von Henzes „II re cervo“. Die musikalische Leitung hat der Komponist. Regisseur und Bühnenbilder: Jean Pierre Ponnelle.
• Die holländische Erstauführung von Hans Werner Henzes „Musen Siziliens" wird unter der Leitung des Komponisten in einem Konzert des Concertgebouw-Orkest am 27. Oktober stattfinden.