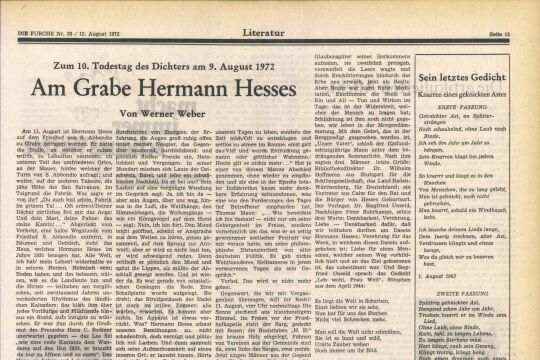Gedanken über Eduard Mörike zum 200. Geburtstag.
Eduard Mörike, der schwäbische Dichter und Pfarrer, erfuhr im Leben wenig von dem, was man unter Glück versteht. Als Dichter konnte er sich nur sehr allmählich im Bewusstsein festsetzen; stärkeren Erfolg zeitigte erst sein letztes Werk, die reife Novelle "Mozart auf der Reise nach Prag". Zeit seines Lebens begnügte er sich mit einer kleinen und recht stillen Gemeinde. Erst als sich das Grab über ihm geschlossen hatte, wuchs die Zahl seiner Leser, zumal allenthalben in den Konzertsälen Lieder nach seinen Texten erklangen, von Louis Hetsch über Carl Loewe bis zum wichtigsten seiner Tonsetzer, Hugo Wolf.
In stillen Bahnen sehen wir sein Leben dahingehen. Wenn wir bei vielen schwäbischen Dichtern beobachten, wie ein bisweilen starrsinniges Festhalten an der engeren Heimat ihr Leben einschränkt, sie in eine den Romantikern sonst fremde Enge drängt, so macht darin Eduard Mörike keine Ausnahme. Vor den Gefahren des Philisterhaften oder der Spießbürgerlichkeit bewahrt ihn freilich sein ausgeprägter Humor, seine hohe Bildung und ein unbesiegbar künstlerisch bestimmter Geist.
Keine Biedermeier-Idylle
Schicksalsschläge treffen schon den Knaben, der bald einen ihm nicht genehmen, oft verwünschten Beruf aufnimmt, den geistlichen nämlich, bei dem es nicht genügen mag, nur erwählt und berufen zu sein. Kränklichkeit verfolgt ihn von früh an. Dazu gesellen sich, so anspruchslos er ist, finanzielle Nöte, aus denen er kaum je herauskommt. Das wird begreiflich, wenn wir staunend erfahren, dass er in einem langen Leben kaum mehr als 5.000 Euro mit seinen Werken verdiente.
Auch in der Liebe fällt dem Dichter kein heiteres Los. Zwar findet diese Erweckerin lyrischer Kraft auch den Weg zu ihm, und er strömt seine Sehnsucht in phantasievollen Gedichten aus. Im Leben aber reißen ihm die Kränze, die er der Liebe flicht, die Hände blutig. Die blonde Kusine, der des Knaben erste Neigung gilt, wählt einen anderen. Die jäh aufflammende Leidenschaft für die geheimnisvolle "Peregrina" bringt ihn dem Wahnsinn nahe. Die geliebte Braut darf er nicht heimführen. Und nachdem er die Höhe der Lebensbahn schon überschritten hat, in einer intelligenten und gebildeten Frau die Lebensgefährtin findet, da reißen widrige Umstände die beiden auseinander. So sieht kein Idyll aus und auch kein Leben, das glücklich genannt werden dürfte.
Früh auch erwacht Musikalität, aber Klavier zu spielen, wie es der Bruder Karl ausgezeichnet tut, weigert sich Mörike, nicht wegen der langweiligen Überei, sondern des Gedankens wegen, aller Welt vorspielen zu sollen. Nichts ist Eduard so zuwider, als sich zur Schau zu stellen. Dennoch bleibt Musik seine große Liebe: Eine Symphonie Beethoven aus c-Moll. Hinreißend! Ich dachte mir ganz unwillkürlich schöpferische Geisterchöre, welche zusammenkommen, eine Welt zu erschaffen. Die meisten Knabenfreundschaften lockern sich kaum und halten mitunter als Lebensfreundschaften.
Die sonnige Kindheit verdunkelt sich 1815 durch einen Schlaganfall des Vaters, worüber es in der "Autobiographischen Skizze" heißt: Mit diesem Tage begann das Glück unseres Hauses in mehr als einem Betrachte zu sinken.
Im September 1817 stirbt der Vater. Die Witwe bleibt in bedrängter Lage zurück und könnte die sieben Kinder kaum allein durchbringen, sprängen nicht Verwandte tätig helfend ein. Ein Onkel nimmt Eduard in seiner Familie auf, in eines der geistig lebendigsten Häuser Stuttgarts, wo der Freund des Philosophen Schelling der Gelehrsamkeit und heiteren Geselligkeit lebt.
Schicksalsschläge
Einige Wochen nach seiner Konfirmation 1818 wird Mörike vom Niederen Theologischen Seminar in Urach aufgenommen. Die Hügelwelt dort feiert ein herrliches Gedicht dankbarer Erinnerung, Besuch in Urach, das so anhebt:
Nur fast so wie im Traum ist mir's geschehen,/ Daß ich in dies geliebte Tal verirrt. / Kein Wunder ist, was meine Augen sehen,/ Doch schwankt der Boden, Luft und Staude schwirrt, / Aus tausend grünen Spiegeln scheint zu gehen / Vergangne Zeit, die lächelnd mich verwirrt; / Die Wahrheit selbst wird hier zum Gedichte, / Mein eigen Bild ein fremd und hold Gesichte!
Ja, in Urach ist Mörikes Wesen, seinem einsiedlerischen Hang der lebhafte Umgang mit den Internats-Kameraden wohltuend, auch die scharfe Zucht und geregelte Ordnung des Seminars gut bekommen. Auch einen Dichterfreund gewinnt er in dem frühreifen Wilhelm Waiblinger, der dem gleichaltrigen Mörike als Poet und Liebesabenteurer weit voraus ist und daran auch nachmals schwer zu tragen hat.
Die Universität Tübingen wird ihm für weitere vier Jahre so etwas wie eine geistig-geistliche Heimat, wenngleich die eigentlich wegbestimmenden Erlebnisse dieser Jahre nicht Studienerfahrungen sind, sondern Freundschaften und Liebesversehrungen. Die Freunde empfangen begeistert den kranken, um Jahre älteren Friedrich Hölderlin. Manchen Tag sitzen sie beisammen, in scheuer Ehrfurcht, aber auch in heimlicher Abwehr. Hölderlin kommt Eduard wie ein älterer Bruder vor, wohl auch wie ein Magier und - wie eine Gefahr.
Lebensfreundschaften
Im heimelig-unheimlichen Dunkel des "Brunnenstübchens", unter dem das Wasser quillt, lassen die Freunde sich gefangen nehmen vom klaren Homer, von Ossians Nebelland, von Fouqués nordischen Märchen und erfinden sich eine eigene, schaumgeborene Welt, die Märcheninsel Orplid, die ihre Erschafferin Weyla so besingt:
Du bis Orplid, mein Land / Das ferne leuchtet; / Vom Meere dampfet dein besonnter Strand / Den Nebel, so der Götter Wange feuchtet. / Uralte Wasser steigen / Verjüngt um deine Hüften, Kind! / Vor deiner Gottheit beugen / Sich Könige, die deine Wörter sind.
Drei Ereignisse erschüttern sein Seelengleichgewicht in der Tübinger Zeit: die Verlobung Klärchen Neuffers mit einem anderen, die Begegnung mit Peregrina und der Tod des Bruders August. Maria heißt jene rätselhafte Fremde, deren Woher und Wohin noch heute hinter Schleiern liegt. Er verehrt und liebt in ihr sogleich eine Heilige. Freilich trübt sich ihm ihr Bild kurze Zeit später, als ihn erschreckende Nachrichten von der Abenteurerin, von seiner "heiligen Sünderin" erreichen. Ein Widerklang dieser Begegnung in Seligkeit und Schrecken blieb in den fünf Peregrina-Liedern erhalten, Sie beginnen:
Einst ließ ein Traum von wunderbarem Leben / mich sprießend Gold in tiefer Erde sehn.
Und sie enden mit dem "Ecce homo"-Motiv des fünften Gedichts. Dessen erste Strophe lautet:
Die Liebe, sagt man, steht am Pfahl gebunden, / Geht endlich arm, zerrüttet, unbeschuht; / Dies edle Haupt hat nicht mehr, wo es ruht, / Mit Tränen netzet sie der Füße Wunden.
Nur langsam erholt sich Mörike von der Erschütterung, die sich in Maler Noltens Worten spiegelt: Das Unglück macht den Menschen einsam und hypochondrisch; er zieht den Zaun dann gern so knapp wie möglich um sein Häuschen.
Lähmende Familienbande
Luise, seine Schwester, wird ihm zur hilfreichen Vertrauten und scheint seine Lebensfäden vorsichtig in der Hand zu halten. Sie schreibt sich über ihren recht verwöhnten Bruder auf: Seine Freunde behandeln ihn mit einer Schonung, einer Zärtlichkeit, einer Nachsicht, schon in den gesunden Tagen, die sich von unserem Geschlechte kaum erwarten ließ. Ich mußte dem Kranken nun schon einmal seinen Willen tun, wie man einem leidenden Kinde nachzugeben pflegt, damit er seine Schmerzen vergessen und sich zerstreuen soll.
Das Verhältnis zur Schwester birgt auch Gefährdung. Der Schwache fühlt sich wohl, wenn er sich an die Starke anlehnen kann, gerät unter ihre Kontrolle.
Ende August 1824 wartet eine neue Verunsicherung auf den Dichter. Er muss sich um den jüngeren Bruder sorgen. Man findet ihn schließlich tot im Keller liegen; als Todesursache wird ein "Nervenschlag" diagnostiziert. Manche halten es für Selbstmord. Mörike klagt: Ich selber hab' es sonst nicht so gewusst, wie unaussprechlich schön der Zusammenhang seines Lebens war mit dem meinigen. Jetzt, da es zerrissen ist, merk' ich vielleicht erst, dass es zwei Leben waren ... Es war niemand auf Erden, den ich so lieben, den ich so lauter, so ganz zu jeder Zeit in den Arm nehmen konnte wie ihn.
In Tübingen reift Mörike zum Dichter, so sparsam er seine poetische Ernte niederschreibt. Zum Vikar zugelassen, beginnt für ihn eine achtjährige Wanderzeit.
Für Mörikes ganzes Werk gilt, was er einmal von seinen Bräutigamsbriefen sagt: Es ist auch nicht ein falscher Hauch darin. Alles teilt er seinem "Engel" mit, widmet ihr mit Vorliebe die erste Morgenstunde des Tages, jene von ihm geliebte Frühstimmung, in der nach seinem Wort die Seele gleichsam von selber zu tönen anfängt wie jene Harfen, auf denen die Luft spielt.
So gibt es in den ersten Monaten der Liebe bereits einiges Willkommen und ebenso viele Abschiede. Nach Monaten aber kommt ihm unerwartet im Mai 1834 die Ernennung zum Pfarrer von Cleversulzbach. Im Juni zieht der neue Pfarrer durch festlich geschmückte Straßen in ein eigenes Pfarrhaus ein.
Liebesunglück
Das Dörfchen "Klepperfeld", wie Mörike sein Cleversulzbach nennt, ist dazu angetan, sich in eine friedlich heitere Einsamkeit einzuspinnen. Bei gutem Wetter schleicht sich der Pfarrer in einen nahen Wald, um ungestört zu träumen. An Hartlaub schreibt er: Da setzte ich mich nieder, hing meinen Träumereien nach, indes die Amsel musizierte, und zog zuletzt ein Buch, welches wir ehmals beide gleichsehr liebten.
Seine Mutter und die Schwester pflegen ihn, aber drei Brüder nehmen die magere Kasse des Pfarrers zu häufig in eigenen Anspruch. Das gilt auch für nächtliche Diebe, die sich auch an den Früchten des großen Gartens gütlich tun. Mörike sieht das mit Humor:
Meine guten Bauern freuen mich sehr; / Eine scharfe Predigt ist ihr Begehr. / Und wenn man es mir nicht verdenkt, / Sag ich, wie das zusammenhängt. / Sonnabend, wohl nach elfe spat, / Im Garten stehlen sie mir den Salat; / In der Morgenkirch mit guter Ruh / Erwarten sie den Essig dazu; / Der Predigt Schluß fein linde sei: / Sie wollen gern auch Öl dabei.
Die Jahre in der eigenen Pfarrei bringen reiche lyrische Frucht. Konsistorium wie Gemeinde wünschen sich, mehr den Pfarrer als den Vikar zu hören, aber ein Versuch, ohne ihn auszukommen, scheitert schon nach zwei Monaten. Hartlaub gesteht der Pfarrer, sein Amt bringe ihn seiner andauernden Kränklichkeit wegen um, und nach einer hässlichen Skandalgeschichte, in die auch Mörike verwickelt wird, reicht dieser 1843 sein Gesuch um Versetzung in den Ruhestand ein.
Es folgen lange Ruhejahre in bescheidensten Verhältnissen, die er mit der Schwester bis 1847 zubringt. Bedeutungsvoll wirkt sich die Bekanntschaft mit Margarethe von Speeth aus, wieder einmal eine Zeit der neuen Liebe, die reife Gedichte entstehen lässt. Um Margarethe zu heiraten, muss eine Lebensstellung gefunden werden. Nach manchen ergebnislosen Plänen vermittelt Rektor Wolff vom königlichen Katharinenstift eine Stelle als Lehrer für Literaturgeschichte. 1851, nach allzu langer Wartezeit, wird Margarethe von Speeth Mörikes Frau. Die Ehe gestaltet sich wenig glücklich, die widerstrebenden Charaktere bekämpfen sich, und leider begleitet Klärchen das Paar ins neue Haus. Zu lange führte die Schwester dem Bruder das Haus, als dass sie die Aufgabe abgeben will.
Als 1855 Theodor Storm den Dichter besucht, hält er seinen Eindruck von Mörike fest: Er war damals erst einundfünfzig Jahre alt; in seinen Zügen aber war etwas Erschlafftes, um nicht zu sagen Verfallenes, das bei seinem lichtblonden Haar nur um so mehr hervortrat; zugleich ein fast kindlich zarter Ausdruck, als sei das Innerste dieses Mannes vom Treiben der Welt noch unberührt geblieben. So sieht der Prof. Dr. Mörike aus, der nur einmal in der Woche "Damenlektionen" am Katharinenstift gibt und durch "Frauenzimmervorlesungen" über Shakespeare, Goethe und die griechischen Tragiker ein Nebeneinkommen anstrebt. Aus Gesundheitsgründen ersucht er im Spätherbst 1866, ihn in den Ruhestand zu versetzen und ihm sein Gehalt als königliche Gnadenpension zu belassen. Auch die Schiller-Stiftung hat sich seiner angenommen und ihm eine lebenslängliche Pension von 300 Talern ausgesetzt.
Wieder stellen sich dichterische Interventionen ein: Das "Stuttgarter Hutzelmännlein", die MozartNovelle, die Idylle vom alten Turmhahn und eine unvollendet gebliebene Umarbeitung des "Maler Nolten". Schon hoch in Jahren pflegt er, um ein Blättchen von seiner Hand gebeten, einen Siegelabdruck zu schenken und schreibt dazu:
Mein Wappen ist nicht adelig,
mein Leben nicht untadelig.
Und was da wert sei mein Gedicht,
fürwahr, das weiß ich selber nicht.
Man soll diesen Ausspruch nicht überbewerten. Nein, das Sprüchlein soll vor allem heißen, er wünsche mit seinen Gaben nicht vor einem Spiegel zu paradieren und halte sie für nichts anderes als Werkzeuge, die er zum Dienst braucht. Viele großartige Leute besuchen ihn, sein meisterhafter Illustrator Moritz von Schwind, die Sängerin Pauline Viardot, die bereits einiges von ihm vertont hat, und Iwan Turgenjew, der Mörikes "Turmhahn" auswendig kann. Aber der Dichter empfindet den Schwarm im Grunde als lästig.
Die letzten Lebensjahre vergehen in Gram und recht freudelos. Die Liste teurer Toter wird immer länger, und er selbst rüstet sich zum Heimgang. Die kleine Trauergemeinde vernimmt am offenen Grab ergreifende und prophetische Worte: Es gibt eine Gemeinde, die den Dichter nicht nach rednerischen Worten schätzt, die den feineren Wohllaut trinkt, der aus ursprünglichem Naturgefühl der Sprache quillt. Und sie wird wachsen, diese Gemeinde, wird sich bilden von Einverstandenen in deinem Verständnis, und du wirst ihnen nicht ferne sein...
Mörike und die Musik
Mörikes Gaben kann man sich nicht reich genug denken. Er besaß im Tiefsten eine denn doch heile Künstlernatur voller Bildner-, Fabulier- und Märchenlust, ausgerüstet mit einem Sinn für die Wahrnehmung mit Auge und Ohr, der Farbe und des Tons, wie sie in solchem Gleichgewicht selten ist.
Vätern und Vorvätern hat die Musik zu Mörike hin geholfen. Kauffmann und Scherzer, Pressel, Hetsch und Silcher. Im Frühling des Jahres 1888 vertonte Hugo Wolf mehr als 50 Mörikegedichte - sie gelten uns zusammen mit den Chorkompositionen Hugo Distlers oder der Liedsammlung bei Othmar Schoeck als die genauesten Deutungen im Bereich der Musik. In Zeiten harter Erschütterung, in zwei Weltkriegen, hinter Stacheldraht, in Elendslagern, bestand Mörikes Werk, bestanden vor allem seine Gedichte, die äußerste Probe. Eine Epoche, die sich in allem ihrer fragmentarischen Gestalt bewusst ist, findet zu einem Werk, in dem als wahre Vereinigung des Gegensätzlichen das Wort "Schmerzensglück" erfunden und gestaltet worden ist.
Der Text ist die stark gekürzte Fassung eines Vortrags bei den Hugo-Wolf-Tagen in St. Paul/Lavanttal.