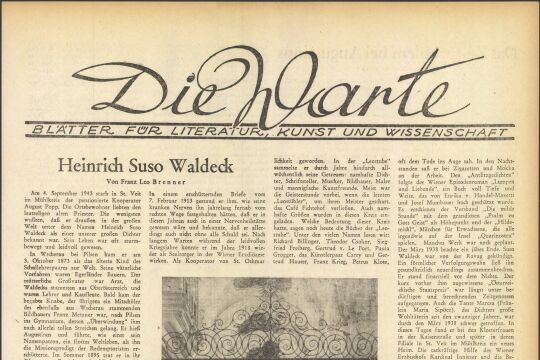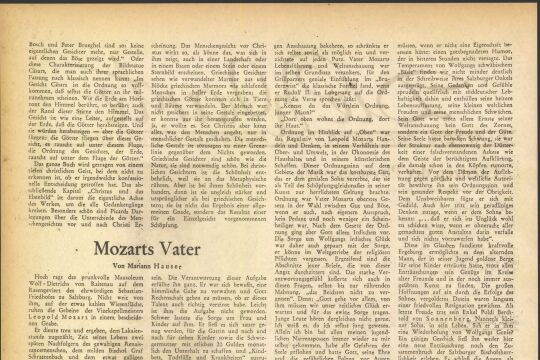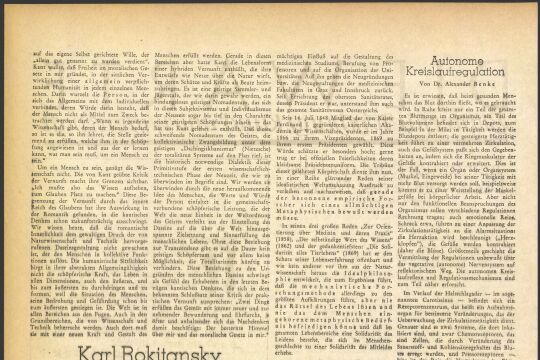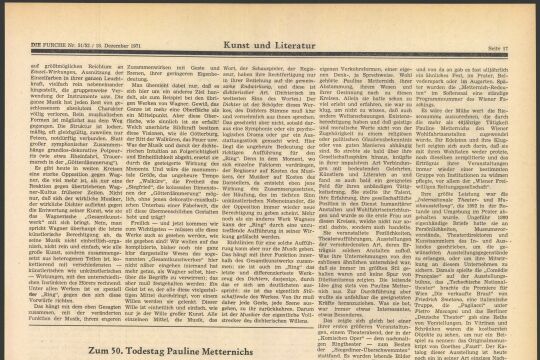Am 20. März findet im Theater in der Josefstadt die Premiere des Trauerspiels „Armut” von Anton Wildgans statt. Otto Schenk hat es als ein in Vergessenheit geratenes „Meisterwerk” im letzten Jahr seiner Direktion auf den Spielplan gesetzt und selbst inszeniert. Uraufgeführt wurde es am 16. Jänner 1915 am Deutschen Volkstheater. Der Dichter erklärte damals, es sei „in jeder Zeile erlebt”, wenn auch „keine Photographie eigener Verhältnisse und der wirklichen Personen”. Ein paar Passagen aus dem Buch der Verfasserin dieses Artikels (siehe Buchtip) sollen die realen Hintergründe beleuchten (Formulierungen von Wildgans selbst sind kursiv gedruckt).
Die Auffassung von Pflichttreue, die den „kleinen Postbeamten” in der Tragödie zu deren eigentlichen Helden macht, ist von den Vorfahren des Autors her zu begreifen, die seit 1699 Bürger in der Haupt- und Residenzstadt waren. Vier Belobungsdekrete Seiner k k Majestät sowie ein französischer Orden bekunden die vom Urgroßvater, einem Magistratsrat, mit Treue, Eifer und erprobtem Biedersinn so nützlich geleisteten Dienste.
Der Großvater, absolvierter Jurist und zuletzt Ministerialsekretär im k. k. Finanzministerium, beherrschte mehrere tote und lebende Sprachen und verwendete einen beträchtlichen Teil seiner Resoldung für die ständige Erweiterung seiner Bibliothek, die ihn auch noch in den Augen des im Andenken an ihn „Anton” getauften Enkels als Schöngeist und Privatgelehrten auswies.
Sein einziger Sohn, Doktor iuris Friedrich Wildgans, brachte es bis zum Ministerialrat im k. k. Ackerbauministerium, Hofrat und Ritter des Ordens der Eisernen Krone und des Franz-Josefs-Ordens etc.. Er heiratete 1877 Theresia Charvat, die stellungsuchend aus Mähren nach Wien gekommen war und sich durch die mustergültige Führung des Haushalts und die aufopfernde Pflege des alten Herrn die Dankbarkeit und Zuneigung des jungen erworben hatte.
Die Welt seines vom Ostersonntag des Jahres 1881 an unter der Obhut der Mutter in unersättlichem Schauen und Hören verbrachten ersten Lebensabschnitts schwebt Anton Wildgans in seinem 1928 verfaßten Erinnerungsbuch „Musik der Kindheit” schatten-los-heitervor. Als er vier Jahre alt war, starb die den Berichten zufolge wohl schöne, jedoch ungebildete und herrische, ihrer Lebensart nach eher derbe Frau an der Lungenschwindsucht.
Aus der Umgebung seines im Bezirk Landstraße gelegenen Geburtshauses gerissen wurde der Bub durch den Umzug in die Josefstadt.
Der Vater, der die Klassiker hochschätzte und des Abends immer und ausschließlich Schillersche oder Sha-kespearsche Dramen las, beschäftigte sich nunmehr auch stets mit dem Kleinen, dessen Gitterbett er an sein eigenes Lager gerückt hatte: Er sagte ihm einzelne Gedichte von Schiller vor und leitete ihn dazu an, die Verse sinngemäß und kunstgerecht nachzusprechen; weiters weckte er in ihm Vergnügen daran, zu vorgegebenen Wörtern Reimwörter zu suchen.
Der Fünfjährige bekam eine Stiefmutter, und damit fand solches Glück für ihn ein Ende. Die Standes- und selbstbewußte Marie Reitter, Tochter eines Stabsarztes, täuschte dem Mann mütterliche Empfindungen für den sich ihr zunächst vertrauensvoll anschmiegenden Knaben vor, wies dessen Werben um Zärtlichkeit, wenn sie mit ihm allein war, aber oft unwillig zurück, weshalb er sich ihr zu verschließen begann. Als sie daraufhin, über seinen vermeintlichen Trotz klagend, auch noch den Gatten gegen den aus Scham im Sichaussprechen gehemmten Rüben einzunehmen verstand, mußte dieser sich sogar vom Vater verstoßen wähnen, und es bemächtigte sich seiner das Gefühl, nur eine Last, ein Überzähliger zu sein.
Brach bei seltenen Gelegenheiten doch die im Grunde unverminderte Liebe des ratlos zwischen den Parteien stehenden Mannes zu seinem Kind durch, dann löste dessen verkrampfte Haltung sich stets erst lange nach der heiß ersehnten Zuwendung in einem ängstlich verheimlichten Tränenausbruch, so daß seine Liebebedürftigkeit nie offenbar wurde und sich der Eindruck einer strafwürdigen Verstocktheit erhielt. Immerhin kümmerte sich die „Großmama” — Friedrich Wildgans hatte seinen Hausstand in die Wohnung von seiner zweiten Frau und deren Mutter übersiedelt -freundlich um ihren Stiefenkel. Sie lehrte ihn die ersten Gebete, die später wiederum er seiner um sieben Jahre jüngeren Halbschwester Marianne beibrachte, mit der er zeitlebens innig verbunden blieb.
Sein erstes bewußtes Erleben des Landes, richtunggebend vielleicht für ein ganzes Leben!, ereignete sich 1887 in Pötzleinsdorf- damals wirklich noch ein ländliches Idyll, außerdem Manövergelände, wo bisweilen sogar der Kaiser den Truppenübungen beiwohnte.
Freudeninseln im Leidensmeere des Schuljahres stellten vor allem diejenigen der kirchlichen Feste dar, die den Anlaß bildeten für höchst sehenswerte Veranstaltungen, deren Bedeutung sich dem Knaben durch den Vater erschloß. Als die imposanteste Entfaltung monarchischer und sakraler Pracht empfand er den Fronleichnamsumgang von Sankt Stephan, bei welchem die apostolische Majestät in eigener geheiligter Person im Triumphzuge des Allerheiligsten einherschritt.
Im kleinen Kreis der Familie Wildgans wurde besonderen Tagen auch durch verschiedene von früheren Generationen übernommene Gebräuche Rechnung getragen. Bei den häuslichen Feiern beeinträchtigten allerdings oft mannhaft verhehlte Emotionen die festliche Gestimmtheit des Jungen: Es war wohl gleichermaßen erzieherische Absicht wie die uneingestan-dene Notwendigkeit zu sparen, was den Vater sogar am Heiligen Abend zum Bütteides Schulmeisters werden und die Nichterfüllung so manchen kindlichen Wunsches dem Buben gegenüber mit irgendeiner schlechten Schulnote begründen ließ. Galt es doch, trotz unzureichender pekuniärer Mittel das kulturelle Niveau zu halten und das Prestige zu wahren.
1897 ereignete sich eine die Position des Ernährers vernichtende Katastrophe. In „Musik der Kindheit” erlebt man mit dem sechzehnjährigen Anton Wildgans in dem Zimmer, das ihm und seinem Vater gemeinsam als Arbeits- und Schlafraum dient, wie sich im Aufzucken eines Augenblicks die Zerstörung einer menschlichen Persönlichkeit vollzieht: Von einer stürmischen Parlamentssitzung, in der er seinem Minister als Referent zur Seite gestanden ist, heimgekehrt,
hat der Mann sich soeben noch, auf der Höhe seines Wissens und in der Wür-de seines Amtes bewährt; vor Erregung müde auf einen Lederdiwan gesunken, wird er durch einen Blutaustritt im Gehirn zu einem hilflosen, lallenden Kind, das, da die Bewegung sich ihm versagt, die auf der Brust gefalteten Hände nicht mehr voneinander lösen kann und dessen sich entsetzt in sinnlosen Silben überstürzender Zunge die Menschensprache nie wieder zu Gebote stehen soll.
Ein stählerner Wille treibt den Kranken in der Folge Jahre hindurch zu Bemühungen, die verlorene Ausdrucksfähigkeit zurückzuerringen: Er wandert, ein Zeitungsblatt in der einen und die Uhr in der anderen Hand, auf und ab und murmelt, jeweils fünf Minuten lang, ununterbrochen ein-und dasselbe Wort vor sich hin, um es sich einzuprägen, bis das mechanisch Wiederholte ihm, durch irgendeine Ablenkung, dennoch qualvoll-spurlos entglitten ist und das Üben von neuem beginnt.
Außer der unversiegbaren Sehnsucht, wieder ein vollgültiger Mensch zu werden, bewegt ihn aber auch noch, ein seinen Angehörigen zugewandtes Gefühl: die in ihm unversehrt gebliebene Liebe. Und wenn er also in Blicken und Gebärden unendlicher Güte teilnimmt an allen Schicksalsdingen des heranwachsenden Knaben, dann empfindet dieser die verwandtschaftliche Zusammengehörigkeit so stark wie nie zuvor, und daraus erfließt ihm die Kraft,, dem Leidgeprüften zuliebe das durchzuhalten, was ihm für sich selbst jetzt schon sinnlos zu sein scheint: das ihm vom hu-—manistischen
Gymnasium abgeforderte brotlose Mühen - erwägt er doch, bei der kleinen Pe-„ troleumlampe über seine Hefte und Bücher gebeugt, die der Familie jeden Moment in Gestalt einer armseligen Witwenpension drohende Not. Und nur, um das Wunschvermächtnis dieses lebendigen loten getreu zu vollstrecken, besteht er immer wieder den Kampf mit der brutalen Tücke eines Schulbetriebes, der, an allem Individuellen vorüber, nicht Begabung ermittelnd, sondern bloß Gedächtnis und. Nerven prüfend, den schwachen Schüler mit seinen lächerlichen und schrullenhaften Autoritäts- und Fach-dünkeleien in Selbstmordgedanken hineinquält.
Der heimlich entliehene Trommelrevolver stellt in dieser seiner seelischen Lage eine dauernde Versuchung für ihn dar, aber sooft in jenen Nächten seine Hand mit ihm spielt, gesellt sich zu der natürlichen Todesfurcht das Erbarmen mit dem neben ihm schlummernden Vaterkind, dessen Jammer angesichts einer Szene des Grauens er sich ausmalt, und veranlaßt ihn dazu, die kühle Mündung von der glühend-pochenden Schlafe abzusetzen.
Von einer Erkrankung an Scharlach 1898 trug der Siebzehnjährige eine chronische Venenentzündlich-keit an beiden Beinen davon, die ihn zeitlebens behindern und gefährden sollte. Sie hätte auch die Verwirklichung seines Gedankens, Offizier zu werden, vereitelt, wäre er nach dem Abitur nicMt schon aus Pietät gewillt gewesen, sich dem juristischen Studium zu widmen, obgleich dieses seinen ganz anders gearteten geistigen Interessen geradezu entgegenstand.
Nach der Rückkehr von einer Seereise, die ihn als Regleiter eines an Augentuberkulose erkrankten Freundes zu Küsten von vier Erdteilen führte, erlebte Anton Wildgans das, was sich dann später zu dem Drama „Armut” verdichten sollte. Während die Großmama die bereits mit dem Generalssohn und Oberleutnant Doktor Friedrich von Schmedes verlobte Marianne nach Raden begleitet, sind der Vater und die Mama dazu verurteilt, die Hundstage in der Großstadt zu ertragen: der Mann wie der ärmste Krüppel in seinem Matratzensarg lebendig begraben, und die blasse, verzehrte Frau neben ihm jeder Zoll Unglück, Entsagung, Sorge, Ratlosigkeit. Tränenausbrüche wechseln mit stummem Jammer. Dazwischen schaltet der Sohn übermütige Scherze im böhmischen Dialekt ein: weil auch er keinen Rat weiß, greift er zur Maske des Harlekins. Rei dem Sterbenden harrt er aus bis zu dessen letztem Herzschlag am 6. Jänner 1906. Und der Wachehaltende vergegenwärtigt sich noch einmal die innigen Gesten eines Hilflosen, die in ihm, dem Jungen, den Lebenswillen gestärkt haben - durch das Gefühl, einem Menschen alles zu bedeuten und für ihn notwendig zu sein.
Obwohl das an Prüfungen reiche Jahrzehnt der Pflege des Schwerkranken die Stiefmutter gewandelt und auch von ihrer Härte und Bitterkeit dem Stiefsohn gegenüber erlöst hatte, erachtete der Verwaiste es jetzt, da er kein Recht auf den Mitgenuß ihrer Witwenpension besaß, für an der Zeit, selbst für sich zu sorgen.
Die ethischen Folgerungen, die Wildgans aus dem Komplex dieser Erfahrungen zog, legte er in seinem Theaterstück dem Gymnasiasten Gottfried in den Mund.