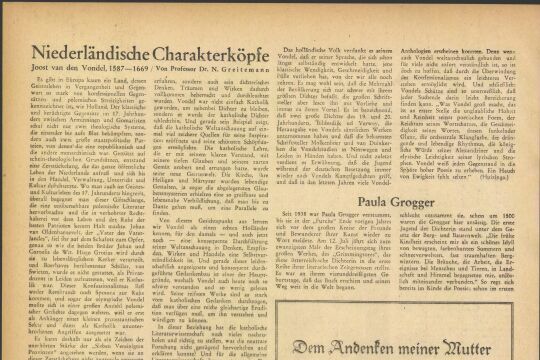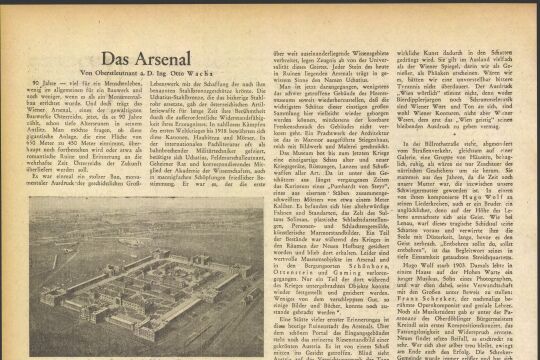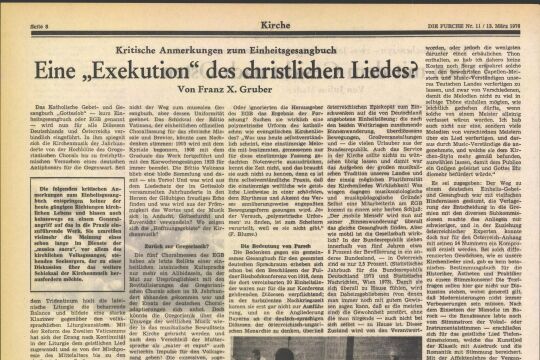Vis hat sich von dem klingenden Vermächtnis unserer Meister klassischer Musik in die Herzen aller Völker dieser Erde eingesungen? Gewiß, ein Bach und Händel, ein Haydn, Mozart und Beethoven haben sich die Welt erobert. Aber doch nur eine verhältnismäßig kleine internationale Oberschicht kennt ihr Werk. Das breite Volk, die kleinen Leute welcher Nation immer, nehmen an diesen kultivierten Kunstäußerungen kaum einen Anteil. Von den viel-tausend eingängigen Melodien, die Hirn und Herz dieser Großen ersonnen und die musikverständige Welt erobert hatten, ist tat Grunde nicht eine einzige im wahren Sinn des Wortes Gemeingut der gesamten Menschheit geworden. Selbst der Melodie aller Melodien unseres lieben Vaters Haydn, „Gott erhalte“ (die, eben weil sie einst die Kühnheit besessen, über die politischen Landesgrenzen zu fliegen, im eigenen Heimat-lande augenblicklich zum Stillschweigen verurteilt ist), konnte vermöge ihrer natürlichen Volksgebundenheit keinesfalls internationale Popularität zugesprochen werden. Es mag seltsam, vielleicht sogar ein wenig respektlos klingen, es ist aber doch so: ein bescheidener Salzburger Landschulmeister mk dem landläufigen Namen Gruber war es, der all seinen übergroßen Kollegen den Rang ablief, indem er einer Weihnachtsweise, „Stille Nacht“, das Leben schenkte, die bald dem Heimatboden entflatterte und schoo nach wenigen Jahrzehnten zum Weihnachtslied der Welt geworden war. Wirkten bei dieser fast unwahrscheinlichen Verbreitung auch gewisse besonders günstige Umstände mit — dieses biedermeierischen Liedchens Weltpopularität steht unumstößlich fest. Unerhörte Verbreitung haben auch die Melodien zweier anderer Österreicher gefunden: des Kärntners Koschat, der durch sein zwar rührseliges, nichtsdestoweniger volksliedhaftes „Verlassen“ die weite Welt auf sein liederfrohes Heimatland erst so recht aufmerksam gemacht hat, und des Klosterneuburgers Knebelsberger, dessen „Andreas-Hofer-Lied“ durch Tiroler Sängergesellschaften in alle fünf Erdteile getragen worden ist. Mk magischer Wunderkraft hat sich auch die dreivierteltaktige Volkshymne des Wienertums, der „Donauwalzer“ des Wiener Rattenfängers Johann Strauß, auf dem Erdball verbreitet. Und in einigem Abstand davon ist auch noch eines anderen Lobliedes auf Wien zu gedenken, das, trotzdem sein geistiger Urheber (Rudolf Sieczynski) erfreulicherweise noch unter den Lebenden weilt, in die ganze Welt gezogen ist: „Wien, du Stadt meiner Träume“.
All die genannten Weisen, von denen die ganze Welt Besitz ergriffen hat, sind Geschenkt von ausschließlich österrei-ch e r n. Dazu' aber kommt noch einer; der einzige „Großmeister“ der Musik, dem es beschieden war, mit seinen Werken die Bevölkerung des weiten Erdkreises bis in ihre Tiefen zu erfassen: Franz Schubert. Dies aber beileibe nicht mit seinen 600 Liedern. Denn von all diesen zieht eigentlich nur ein einziger geflügelter Ausreißer auf dem Erdball herum, „Der Lindenbaum“; und dieser nur in der strophischen Bearbeitung Suchers. Das Wunder wirkte vielmehr ein. vielverlästertes Quodlibet, die Operette „Das Dreimäderlhaus“. Man mag sich zu dem zweifellos in erster Linie merkantilisti-schen Interessen entsprungenen Mißbrauch der Schubertschen Poesien aus ästhetischen Gründen ablehnend verhalten (auch ich gehöre zu diesen) — eines kann nicht abgeleugnet werden: das sozusagen auf dem Künstlerindex stehende Bühnenwerk hat Sdiubert eine kaum je zuvor geahnt Weltpopularität gesichert, deren sich — ich glaube nicht fehlzugehen — der zeitlebens um Anerkennung schwer ringende Künstler letzten Endes selbst gef-eut hätte ... So hat halt
alles auf der Welt seine zwei Seiten. Aber noch ein Werk Sthuberts ist es, von dem es sich der Tondichter vielleicht am wenigsten hätte träumen lassen, daß es sich die Welt, soweit es sich um den katholischen Kulturkreis handelt, erobern würde. Ein Werk volkstümlich-sakralen Charakters, seine „D eutsche Mess e“. Dieser achtteilige Zyklus geistlicher Strophengesänge, der, seinem Zweck entsprechend, homophonen Stils und denkbar einfachster Struktur ist, entstammt des Meisters letzter Schaffensperiode (anfangs 1827) und dürfte zweifellos Schuberts populärstes Werk sein. Verbreitung hat dieses aber nicht in seiner Originalgestalt erlangt. Die „Gesänge zur Feier des hl. Opfers der Messe“ (so der ursprüngliche Titel des Werkes) sind für „gemischten Chor mit Begleitung von Blasinstrumenten und Orgel“ geschrieben und in dieser erst 1870 erschienenen Originalfassung so gut wie unbekannt. Den Begleitinstrumenten, die durchgängig auf jegliches Eigenleben verzichten, fällt hierin lediglich die Aufgabe zu, die Gesangsstimmen zu stützen. Als Herbeck 1866 die Messe in der überaus pietätvollen Bearbeitung des Mozart-Sdtülers Sey-fried für vier Männerstimmen herausgab, setzte ihre Verbreitung ein, und schon um die Wende des Jahrhunderts war sie in einstimmiger Fassung in den katholischen Kirchen heimisch geworden. Kardinal Doktor Innitzer teilte mir persönlich mit, er habe sie bereits 1890, also noch ehe sie auf dem Boden' Wiens so rechte Verbreitung gefunden hatte, selbst in seiner sudetendeutschen Heimat als junger Student mitgesungen. Missionäre trugen das fromme Werk in alle Welt hinaus, und heute wird unser liebes „Wohin soll ich mich wenden“ im edlen Wettstreit mit dem um einige Jahrzehnte älteren Meßgesang eines anderen Österreichers, mit „Hier liegt vor deiner Majestät“ von Michael Haydn, nicht nur bei uns zulande und auf dem Kontinent (besonders in den Balkanländern) Sonntag für Sonntag vom Volke singend gebetet und betend gesungen, sondern auch in aller übrigen Herren Länder und in allen Sprachen der Erde; also ebensowohl in China, Japan und auf den Philippinen, wie im schwarzen Erdteil und den Ländern des Westens. Diese Mitteilung habe ich aus verläßlichster Quelle erhalten: aus dem Munde des Musikmeisters des Missionshauses St. Gabriel (Mödling, Professor Marusczyk). — Die Achtung vor dem Genius Schuberts, der in der Deutschen Messe sich in ebenso andachtsvoller wie anmutig-melodiöser Weise mit seinem Gott auseinandersetzt, würde es allerdings gebieten, daß sich bei der kirchlichen Aufführung dieser Singmesse der das Volk begleitende Organist der eigenen Tonsprache des Meisters bedient. Aber was muß man da alles, dank der verschiedenen eigenmächtigen Bearbeitungen, von pietätlosen Besserwissern vom Orgelstuhle herab hören? Es soll und muß bei dieser Gelegenheit einmal ein offenes Wort gesagt werden: So herzerfreuend es ist, wenn sich die Orgel bei Begleitung unserer alten Kirchenweisen unbekannter Herkunft, platten konventionellen Akkordverbindungen aus dem Wege gehend, einer gewählten und persönlichen Harmonik bedient, sosehr ist es zu verurteilen, wenn sich ein Bearbeiter dieser Lieder vermißt, bei den von bekannten Tonsetzern herrührenden Kirchenliedern deren ureigene Physiognomie selbstherrlich abzuändern. Bei solchen Liedern steht doch der unumstößliche Wille des geistigen Urhebers eindeutig fest, und niemand hat das Recht, einen willkürlichen Eingriff in fremdes geistiges Eigentum vorzunehmen. Das ist Falschmünzerei und mutet so an, ab wenn irgendein Maler beispielsweise Rem-brandts Selbstbildnis, weil ihm daran etwa die Nase nicht gefällt, übermalen würde. ..
(Ein Schulbeispiel, wie man es als Musiker nicht machen soll, bietet die auch textlich zu beanständende „Bearbeitung“ der Schu-bertschen Deutschen Messe im Salzburger Orgelbuch 1918.)
Um zu unserem Thema zurückzukehren: Wer — so fragt sich die katholische Allgemeinheit, der der Wortlaut der Deutschen Messe fast so geläufig ist wie das „Vaterunser“ — wer also ist eigentlich der Verfasser dieses tiefempfundenen Meßtextes? Wie Schuberts Lieblingsbruder Ferdinand auf der Originalhandschrift dieser gottesdienstlichen Gebrauchsmusik später ausdrücklich vermerkt, wurde sie „auf Professor Neumanns Veranlassung geschrieben“. Und dieser Johann Philipp Neumann war auch der Dichter der Deutschen Messe. Wenn sein Name auch erst von dem Liederkönig in die Unsterblichkeit mitgerissen wurde, erfreute er sich doch schon zu Lebzeiten kraft seiner eigenen Bedeutung eines über die Grenzen seiner Heimat hinausreichenden Rufes als — Physiker. Kein Geringerer als Goethe gibt seiner Schätzung für den Gelehrten -in seiner Schrift „Zur Naturwissenschaft“ (Chromatik 17) Ausdruck, indem er Neumann einen „vorzüglichen Naturforscher und Kenner“ nennt. Im Jahre 1774 zu Trebitsch in Mähren geboren, kam er nach Absolvierung seiner Gymnasialstudien in Iglau an die Wiener Universität, um sich sowohl philosophischen, als juridischen Studien zu widmen and „nebstbei“ Naturwissenschaften und klassische Philologie zu studieren. 1801 sehen wir ihn als Lehrer für klassische Sprachen und Physik in Laibach. Er erhält fünf Jahre später eine Berufung nach Graz als Physikprofessor und lehrt hier (am eben errichteten „Joanneum“) auch populäre Astronomie. Hier entsteht sein grundlegendes, in lateinischer Sprache abgefaßtes dreibändiges Werk der Physik „Compendiario physicae institutio“. Nach der im Jahre 1815 erfolgten Errichtung des k. k. Polytechnikums (Technische Hochschule) in Wien durch Kai-
ser Franz I. wurde er zum ersten Lehrer der Physik an diesem Institut bestellt. Hier entstand audi sein zweibändiges „Lehrbuch der Physik“, das von allen zeitgenössischen Fachgelehrten höchste Würdigung erfuhr. Daneben erschien aber auch ein umfänglicher Band seiner Gedichte unter dem Titel „Ernst, Frohsinn und Scherz“. 1844 legt er sein Lehramt zurück, um nach weiteren fünf Jahren im Alter von 75 Jahren sein interessantes, wechselvolles Leben zu beschließen. Als „tiefgläubiger Naturwissenschaftler“ gliedert er sich ein in die lange Reihe seiner weltberühmten Kollegen von Bekennermut, Galilei und Kopernikus, Volta und Ampere, Liebig und Werner Siemens, Pasteur und Planck, Marconi und Karcel.
Schubert stand mit dem um 23 Jahre älteren Gelehrten in achtungsvoller Verbindung. Schon 1820 hatte Neumann für ihn das Libretto einer dreiaktigen Oper „Sakuntala“ geschrieben, von dem Schubert nur zwei Akte skizzierte. Die „Geistlichen Lieder für das hl. Meßopfer“ entstanden sechs Jahre später und waren für die Hörer des Polytechnikums bestimmt. Schubert spielt sie dem Dichter in seiner Wohnung auf dem Klavier vor und legt gemeinsam mit ihm die metronomischen Zeitmaße fest. Kurze Zeit darauf, 1827, gelangt sie in der benachbarten Karlskirche als „Schülermesse“ zur ersten Aufführung. Der Komponist erhält nach derselben einen Dankbrief des Dichters, dem ein Ehrensold von 100 Gulden beigeschlossen ist. Neumann bemüht sich noch im selben Jahre, vom Wiener Konstistorium die Approbation des Werkes und seine Einführung in den katholischen Kirchen Wiens zu erlangen. Das Ansuchen wird zugunsten der schon eingeführten Havdnschen Messe abschlägig beschieden. Heute aber erklingt das fromme Werk m allen katholischen Kirchen des ganzen Erdballs.
Vor 150 Jahren ist in einer Wiener Vorstadt mit dem bedeutsamen Namen Liechten-
thal ein helleuchtender Stern aufgegangen: unser Franz. Schubert. Und inmitten der Gedächtnisfeier für den vergötterten Liederfürsten, die ihm die Liebe seiner Wiener bereitet, soll audi ein Stündchen freunM-lichen Gedenkens dem zu Unrecht vergessenen Manne gewidmet sein, der durch seine erbaulichen Verse zum Wegbereiter eines kleinen Meisterwerkes geworden ist, das, von der „Lerche Gottes“ ersonnen, allsonntäglich aus den Herzen von Millionen gläubigen Seelen gleich einem frommen Gebete zum Himmel steigt.
Wenn also am ersten Tag des Februar die Technische Hochschule Wiens der Anregung des Verfassers dieser Zeilen Folge leistet und, dank dem rühmenswerten Einsatz seines vormaligen Rektors, des Hofrates Dr. Holey, an der Karlskirche eine Gedenktafel für den dichterischen Schöpfer
der Deutschen Messe enthüllt, wird das ganze Wiener Volk dankbaren Herzens an der pietätvollen Feier im Geiste teilnehmen. Wenn dann bei diesem Anlaß in dem herrlichen Kirchenraume, in dem Schuberts Partitur vor genau 120 Jahren zum erstenmal in lebendigen Klang umgemünzt wurde, der Wiener Schubertbund das Werk in seiner Urgestalt zu neuem Leben erweckt und wenn alle katholischen Kirchen sich ihm auf besonderen Herzenswunsch der österreichischen Bischöfe durch Aufführung der Deutschen Messe anschließen, dann wird sich unser armes und gequältes, einen wirklichen Frieden so inbrünstig ersehnendes Volk mit ihm in dem heißen Wunsch der Liedworte vereinigen:
„Send uns auch deinen Frieden durch deine Gnad' und Huld!“