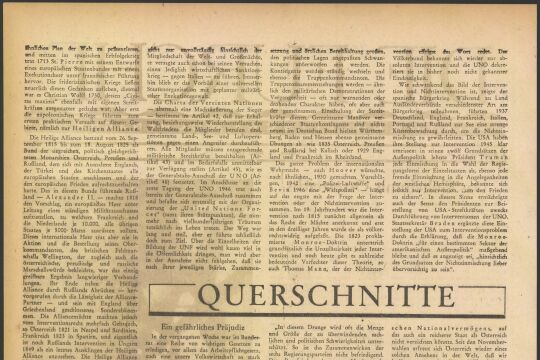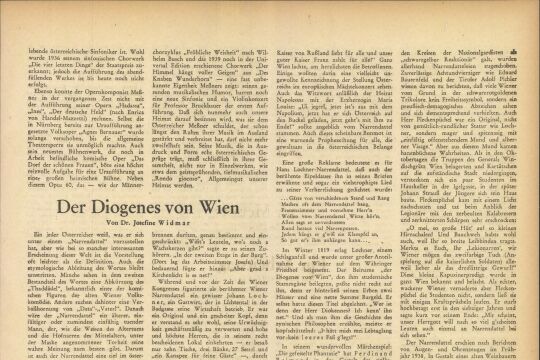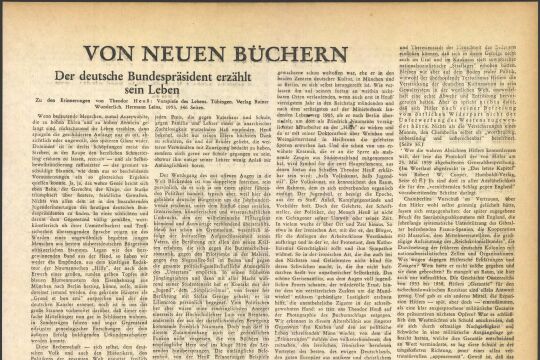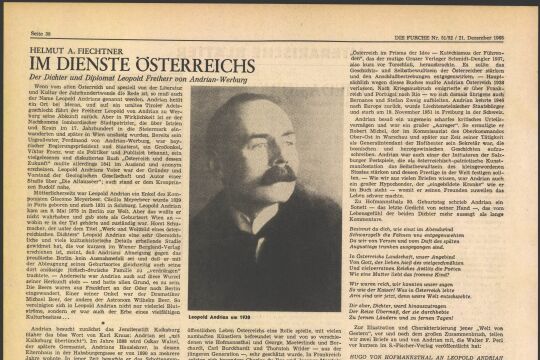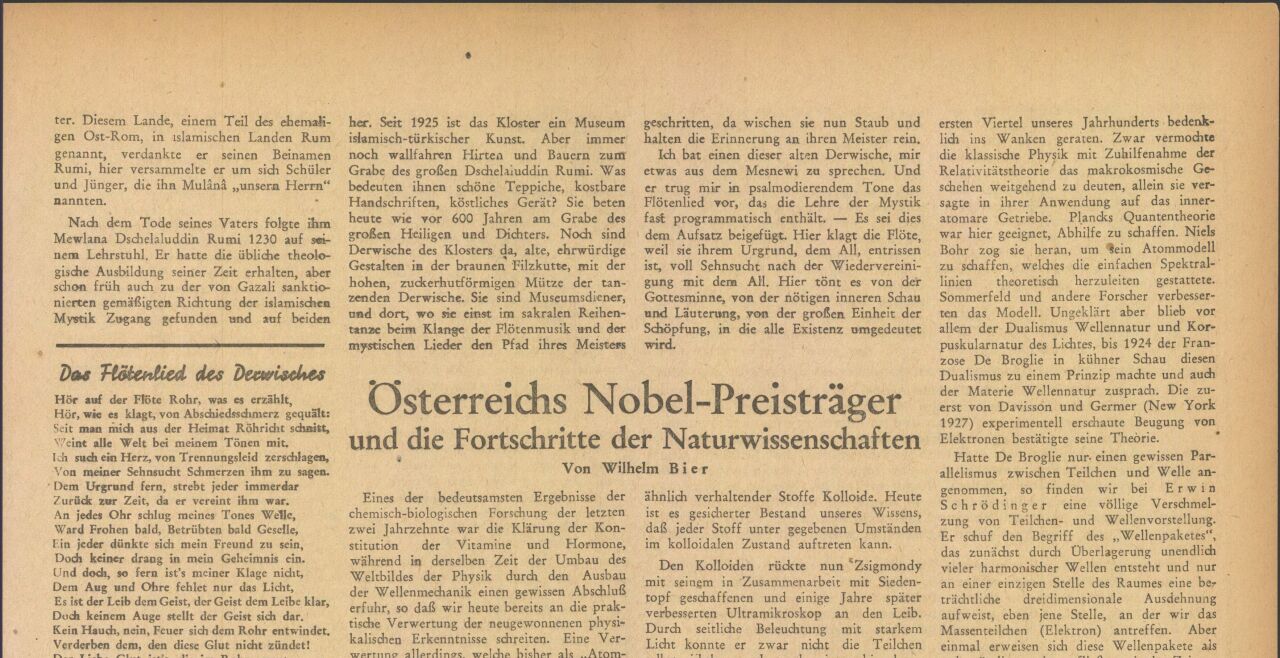
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vielsdireiberei im alten Wien
Die journalistische Überproduktion, die wir trotz des Papiermangels in Österreich erleben — man zählte im Monat September 31 Tageszeitungen und 240 periodische Zeitschriften —, wird in ihren Ursachen und Auswirkungen viel erörtert. Sie ist aber weder neu, noch auf unsere Heimat beschränkt. In politischen und sozialen Übergangszeiten, wenn nach langem Druck und Unterdrückung der in- und ausländischen Nachrichtenbelieferung eine Lockerung oder Aufhebung der hemmenden Vorschriften eintritt, zeigt sich fast immer ein fast groteskes Mitteilungsbedürfnis auf der einen, ein wahlloser Lesehunger auf der anderen Seite, zu dem sich noch geschäftliche Spekulation und Sensationslust gesellen.
Wien und Österreich haben schon zweimal eine wahre Sintflut von Druckerschwärze mitgemacht, die — ähnlich wie heute — zu den anderen Sorgen der Zeit in einem herausfordernden Gegensatze stand. Im Jahre
1781 hatte Kaiser Joseph II. im Zuge seiner ideal gemeinten, aber oft überstürzten Reformen auch eine fast völlige Aufhebung der Zensur verfügt. Nur Druckwerke von ausgesprochen unsittlichem oder antireligiösem Inhalt sollten davon ausgenommen sein. Durch diese Maßregel sowie durch die Freigabe des Nachdruckes ausländischer Bücher erhoffte sich Joseph „eine mächtige Förderung“ der einheimischen Literatur und Presse. Die Auswirkung war eine katastrophale, auch von pessimistischen Beurteilern, wie zum Beispiel Sonnenfels, nicht vorausgesehene. Noch vor Ablauf eines Monats nach dem Erscheinen des Patents ergoß sich ein reißender Strom von Zeitschriften, Pamphleten, Heften und Brosdiüren über die Residenzstadt, und es war mehr trübes als klares Wasser, das er führte. Alle mögliehen Winkeldruckereien taten sich auf und spien ihre Produkte ans Tageslicht. Von jedem Zwange befreit, machten sich jetzt zweifelhafte Helden der Feder, Vielschreiber und Bänkeldichter ans Werk und suchten geschäftstüchtig die neue Konjunktur auszunützen. Kein Gegenstand war zu erhaben oder zu niedrig, zu ausgefallen oder zu alltäglich, um nicht von diesen Schreiberlingen behandelt zu werden, keine Verordnung der Regierung, keine kirchliche oder weltliche Frage blieb vor ihren geschäftigen Fingern verschont.
In rascher Folge erschienen nicht weniger als 27 Schriften „über Begräbnisse“, 17 Schriften über die „Wiener Stubenmädel“, 6 Broschüren über die „Wiener Kaufleute“, eine kleine Wochenschrift „der ehrliche Wastel mit dem Klingelbeutel“, und ähnliche Machwerke.
Aber auch gegen den Kaiser selbst und seine Ratgeber wandten sich die Pamphle-tisten. Ein gewisser Feßler gab ein boshaftes Flugblatt heraus: „Was ist der Kaiser?“ Ein anderes Flugblatt behandelte im Hinblick auf die vom Kaiser verfügte Aufhebung der beschaulichen Klöster „die Aufhebung des geistlichen Ehebandes“, und die Klage einer jungen Person: „Die Mama will, ich soll ins Kloster gehen!“ Sonnenfels mußte sich ein Traktätchen „An den Chef der Maulaffenloge auf dem Graben“ gefallen lassen. „Für zehn Kreuzer konnte man jeden Gegenstand, groß oder klein, durchgebeutelt lesen“, kennzeichnete ein Zeitgenosse dieses literarische Unwesen. Hand in Hand damit ging aber ach eine bedauerliche Verschlechterung der Sprache. Hatten sich bisher die gehobenen Schriftwerke der von Lessing gereinigten, klassischen Ausdrucksweise bedient, das Volk in seiner alten, treuherzigen Vätersprache geredet und gedichtet, so machte sich jetzt ein journalistischer Stil, in üblem, modernen Sinne breit, triviale, ja oft ordinäre Redensarten, gezierte, unnatürliche Floskeln, Aphorismen, abgebrochene Ausrufe und Gestammel, das hinter Strichen und Rufzeichen seine Gedankenarmut verbarg. Die Geistlichkeit sah mit Besorgnis, wie Zweideutigkeiten und kirchenfeindliche Tendenzen, in dieser Papierflut versteckt und weiter verbreitet, aus der Stadt hinaus auch unter die Landbevölkerung drang.
Es war ein Franziskaner, P. Pankraz Waldbauer, der als erster gegen diese Auswüchse der neuen Pressefreiheit Stellung nahm. Aus seiner priesterlichen Tätigkeit wußte er genug um ihre verheerende Wirkung auf Volksseele und Volksleben. In einer im Jahre 1786 in der Druckerei „Johann Georg Binz am Hohen Markt“ erschienenen Schrift richtete er seine Angriff: gegen einen der ärgsten dieser Winkeljournalisten, einem gewissen David H a n n e r, der unter der Maske eines biederen Wiener Volksdichters sensationell aufgemachte „Tatsachenberichte“ über Mordtaten, Mißgeburten, Selbstmorde und Hinrichtungen brachte, und bei Frauen und einfachen Leuten großen Anklang fand. Pater Waldbauer entwarf in scharf satirischen Zügen ein Bild von dem abenteuerlichen und bedenklichen Leben dieses Wortmachers, und charakterisierte seine und ähnliche Schriften mit folgenden Versen:
Kaum hat sich einer hier erhenkt, Dort in den Fluß gestürzet, Hat Hanner, wie noch jeder denkt, Damit die Zeit verkürzet. Daß er uns manche Stund vertrieb Und alles dieses niederschrieb In schönen Gassenliedern — — —“ Hanner verschwand später aus Wien. Auch Pater Waldbauer zog sich gekränkt durch manche Mißerfolge in die einsame Waldpfarre St. Peter am Neuwald in den steirisch-niederösterreichischen Grenzbergen zurück, wo er bis zu seinem Tode als Seelsorger wirkte. Er soll noch andere kritische Werke verfaßt haben, die leider verschollen sind. Die Vielschreiberei ging aber bis zum Tode Kaiser Josephs weiter, und sogar das heroiche Sterben des unglücklichen Monarchen wurde zum Gegenstande von Sudelschriften. Sein Bruder und Nachfolger Leopold IL, von Florenz her an den Umgang mit Pamphletisten gewöhnt, machte dem Treiben einigermaßen Einhalt.
Es ist bekannt, daß in der Ära des Staatskanzlers Metternich das Pendel nach der anderen Seite ausschlug. Eine oft verständnislos und übertrieben gehandhabte Zensur behinderte das literarische Schaffen und verbitterte den besten Geistern, einem Grillparzer, Raimund, Halm und anderen das Leben. Es wurden weniger Bücher und Zeitschriften produziert. Der Wiener Biedermeier war nicht so lesehungrig wie seine Josefinischen Vorfahren und wendete sein Interesse eher der bildenden Kunst zu.
Die Märztage des Jahres 1848 brachten die, wie man damals dachte, völlige Aufhebung der Zensur und damit wieder eine schier uferlose Überflutung mit allem möglichen Gedruckten und Geschriebenen. Die gleichen Männer, die sich im Jahre 1845 in einer Denkschrift für die völlige Pressefreiheit eingesetzt hatten, Grillparzer, Stifter, Hammer-Purgstall, Stelzhamer, Feuchtersieben standen jetzt entsetzt vor diesem literarischen Turmbau von Babel. Vieles war noch schlimmer als im Jahre 1781. Waren die damaligen Skribenten zumeist noch aus dem österreichischen Volke hervorgegangen und hielten wenigstens äußerlich noch an der Wiener Tradition fest, so gab es unter den Gelegenheitsschriftstellern der Märztage schon viele aus dem Norden und Osten Zugereiste, die in einem gewissen „kessen“ Stil alles Einheimische als reaktionär verspotteten. Zwei Journalisten, H ä f n e r und T u w o r a, gaben von März bas Juli 1848 nicht weniger als 215 Flugschriften, Broschüren und dergleichen heraus, und der Dichter Castelli, selbst ein sehr fruchtbarer Autor, zerbrach sich den Kopf, woher die Leute Tinte, Papier und Federn nehmen. In die Legion gingen Gedichte und fliegende Strophen, in denen die völlige Gleichheit der Menschen proklamiert wurde. Eine solche Strophe, die etwa hundertmal abgedruckt wurde, lautete zum Schluß:
... Vor Gott gibt's keine Ausnahm',
Vor ihm ist alles gleich.
Ob einer noch so blutarm.
Ob er auch noch so reich!___
Als im September aus Frankfurt am Main die Nachricht kam, daß die Mitglieder der Nationalversammlung, Auerswald und Fürst Felix Lichnowsky, bei einem Straßenauflauf ermordet worden waren, wurde diese traurige Begebenheit mindestens sechsmal in Heftchen und Broschüren, nach der Art der berüchtigten Marktbuden-Moritaten umgedichtet. Damals erschien ein Gedient von einem „Zuschauer“ mit dem Refrain:
„Ich geh“ jetzt in die Stephanskirch',
Damit ich es vergeß',
Daß Wien ein Narrenhaus,
Drin keiner kennt sich aus!“
Die neuerliche Einschränkung der zügellosen Preß- und Druckfreiheit und die Wiederkehr normaler politischer Verhältnisse setzte diesen journalistischen Exzessen ein Ziel. Aber die entfesselten Zeilenschinder warfen sich jetzt auf andere Themen. Vom Jahre 1849 bis etwa 1856 erschien eine wahrhaft astronomische Zahl von „Taschenbüchern“, „Albums“, „Anthologien“, „Kalendern“, die belletristischen oder belehrenden Zwecken dienten, und mit wenigen Ausnahmen durch spießbürgerliche Seichtheit und Süßhchkeit sich hervortaten. Schon die Namen sind bezeichnend: „Veilchen“, „Siona“, „Iduna“, „Gedenke mein“, „Vergißmeinnicht“, „Aurora“, „Album der Rosenblätter“, „österreichisches Frühlingsalbum“, „Album der Erinnerungen“, „Erika-Album“, „Der Tartar“, ein „Jokoser Witz-und Lachalmanach“ und zahllose „Damenkalender“.
Vom Jahre 1858 an gingen die meisten dieser Zeitschriften ein und waren bis 1866 fast völlig verschwunden. Die Sorgen der Kriegsjahre drückten auf die Kaufkraft und der Leselust des Publikums. Wer aber glaubte, daß es mit der Vielschreiberei auf immer vorbei sei, den hat unsere Gegenwart eines anderen belehrt. Die Hilfsmittel, von denen Grillparzer spricht, Erziehung der Lesenden zu besserem Geschmack und aller Schreibenden zu höherem Verantwortungsgefühl, sind freilich fast utopische Ziele. Drastischer drückt es Nestroy aus mit seinem Verzweiflungsausruf: „Jetzt hab' ich aber genug von der Schmieraschi!“
Der tragische Grillparzer hatte eine große Vorliebe für Raimund und dessen Produktionen. Beide vorzügliche Menschen, dabei echte Österreicher, hatten sie auch sonst im Äußern und im Innern so manches gemeinsam. Ihre Nervosität und Hypochondrie äußerte sich aber ganz verschieden. Bei Grillparzer war der Verstand vorherrschend, bei Raimund das Gemüt; jener bezwang gewöhnlich seine innersten Empfindungen und äußerte sich mit Vorliebe satirisch, dieser zerfloß des öfteren in Schwärmerei. Eines Sommers wohnten beide in der Brühl bei Mödling und begegneten einander im Wald. Raimund hielt Schriften in der Hand und sah verstört aus, sein Rock und seine Beinkleider waren mit Pech und Harz beschmiert.
„Aber, lieber Freud, wie sehen Sie denn aus?“ rief ihn der Tragiker an. „Na, wie soll man denn aussehen, wenn man auf die Bäum' sitzt und dichtet“ erwiderte Raimund barsch. Raimund schrieb damals an seinem „Verschwender“ und hatte sich irgendeinem harzigen Baumstrunk zum Poetensitz erkoren. Grillparzer erzählte diese Anekdote gerne.
Eduard v. Bauerniel d, „Erinnerungen aus Alt-Wien“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!