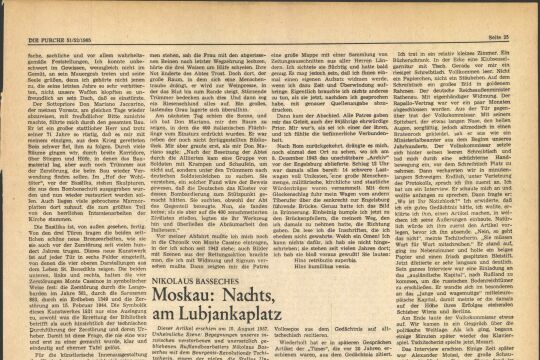Die obligate Halbjahrskrise
Es ist ein eigentümliches Gesetz für neu gegründete Zeitungen, häufig nach sechs bis zwölf Monaten in eine Bestandeskrise zu treten, die viele Blätter überhaupt nicht überleben. In der Krise machte das „Kleine Volksblatt” keine Ausnahme. Viele Umstände wirkten dabei mit, daß das „Kleine Volksblatt” nach sechs Monaten in dieses Fieber hineinschlitterte. Darüber berichtet der nachmalige Verwaltungsdirektor Dr. Prochazka:
„In dieser prekären Situation wurde an Stelle des pensionierten alten ein neuer Direktor auf dem Inseratenwege gesucht. Unter 29 eingelangten Angeboten wurde schließlich das Offert des jüngsten Bewerbers angenommen. Dieser Bewerber war damals 26 Jahre alt, Druckfachmann und gelernter Betriebswirtschafter — Dr. Prochazka. Durch Publikationen war er schon damals im der Fachwelt nicht unbekannt. Durch geschickte Rationalisierungsmaßnahmen und Verringerung des Personals auf den möglichst geringen Stand sowie durch den Ausbau der Merkantildruckerei zu einem anerkannt leistungsfähigen Betrieb verringerte sich das Defizit schon binnen Jahresfrist, und es war möglich, schon im zweiten Jahr namhafte Zuschüsse aus dem Gewinn der Albrecht-Dürer-Druckerei für die Erhaltung der ,Redchspost’ abzugeben. Der Betrieb in der Bandgasse entwickelte sich stürmisch, trotz der katastrophalen Wirtschaftslage, und verdoppelte durch die immer mehr zunehmenden Aufträge und die steigende Auflage des Blattes sein Personal und seine Kapazität.”
Dr. Prochazka erhielt übrigens auch noch später in den kritischen nationalsozialistischen Zeiten Gelegenheit, sein Geschick und seine Klugheit in den Dienst des Blattes zu stellen.
Zugsunfall und — Bewährung
Der Umgang mit Ämtern, Behörden und Gerichten war damals nicht einfacher als heute. Die Presse galt und gilt noch heute vielfach als lästiger Schnüffler, besonders dort, wo es irgendwie „brandelt”. Ein Vorfall, der sich gleich einige Wochen nach der Gründung des „Kleinen Volksblattes” ereignete, ist typisch dafür — und für die Schwierigkeit journalistischer Arbeit.
Auf dem Wiener Westbahnhof waren am Mittwoch, 14. Februar 1929, einem tief verschneiten, eiskalten und nebeligen Wintertag, wie immer zwei internationale Schnellzüge in dem nicht ganz verständlich kurzen Abstand von wenigen Minuten um 9 Uhr und um 9.05 Uhr abgelassen worden, das heißt natürlich mit der in diesen Hochfrosttagen üblichen Auftauverspätung, die dann nach Möglichkeit eingebracht werden sollte. Der vordere Zug war der damals „E 129” benannte Arlbergexpreß, der ihm folgende war „D 55”. Ausgerechnet der letztere war mit der damals größten Dampflok Europas bespannt, also leistungsfähiger und schneller als der ihm vorausfahrende Arlbergexpreß.
Nun wollte es ein Verhängnis, daß der „Arlex” wegen eines Gebrechens in der Station Tullnerbach-Preß- baum zum Stehen gebracht werden mußte. Im tiefen Nebelgebräu überfuhr hinter ihm „D 55” das korrekt gegebene Sperrsignal und prallte, im letzten Augenblick allerdings stark abgebremst, auf den stehenden Arlbergexpreß, dessen Pullmann- wagen hielten, was zu halten war, aber die Plattformen waren dennoch insgesamt ineinandergedrückt.
Außerdem gab es über 30 Leichtverletzte.
Durch den Anruf einer Leserin erfuhr ich schon wenige Minuten nach dem Unglück davon. Glühend vor Begeisterung und Verlangen nach Bewährung als junger Lokalchef rief ich Zeichner Langer an und raste mit ihm im Taxi an die Unglücksstätte. Dort empfing uns das berühmte österreichische: „Zaruck!” Irgendwie war es verständlich: Auf der „schuldigen” „D-55’’-Riesenlok waren nämlich einige hohe Herren der Bundesbahngeneraldirektion mitgefahren, und Lästerzungen behaupteten sofort, dies sei der Grund für die Unaufmerksamkeit beziehungsweise Irritierung des Lokführers gewesen. Weg also um Gottes willen mit der unbequemen und neugierigen Presse! Zeichner Langer aber hatte einen Einfall. Arrogant verließen wir die Sperre und gruben uns auf der dem Bahnsteig gegenüberliegenden Seite in metertiefem Schnee ein Standloch. Langer zeichnete, ich schrieb in der ungemütlichen Stellung. Aber der Schweiß im Zähneklappern lohnte sich: Haushoch schlug das junge Blatt in Bild und Ton die gesamte Konkurrenz und hatte damit nicht nur seine Feuerprobe im idealen Zusammenspiel von Illustration und Eigenberichterstattung bestanden, sondern gleichzeitig der Bürokratie ein Schnippchen geschlagen.
Drei Wiener Originale von einst
Über unsere Begegnungen mit den Gerichten ist eigentlich nichts besonders Schlimmes zu berichten. Als lange Jahre amtierender „Verantwortlicher” weiß ich davon ein Lied zu singen.
Um diese Zeit gab es in Wien drei Originale, die, ein jedes aus völlig anderem Grunde, immer wieder auf sich aufmerksam machten: Der Goldfüllfederkönig, die Dame mit der Wespentaille und die Reichsgräfin Triangi.
Mit der letzteren, einer schrulligen, geltungssüchtigen Frau, die mit Titel und Orden nur so um sich warf (nebenbei bemerkt: sie standen ihr wirklich zu!), hatte einer unserer Mitarbeiter eine eigentümliche Begegnung. Sie trat einige Abende lang in einer Döblinger Bar auf und brachte durch ihr Gehaben als tanzender Backfisch (in Wirklichkeit war sie eine alternde Frau) das sehr gemischte Publikum zu dröhnendem Gelächter. Es war ein Skandal. Darauf aufmerksam gemacht, opferte ein Kollege einen Abend für einen Besuch. Es war wirklich eine Schande, was sich dort tat. Am nächsten Tag schrieb er eine scharfe Glosse, die uns prompt eine Ehrenbeleidigung der Reichsgräfin eintrug. Es kam zur Verhandlung vor dem damals sehr populären Presserichter Dr. Powalatz. Als der Kollege mit meinem Anwalt von der Kanzlei Kienböck-Foglar-Deinhard- stein den Verhandlungssaal betrat, war die Klägerin schon anwesend. Mit einem überdimensionierten Rosenstrauß bewaffnet, stürzte sie auf den Kollegen zu, überreichte ihm die Blumen und sagte beinahe im Hexameter: „Nicht feindlich wollen wir uns gegenübertreten, sondern ritterlich!” Ehe er es verhindern konnte, drückte sie ihn an ihre wogende Brust und schmatzte ihm einen Kuß auf die Stirne. Da sie sich zentimeterdick mit Schminke und Lippenrot zu schmücken pflegte, hatte er nachher Mühe, seine Stirne zu reinigen. Im selben Augenblick betrat der Presserichter den Saal, sah zuerst verdutzt, dann schmunzelnd die Szene und eröffnete die Verhandlung. Das „Volksblatt” wurde wegen berechtigter Kritik freigesprochen.
„Kuckuck” ruft’s aus dem Wald
Um diese Zeit hatten die Sozialdemokraten der lahm gewordenen christlichen Illustrierten „Kikeriki”, einer Gründung des vorigen Jahrhunderts durch den Lokaldichter O. F. Berg, die damals schon ihre beste Zeit hinter sich hatte, eine Konkurrenz entgegengesetzt: den „Kuckuck”. Dieser „Kuckuck” brachte einmal auf der Titelseite eine Trickmontage, die den Kanzler Dr. Seipel Waffen segnend zeigte. Seipel reagierte darauf in einer Versammlungsrede und verurteilte die „Frechheit” des Blattes und seiner üblen Tricks. Diesen Passus druckten wir ab, und schon hatten wir eine Ehrenbeleidigungsklage des „Kuckuck” im Genick.
Juristisch stand die Sache nicht gut für uns. Da aber hatte unser Anwalt einen schlechtweg genialen Einfall. Er hatte den damaligen Präsidenten der Organisation der Wiener Presse, Marcel Zappler (etwa den heutigen Günther Nenning), als Sachverständigen geladen und verwickelte ihn während der Verhandlung in folgendes Frage- und Antwortspiel. Anwalt: „Herr Präsident, was ist ein sozialdemokratisches Blatt?” Präsident: „Nun ja, das ist wohl klar, das ist ein Blatt, das sozialdemokratische Ideen vertritt!” Anwalt: „Ich danke, Herr Präsident. Sagen Sie mir nun, was ein illustriertes Blatt ist.” (Seipel hatte nämlich den „Kuckuck” nicht namentlich genannt, sondern nur von „einem sozialdemokratischen illustrierten Blatt” gesprochen.) Präsident: „Ein illustriertes Blatt ist ein Blatt, das Zeichnungen und Bilder bringt.” Anwalt: „Dann wäre also ,Das Kleine Blatt’ neben vielen anderen auch ein sozialdemokratisches illustriertes Blatt?” Präsident: „Selbstverständlich.”
Nun hatten wir gewonnen, denn unser Anwalt bestritt die Aktivlegitimation des Klägers, und ich wurde freigesprochen. Als Dr. Seipel davon hörte, sagte er schmunzelnd: „Moraltheologisch müßte ich die Sache verurteilen. Juristisch war es ein herrlicher Kniff. Ich gratuliere!”
Das erste Opfer
Einen juristischen Treppenwitz leistete sich das Schicksal in der schon politisch sehr gespannten Zeit. Um die ärgsten Auswüchse der Polemik zu verhindern, hatte Kienböck die nach seinem Namen „Kienböck-Novelle” benannte Änderung des Pressegesetzes durchgesetzt, wonach qualifizierte Ehrenbeleidigungen und Verleumdungen sogar vor ein Schwurgericht kommen konnten. Pikanterweise waren die ersten Opfer der Kienböck-Novelle — wir, seine Klienten. Ein Mann hatte das damals noch bestehende, aber vorübergehend gesperrte Carl- Theater durch Finanzierung neu eröffnen wollen. Die ganze Sache war ein Schwindel, bei der sich der Mann bereichern wollte. Aber die Polizei griff um eine Kleinigkeit zu früh zu, so daß ihm bloß nachgewiesen werden konnte, daß er zur Zeit der ersten Engagierungen kein Geld besaß. Nicht entkräften konnte man aber seine Behauptung, daß hinter ihm geheimnisvolle Geldgeber gestanden seien, die ihm hätten beispringen sollen. Als ihn die Polizei freilassen mußte, schwoll ihm der Kamm, und er klagte uns vor dem Schwurgericht, die wir bloß den PoMzeibericht gebracht hatten, wegen Verleumdung und Ehrenbeleidigung. Gottlob benahm er sich vor den Geschworenen so ungeschickt und arrogant, daß ich 11:1 freigesprochen wurde.
Schamhaft verschweigt der Chronist die wenigen Verurteilungen des Blattes.
Unruhe vor dem Sturm
Und die Zeit ging weiter. Sie brachte nicht immer nur Lokalgeschichte für das Blatt, sondern nicht selten (1934 bis 1938) Geschichte, ja auch Weltgeschichte. Aber sie ist ja bekannt, und es ist klar, daß sie ihre Wellen auch in die Redaktion schlug. Von der Hektik der politischen Spannungen zeugt ein interner Konflikt in unseren Verlagen, den heute nicht mehr viele wissen dürften. Darüber berichtete jetzt der als Prokurist 1967 nach über 50 Dienstjahren aus dem Haus Herold geschiedene Freund Z ückner:
„Als das .Kleine VoJksblatt’ ins Leben gerufen wurde, wurden vor allem vom Stammpersonal in der Strozzigasse Leute für das Tochterhaus gebraucht. Gott sei Dank habe auch ich mich dazu gemeldet. Und wenn ich heute zurückdenke, muß ich sagen, daß diese Zeit die schönsten Arbeitsjahre meiner ganzen Tätigkeit bis 1934 waren. Leider erschwerten von da an politisch gesteuerte Aktionen unsere Arbeit. Die christliche Gewerkschaft in der Laudongasse, Gruppe Buchdruck, wollte infolge wachsender Arbeitslosigkeit ihre Leute in christlichen Häusern unterbringen, was im Grunde verständlich war. Und dazu war in erster Linie die neue Dürer-Druk- kerei ausersehen. Die bis zu dieser Zeit allein bestehende Gewerkschaft der Buchdrucker sollte gleichzeitig damit geschwächt werden.
Nun darf ich nicht unterlassen, festzustellen, daß bei .Herold’ und ,Dürer’ immer ein Personal mat gemischten politischen Ansichten beschäftigt war, dieses aber selbst nie politisch aktiv wurde. Das aber bekämpfte die Laudongasse und ver- anlaßte die Direktion beider Häuser, sie in diesen Belangen zu unterstützen … Da mußten wir wieder unseren Dr. Funder damit befassen, der verfügte, daß keinem im Haus Beschäftigten Entlassung drohe, die Laudongasse aber immerhin berücksichtigt werden müsse. Durch die politische Umgruppierung in Österreich wurden dann später ohnehin alle Gewerkschaften aufgelöst und dafür eine Einheitsgewerkschaft eingesetzt. Durch Dr. Funders Verfügung war die Ruhe für fast weitere vier Jahre in unseren Häusern eingekehrt. Aber nur scheinbare Ruhe, die Ruhe vox dem Sturm.”
Es kam der historische März 1938
Der Sturm — das War der März 1938.
Und hier müßte die Chronik eigentlich schließen, denn tatsächlich endet in dieser Zeit die Geschichte jenes „Kleinen Volksblattes”, wie es seine Gründer gemeint hatten.
Doch wird immer wieder die Frage laut, wie denn das „Kleine Volksblatt” diese Zeit überhaupt überdauert hat. Daher wenigstens dieser kurze Anhang.
Am kritischen Tag, als Bundeskanzler Dr. Schuschniggs Abschied im Radio Wien verklungen war, war der Chronist im neuen Innenministerium, wohin er sich über Auftrag Hermann Maillers zur Information gemeldet hatte, überraschend bis Mitternacht interniert, was ihm übrigens später noch zweimal an weniger angenehmer Stätte, der Gestapo am Morzinplatz, widerfuhr. Am nächsten Tag begann dann das Nachfolge-Chef-Spiel, das nach wechselvollen Zwischenspielen der Vorarlberger Amann gewann. Aus der alten Redaktion wurde lediglich Redakteur Franz M. Eichhorn eliminiert, und zwar wegen der Berichterstattung über die letzten NS-Ver- urteilungen. Das Blatt selbst war den neuen Machthabern als Propagandainstrument nicht unerwünscht. Über uns Redakteure hielt eine gute Zeit lang der „Kommissarische Hauptschriftieiter” Amann (er starb später als Offizier in jugoslawischer Gefangenschaft) in der Folgezeit seine schützende Hand, wie er überhaupt zwar fachlich nicht übermäßig versiert, was aber noch wichtiger war: charakterlich grundanständig, loyal und großzügig war. Er war des „Kleinen Volksblattes” Glück im Unglück.
Dann kam der Krieg. Und riß Lücke um Lücke in die Redaktion, die durch Redaktricen ersetzt wurden. Hermann Mailler durfte sogar noch eine Zeitlang als Vizechef bleiben. Das „Kleine Volksblatt” wurde 1944 mit anderen Zeitungen zur „Kleinen Kriegzedtung” umgeformt, bis auch diese schließlich im Granatwerferfeuer verstummte.
Neues Leben
Einige Zeit noch, bis 1941, erlebte der Chronist die Zeit wie im Traium. Mögen ihm Kolleginnen und Kollegen, die da neben ihm wirkten, verzeihen, daß er ihre Namen unterschlägt. Es waren brave Leute darunter, Untergebene, Mitarbeiter, Freunde. Ich bewahre ihr Andenken ehrenvoller als die sehr erschwerte journalistische Arbeit, aber Traum ist Traum und nicht immer Leben.
Als ich nach sechs Jahren Kriegsdienst und Gefangenschaft heimkehrte, gehörte das „Kleine Volksblatt” dem „österreichischen Verlag”. Mich nahmen die „Furche” und ihr Chef, Dr. Friedrich Funder, auf. Er schenkte dem total Ausgebombten, dessen Familie in alle Winde zerstreut war, wieder das erste Hemd und die erste Krawatte.
Der Traum war zu Ende, das Leben fing wieder an.
Auch das Schicksal des „Kleinen Volksblattes” trat in einen neuen Abschnitt — bis heute.
Hier aber legt der Chronist die Feder zur Seite, stolz und demütig zugleich, ehrfürchtig vor dem Schalten und Walten in den 15 Jahren des Blattes. Dankbar aber dem Schöpfer. „Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben.”
(Ende)
Siehe auch „Die Furche” Nummern 4, 5, 6 und 7.