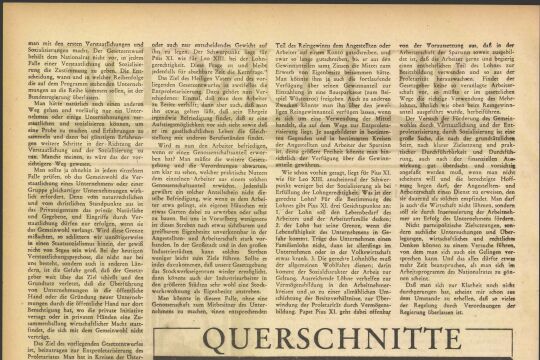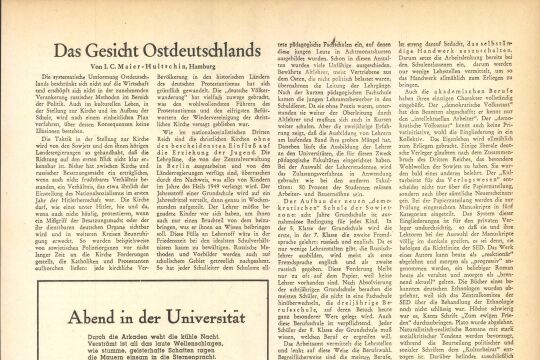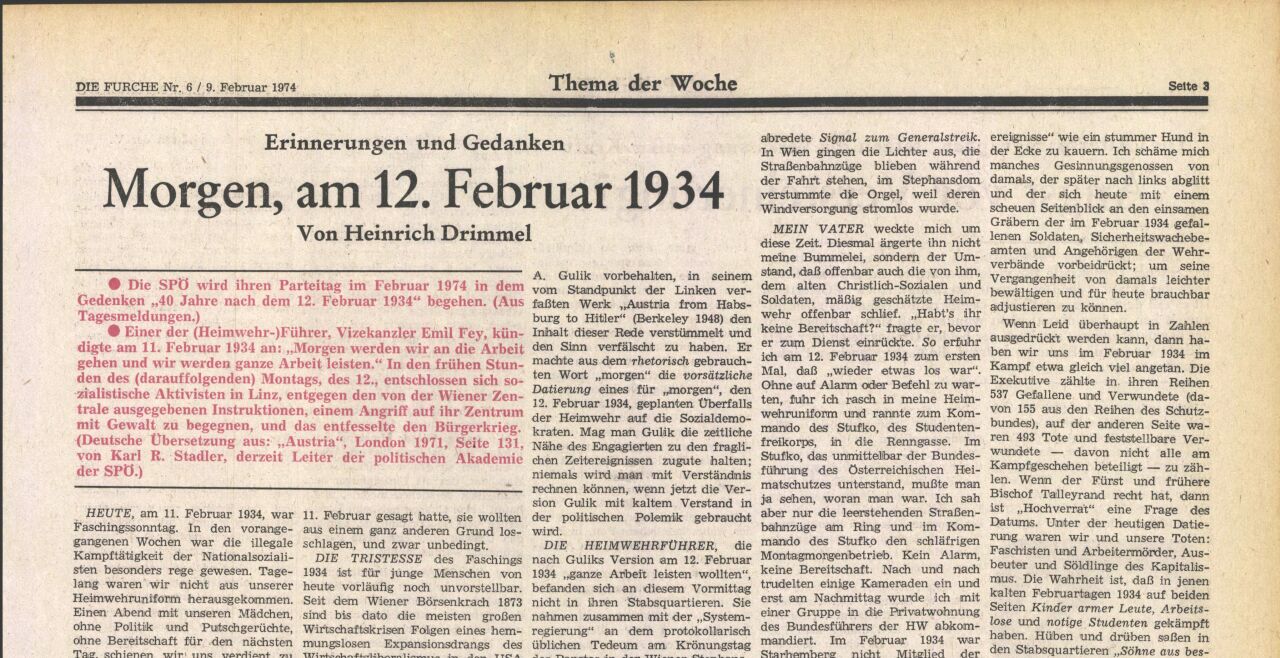
Morgen, am 12. Februar 1934
• Die SPÖ wird ihren Parteitag im Februar 1974 in dem Gedenken „40 Jahre nach dem 12. Februar 1934“ begehen. (Aus Tagesmeldungen.)• Einer der (Heimwehr-)Führer, Vizekanzler Emil Fey, kündigte am 11. Februar 1934 an: „Morgen werden wir an die Arbeit gehen und wir werden ganze Arbeit leisten.“ In den frühen Stunden des (darauffolgenden) Montags, des 12., entschlossen sich sozialistische Aktivisten in Linz, entgegen den von der Wiener Zentrale ausgegebenen Instruktionen, einem Angriff auf ihr Zentrum mit Gewalt zu begegnen, und das entfesselte den Bürgerkrieg. (Deutsche Übersetzung aus: „Austria“, London 1971, Seite 131, von Karl R. Stadler, derzeit Leiter der politischen Akademie der SPÖ.)
• Die SPÖ wird ihren Parteitag im Februar 1974 in dem Gedenken „40 Jahre nach dem 12. Februar 1934“ begehen. (Aus Tagesmeldungen.)• Einer der (Heimwehr-)Führer, Vizekanzler Emil Fey, kündigte am 11. Februar 1934 an: „Morgen werden wir an die Arbeit gehen und wir werden ganze Arbeit leisten.“ In den frühen Stunden des (darauffolgenden) Montags, des 12., entschlossen sich sozialistische Aktivisten in Linz, entgegen den von der Wiener Zentrale ausgegebenen Instruktionen, einem Angriff auf ihr Zentrum mit Gewalt zu begegnen, und das entfesselte den Bürgerkrieg. (Deutsche Übersetzung aus: „Austria“, London 1971, Seite 131, von Karl R. Stadler, derzeit Leiter der politischen Akademie der SPÖ.)
HEUTE, am 11. Februar 1934, war Faschingssonntag. In den vorangegangenen Wochen war die illegale Kampftätigkeit der Nationalsozialisten besonders rege gewesen. Tagelang waren wir nicht aus unserer Heimwehruniform herausgekommen. Einein Abend mit unseren Mädchen, Ohne Politik und Putschgerüchte, ohne Bereitschaft für den nächsten Tag, schienen wir1 uns verdient zu haben. Morgen, am 12. Februar, war Faschingsmonrtag, und den wollten wir blaumachen, um auszuschlafen.
ANFANG DER DREISSIGER JAHRE entschied sich für meine Generation, wo immer wir engagiert waren, das Schicksal. Im Sommer
1933 war ich als Nachfolger Josef Klaus' Vorsitzender der Katholischen Hochschülerschaft in Wien geworden. Damit kam ich in einen Kreis junger Aktivisten und bereits älterer Berater, die mit dem, was sie Zeitaufgeschlossenheit nannten, den Eindruck großer geistiger Beweglichkeit machten. So wie nachher in den sechziger Jahren progressive Fraktionen der katholischen Intelligenz das Aggiornamento im Sinne einer SoKdarisierung mit marxistischen Ideen verfolgen wollten, ebenso gab es in den dreißiger Jahren unter uns kleine, selbstausgewählte Gruppen, die „zeitgemäße Forderungen“ einer^ „nationalen Erneuerung“ auf sich nahmen. Ich fand im Vorstand der Katholischen Hochschülerschaft keine „geheimen Nazikonventikel“, aber ich spürte die mir konträren Ansichten und Absichten wie der Dackel den Fuchs. Nach dem 11. März 1938 erwiesen sich viele dieser Erneuerer als „illegale“ Parteigänger und -genossen der Nationalsozialisten. Unter' ihnen war der Außenminister im Kabinett Seyß-Inquart und der nach dem Anschluß eingesetzte Liquidator der Vaterländischen Front.
Nach meiner Überzeugung war der in Punkt 24 des Programms der NSDAP behauptete Standpunkt eines positiven Christentums ebenso unglaubwürdig und unhaltbar wie frühere oder spätere Versuche einer Vermischung von Marxismus und Christentum. In der Spätkrise jener Tage schien mir der Balance-versuch „sowohl — als auch“ ebenso gefährlich wie ein Überdauern nach dem Motto: „weder — noch“. An der Spitze des Vorstandes der Katholischen- Hochschülerschaft war ich sichtlich fehl am Platz. Ich legte dieses Amt nieder und rückte zum Freiwilligen Schutzkorps ein. Keiner meiner vielen Freunde dachte damals daran, daß die Gewehre so bald nach links hin losgehen würden.
IN DER-.'NACHT zum 12. Februar
1934 kam ich spät heim. Als ich das Haustor aufschloß, sah ich nebenan vor der Tür der Trafik schon die Bündel der Morgenzeitungen liegen. Was, in diesen Zeitungen stand, erfuhr ich in den nächsten Tagen ebensowenig, wie ich ahnen konnte, was einmal Historiker aus diesen Zeitungen für einen Sinn der fraglichen Rede des Vizekanzlers Fey herauslesen würden. Niemand von uns konnte ahnen, daß in dieser Nacht der Wiener sozialdemokratische Gemeinderat Alois Jalkotzy mit einer Meldung des oberösterreichischen Schutzbundführers an das Exekutiv-Komi'tee des (illegalen) Republikanischen Schutzbundes von Linz nach Wien unterwegs war. Die Linzer Genossen wußten, wie sich später herausstellte, nicht, was Fey am 11. Februar gesagt hatte, sie wollten aus einem ganz anderen Grund losschlagen, und zwar unbedingt.
DIE TRISTESSE des Faschings 1934 ist für junge Menschen von heute vorläufig noch unvorstellbar. Seit dem Wiener Börsenkrach 1873 sind bis dato die meisten großen Wirtschaftskrisen Folgen eines hemmungslosen Expansionsdrangs des Wirtischaftsliberalisrnius in den USA gewesen. So war auch die Not der dreißiger Jahre Folge der in den USA ausgebrochenen Weltwirtschaftskrise 1929. Die jetzige SPÖAlleinregierung verwendet das derzeitige Schlagwort von der „importierten Krise“ mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der Anfang der dreißiger Jahre eine sozialdemokratische Opposition den Spieß umgekehrt hat. Jahrelang wurde damals den Arbeitslosen, Ausgesteuerten und jugendlichen Arbeitsuchenden eingehämmert, daß an ihrer Not nicht die Weltwirtschaftskrise schuld sei, sondern die Ausbeuterpolitik der Christlich-Sozialen und deren Regierung. Die Figur eines am Galgen baumelnden christlich-sozialen Bundeskanzlers oder Finanzministers gehörte zur Standardausrüstung der organisierten Arbeitslosendemonstrationen. Nach und nach wurden die politischen Antreiber, nicht nur die sozialdemokratischen, selbst Getriebene derer, die man überzeugt hatte, daß der gordische Knoten der Zustände nicht mehr zu lösen sei, daß er durchschlagen werden müsse. Die auf dem Linzer Parteitag 1927 der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei den Gegnern angedrohte Diktatur, wollte Julius Deutsch als eine „Diktatur zur Verteidigung der Demokratie“ verstanden wissen.
AM FASCHINGSSONNTAG 1934 machten Verbände der Wiener Heimwehr in der Umgebung von Groß-Enzersdorf eine Geländeübung. Nach diesem Exerzieren ohne Waffen im Gelände traten die Mannschaften vor dem Kriegerdenkmal des Ortes zu einer Ehrung der Gefallenen an. Emil Fey, Theresienordensritter, Führer der Wiener Heimwehr und Vizekanzler, hielt eine der bei solchen Anlässen üblichen Ansprachen: Die Opfer des Krieges von gestern sollten Ansporn für unsere Arbeit von morgen sein. Es blieb Charles A. Gulik vorbehalten, in seinem vom Standpunkt der Linken verfaßten Werk „Austria from Habsburg to Hitler“ (Berkeley 1948) den Inhalt dieser Rede verstümmelt und den Sinn verfälscht zu haben. Er machte aus dem rhetorisch gebrauchten Wort „morgen“ die vorsätzliche Datierung eines für „morgen“, den 12. Februar 1934, geplanten Überfalls der Heimwehr auf die Sozialdemokraten. Mag man Gulik die zeitliche Nähe des Engagierten zu den fraglichen Zeitereignissen zugute halten; niemals wird man mit Verständnis rechnen können, wenn jetzt die Version Gulik mit kaltem Verstand in der politischen Polemik gebraucht wird.
DIE HEIMWEHRFÜHRER, die nach Guliks Version am 12. Februar 1934 „ganze Arbeit leisten wollten“, befanden sich an diesem Vormittag nicht in ihren Stabsquartieren. Sie nahmen zusammen mit der „System-regierung“ an dem protokollarisch üblichen Tedeum am Krönungstag des Papstes in der Wiener Stephanskirche teil. Vielleicht wäre der Gedanke, bei dieser Gelegenheit die Spitze des „Systems“ auszuheben und zu putschen, gar nicht so kalt gewesen. Am 25. Juli 1934 ist ein derartiger Versuch einer SS-Kampftruppe fast geglückt. In revolutionären Zeiten pflegt der Stephansdom nicht mehr Zuflucht zu gewähren, als das Palais am Ballhausplatz. 1848 bereits haben linksradikale Garden und Studenten ihre „bürgerlichen“ Feinde nach einem Kampf am Graben bis in den Dom hinein verfolgt und vor dem Hochaltar niedergeschlagen. Auch damals hat die Linkspropaganda mit großer Fixigkeit den Spieß umgedreht und aus den Verfolgten die Verfolger gemacht, die aus der Kirche auf „Vor-stadtgarden und Studenten“ geschossen haben sollen.
IN DER GUMPENDORFER-STRASSE tagte während des Papst-tedeums 1934 das Exekutivkomitee des Schutzbundes, und zwar in Anwesenheit des Landessekre'tärs der nach wie vor legalen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Man beriet über mögliche Folgen der während der Nacht aus Linz eingetroffenen Meldung, wonach der dortige Schutzbundführer Richard Bernascheck auf jeden Fall losschlagen wollte, wenn sich die staatliche Exekutive an seine Waffenbestände heranmachen würde. Das Telegramm Otto Bauers, in dem er die Linzer Genossen gewarnt hat, jetzt aus der Bereitstellung herauszutreten, kam zu spät. Als die Sicherheitsbeamten im Linzer „Hotel Schiff“ mit einer Waffensuche beginnen wollten, liefen sie in das MG-Feuer des Schutzbundes. Die Wiener Zentrale hatte gewarnt, aber sie setzte die von den Linzern geforderte Solidaritätsaktion in Gang: Um 11.30 Uhr schalteten sozialdemokratische Vertrauensleute im Wiener E-Werk den Strom ab. Das war laut Julius Deutsch das verabredete Signal zum Generalstreik. In Wien gingen die Lichter aus, die Straßenbahnziüge blieben während der Fahrt stehen, im Stephansdom verstummte die Orgel, weil deren Windversorgung stromlos wurde.
MEIN VATER weckte mich um diese Zeit. Diesmal ärgerte ihn nicht meine Bummelei, sondern der Umstand, daß offenbar auch die von ihm, dem alten Christlich-Sozialen und Soldaten, mäßig geschätzte Heimwehr offenbar schlief. „Habt's ihr keine Bereitschaft?“ fragte er, bevor er zum Dienst einrückte. So erfuhr ich am 12. Februar 1934 zum ersten Mal, daß „wieder etwas los war“. Ohne auf Alarm oder Befehl zu warten, fuhr ich rasch in meine Heimwehruniform und rannte zum Kommando des Stufko, des Studentenfreikorps, in die Renngasse. Im Stufko, das unmittelbar der Bundesführung des österreichischen Heimatschutzes unterstand, mußte man ja sehen, woran man war. Ich sah aber nur die leerstehenden Straßenbahnzüge am Ring und im Kommando des Stufko den schläfrigen Montagmorgenbetrieb. Kein Alarm, keine Bereitschaft. Nach und nach trudelten einige Kameraden ein und erst am Nachmittag wurde ich mit einer Gruppe in die Privatwohnung des Bundesführers der HW abkommandiert. Im Februar 1934 war Starhemberg nicht Mitglied der Bundesregierung und als wir zu seiner Wohnung in der Biberstraße kamen, fanden wir diese unbewacht. Nichts wäre leichter gewesen, als den
„Fürschtn“ zu kidnappen. Aber jetzt standen wir auf Wacht: Sechs Studenten mit zwei aussortierten Steyr-Kipplaufpistolen und sechs Schuß Munition für sechs Mann. Am Abend dieses Tages verließ Starhemberg seine Wohnung, um mit einer Schutzkorpsabteilung nach Steyr auszurücken. Ich blieb bis zum Morgen des 13. Februar in der Biberstraße.
ERST ALS SICH DIE FURCHTBARE GEWALT des Bürgerkrieges ausgetobt hatte, erfuhren wir, wie zum Beispiel in Steyr der 12. Februar 1934 begonnen hatte. Dort war ein Heimwehrmann, der mit seiner Braut spazieren ging, erschossen worden. Deim Direktor der Waffenfabrik war mit einem aus nächster Nähe abgegebenen Schuß der Schädel zertrümmert worden. Vier Offiziere des Bundesheeres, die nach dem Sonntag in ihre Welser Garnison einrücken wollten, wurden in der Nähe von Steyr erschossen. Von Steyr aus gab ein Gewerkschaftssender alle halben Stunden Instruktionen für die „proletarische Revolution“ aus. Starhembergs Konvoi, der in Tulln zu einem Verband des Bundesheeres stoßen sollte, geriet auf der Fahrt durch die Heiligen-städtenstraße in MG-Feuer. Der Schutzbund hatte die im Karl-Marx-Hof vorbereitete Sperre der nördlichen Ausfallstraße besetzt und war auf Draht gewesen. Vier Männer des Konvois Starhembergs, aus dem kein Schuß fiel, wurden schwer verletzt, zwei sind gefallen.
40 JAHRE NACHHER will ich nicht weiter im Tagebuch des österreichischen Bürgerkriegs blättern. Es wäre aber ein Fehler, angesichts späterer sozialistischer und staatsoffizieller Versionen der „Februarereignisse“ wie ein stummer Hund in der Ecke zu kauern. Ich schäme mich manches Gesinnungsgenossen von damals, der später nach links abglitt und der sich heute mit einem scheuen Seitenblick an den einsamen Gräbern der im Februar 1934 gefallenen Soldaten, Sicherheitswachebeamten und Angehörigen der Wehrverbände vorbeidrückt; um seine Vergangenheit von damals leichter bewältigen und für heute brauchbar adjustieren zu können.
Wenn Leid überhaupt in Zahlen ausgedrückt werden kann, dann haben wir uns im Februar 1934 im Kampf etwa gleich viel angetan. Die Exekutive zählte in ihren Reihen 537 Gefallene und Verwundete (davon 155 aus den Reihen des Schutzbundes), auf der anderen Seite waren 493 Tote und feststellbare Verwundete — davon nicht alle am Kampfgeschehen beteiligt — zu zählen. Wenn der Fürst und frühere Bischof Talleyrand recht hat, dann ist „Hochverrat“ eine Frage des Datums. Unter der heutigen Datierung waren wir und unsere Toten: Faschisten und Arbeitermörder, Ausbeuter und Söldlinge des Kapitalismus. Die Wahrheit ist, daß in jenen kalten Februartagen 1934 auf beiden Seiten Kinder armer Leute, Arbeitslose und notige Studenten gekämpft haben. Hüben und drüben saßen in den Stabsquartieren „Söhne aus besseren Familien“. Daß es auch unter den Habenichtsen der Welt Millionen Menschen gibt, die um keinen Preis die im Anschluß an Karl Marx unternommenen Experimente mitmachen wollen, will auch der „moderne Sozialismus“ unter keinen Umständen verstehen. Dieses Zugeständnis würde einem klassenkämpferisch inspirierten Vorhaben die innere Spannkraft nehmen.
BRUNO KREISKY hat von seinem Standpunkt aus recht, wenn er nach wie vor seine im österreichischen Bürgerkrieg eingenommene Haltung für sich in Anspruch nimmt und seine damaligen Gegner und Verfolger anklagt. Unsereins hat das gleiche Recht zu fragen, was wohl geschehen wäre, wenn der bewaffnete Aufstand des Schutzbundes, der versuchte Generalstreik und die von Theodor Körner seinerzeit ins Auge gefaßte Leuee en masse geglückt wäre. An diesbezüglichen Hinweisen fehlt es ebensowenig wie an historischen Beispielen der frühen dreißiger Jahre. (Spanien zwischen 1931 und 1936.)
Als 1920 die vorherige Konzentra-tionsregierunig zerbrach und Karl Renner mit seinem Versuch, dieses Experiment zu erneuern, bei seinen politischen Freunden nicht durchdrang, schrieb der Staatskanzler in seine Erinnerungen:
Es scheint so, daß Koalitionsregierungen zu begründen, zusammenzuhalten und zu führen, große politische Kunst und Weisheit erfordert.
Dementgegen hat man in den zwanziger Jahren in beiden großen Parteien eine andere Vorstellung gehabt: Keine Partei wollte sich länger auf eine Teilung der Macht in der Republik einlassen. Um ihr Programm ausführen zu können, glaubte jede Partei der ganzen Macht zu bedürfen. Eine Teilung der Macht wurde als Packelei, als kompromittierend und als Politikmithilfe von Proporz und Pfründen abgetan.
1931, als der Nationalsozialismus bereits zum Durchbruch an die Macht ansetzte, hatten Otto Bauer und Ignaz Seipel versucht, am Rand der drohenden Katastrophe alle Abwehrkräfte in einer Regierungskoalition zu sammeln. Bauer kam in seiner Partei nicht durch, Seipel wurde bei seinen Freunden gründlich mißverstanden. Von da an hat das „Gespräch der Feinde“ eine lange Geschichte bis zu jenem Februartag im Jahre 1963, an dem uns Alfons Gorbach und Bruno Pittermann zusammen zum Mahnmal der Opfer des österreichischen Bürgerkrieges auf dem Wiener Zentralfriedhof führten.
Nachher dachte man in ÖVP und SPÖ eher so wie in den zwanziger Jahren. Ob die Krise 1973 mit der von 1929 verglichen werden kann, wird man binnen kurzem wissen. Noch kürzer ist vielleicht die Zeit, die allen staatstragenden Kräften in Österreich zur Besinnung auf ihre Pflicht zur nationalen Solidarität bleibt.