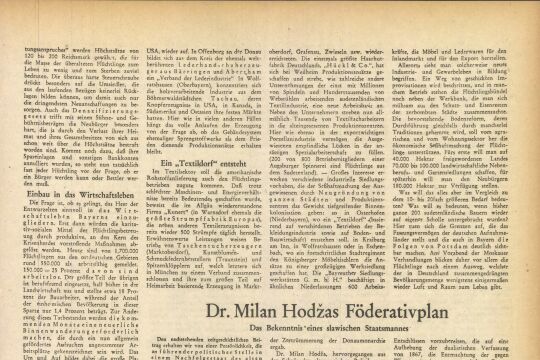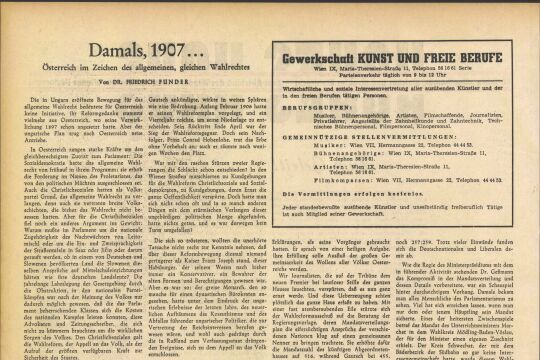Mit dem Brand des Justizpalastes begann Österreichs Weg in den Abgrund. Norbert Leser versteht sein neues Buch als Menetekel.
Ein schwarzer Tag Österreichs jährt sich zum 75. Mal. Am 15. Juli 1927 brannte der Justizpalast und 90 Menschen starben, die meisten im Kugelhagel der Polizei. Auch völlig Unbeteiligte fielen einer wahren Hasenjagd der durchdrehenden Exekutive zum Opfer. Auslöser der außer Kontrolle geratenen Massendemonstration war der Freispruch dreier Männer, die am 30. Jänner in Schattendorf einen Kriegsinvaliden und ein Schulkind erschossen hatten. Nach der Tragödie verbauten die Exponenten der großen Lager, allen voran der christlichsoziale Bundeskanzler Ignaz Seipel, alle Wege zur Versöhnung. Ab da ging es mit der Ersten Republik bergab. Ende Jänner 1933 errichtete Engelbert Dollfuß den autoritären Ständestaat und weitere fünf Jahre später, am 11. März 1938, stürzte Österreich seiner Demokratie hinterher in den Abgrund. Der 15. Juli 1927 ist also eine Erinnerung wert.
Das Buch "Als die Republik brannte - Von Schattendorf bis Wien" erschien zur rechten Zeit. Die Herausgeber Norbert Leser und Paul Sailer-Wlasits wollen "diese dramatischen Begebenheiten noch einmal in das historisch-politische Rampenlicht ... stellen, bevor sie endgültig in das Schattenreich der Geschichte absinken." Ein weiteres Motiv war, "daß sich auch im Österreich von heute Polarisierungen ereignen, die, wenn man sie nicht rechtzeitig eindämmt und beherrscht, zu ähnlich katastrophalen Folgen führen können."
Funder im Schlosseranzug
Generationen haben sich den Kopf darüber zerquält, wie Wiener Arbeiter, die brav die "Arbeiter-Zeitung" lasen und am Munde ihrer politischen Führer hingen, den Justizpalast in Brand stecken konnten. Wie es möglich war, dass sie die Feuerwehr nicht löschen ließen, obwohl Bürgermeister Seitz, der Mann des Roten Wien, vom Feuerwehrwagen herab zur Vernunft rief. Sie hörten ihm nicht zu. Wie es möglich war, dass die Massen, in deren Namen die Partei handelte und die sich noch stets an deren Direktiven gehalten hatten, die Redaktion der deutschnationalen "Wiener Neuesten Nachrichten" verwüsteten und das Gebäude der "Reichspost" in der Strozzigasse anzündeten. Möglicherweise hätten sie Friedrich Funder umgebracht, hätten ihn nicht seine Mitarbeiter in einem widerwillig übergestreiften Schlosseranzug in Sicherheit gebracht. Ein Detail von tiefer Symbolik: Mit allen Gerichtsakten, Grundbüchern und Archivalien verbrannte auch das Gründungsdokument der Republik, das Original der Verzichterklärung Kaiser Karls. Der 15. Juli war eine schwere Niederlage gegenüber dem bürgerlichen Lager für die bis dahin so selbstbewusste Sozialdemokratie. Die neue Erfahrung mit den außer Rand und Band geratenen, selbstständig und zugleich blindwütig handelnden Massen war ein schwerer Schock für ihre Führer.
Norbert Leser versucht "das Allgemeine im Besonderen, das Notwendige im Zufälligen herauszuarbeiten und den geschilderten Gesamtverlauf nicht bloß als Summe von Einzelheiten und Zufällen, sondern als eine nach den aristotelischen Grundsätzen gebaute und verstehbare Tragödie darzustellen, in der sich menschliche Schuld und Verblendung mit ehernen Gesetzen politischer Abläufe vermischen und verschränken." Ein faszinierendes Vorhaben! Wirklichkeit abbilden will das Theater seit Aischylos und Euripides. Norbert Leser nimmt den 75. Jahrestag des 15. Juli 1927 nicht nur zum Anlass einer begründeten Warnung, sondern will auch nachweisen, dass sich Österreichs blutige Tragödie - Karl Kraus hätte ihn dafür möglicherweise gelobt - an die Gesetze des Theaters hielt.
Eherne Notwendigkeit?
Die äußere Handlung des Dramas liefert in zwei einleitenden Kapiteln Mitautor Gerhard Botz. Er führt, so Leser im Vorwort, "den historischen Aufriß, das Gerüst an Tatsachen vor Augen, an die jede Interpretation anknüpfen muß." Tatsächlich verzichtet Botz zwar keineswegs auf Interpretation, legt dabei aber Zurückhaltung an den Tag. Dafür stellt in seinem Essay "Der 15. Juli 1927 als Peripetie des Austromarxismus und der österreichischen Demokratie der Ersten Republik" Norbert Leser den Leser vor die Entscheidung für oder gegen ein Geschichtsbild, in dem das jeweils tatsächlich Eingetretene als das historisch Notwendige, einzig Mögliche gilt. Lässt sich wirklich "im Rückblick ... die eherne Gesetzmäßigkeit des Geschehens mit Sicherheit konstatieren"? Leser selbst bringt ein Beispiel, das die Grenzen dieses Verfahrens erkennbar macht. Alfred Migsch, ein sozialdemokratischer Minister der Zweiten Republik, erzählte ihm, wie er 1932 am Rande des Parteitages Otto Bauer seine Bedenken vortrug, "daß alles nicht gut ausgehen werde", worauf Bauer antwortete: "Ich gäbe Ihnen recht, Genosse Migsch, wenn Hitler in Deutschland an die Macht käme. Aber der hat seinen Höhepunkt bereits überschritten." Otto Bauer, meint Leser, sei nicht bereit gewesen, "den illusionären Charakter seiner Lagebeurteilung einzusehen, bis die Geschichte vollendete Tatsachen schuf und über das Bauersche Wunschdenken ... hinwegging."
Otto Bauer, der Visionär, der Illusionist, der Zauderer, der Verbalradikalist, ist eine der zentralen Figuren in Lesers Essay, auf den in der nächsten Furche einzugehen sein wird. Auch der berühmte Karikaturist Fritz Schönpflug verewigte ihn einmal für die Spätabendausgabe der "Reichspost" als Hamlet. Bloß: Hatte Hitler damals nicht seinen Höhepunkt tatsächlich überschritten? Liefen ihm nicht bereits seine Wähler davon? Hatte er noch große Chancen, an die Macht zu kommen? Ein bedeutender Teil all jener, die wenige Monate vorher noch befürchtet hatten, Hitler sei kaum mehr aufzuhalten, war nun der Meinung, dass seine Felle den Bach hinunterschwammen. Doch dann ernannte ihn der greise Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler. Ohne unmittelbar vorausgegangene Wahlen, ohne echte Notwendigkeit, nicht zuletzt in der berechtigten Hoffnung, sich damit eine Korruptionsaffäre vom Hals zu schaffen.
Hätte also Otto Bauer auch recht behalten und alles ganz anders kommen können? So schwer das 20. Jahrhundert ohne seine Gräuel vorstellbar ist - auch eine "eherne Gesetzmäßigkeit", die nur durch ein seniles Gehirn zum Zuge kam, stellt das Denken vor ernste Probleme. Lesers Essay macht aber auch den Erklärungsbedarf deutlich, der 75 Jahre nach dem 15. Juli noch immer besteht. Doch ob einzige Möglichkeit oder nur die von der Geschichte realisierte: An der Schrecklichkeit dieser Wirklichkeit ändert es nichts.
Schüsse gegen Schimpfer
Ausgerechnet im ruhigsten und friedlichsten Bundesland kam es zur kleinen Tragödie, die zur großen Tragödie des 15. Juli führte. Bis 1926 hatte eine Dreiparteienvereinbarung in dem erst im Herbst 1921 zu Österreich gelangten Burgenland die Aufstellung paramilitärischer Verbände verhindert. Doch 1926 begann die Frontkämpfervereinigung von Wien aus Ortsgruppen im Burgenland zu errichten. Im roten Schattendorf mit seinen neun Sozialdemokraten und sechs Christlichsozialen im Gemeinderat beantwortete im Sommer 1926 der Republikanische Schutzbund die Gründung einer Ortsgruppe der "Frontkämpfer" sofort mit einer über doppelt so starken Gegengründung. Am 30. Jänner 1927 hinderte er Ankommende, die eine lokale Frontkämpferveranstaltung verstärken sollten, am Verlassen des Bahnhofs und marschierte, begleitet von Dorfbewohnern und mitlaufenden Kindern, triumphierend durch den Ort. Beim Gasthaus Tscharmann fielen Beschimpfungen und flogen Steine. Mehrere Männer schossen mit Gewehren, die seit Mittag bereit lagen, aus einem vergitterten Wohnzimmerfenster des Gasthauses, das den "Frontkämpfern" als Treffpunkt diente. Sie töteten einen Schutzbund-Mann, der im Ersten Weltkrieg ein Auge verloren hatte, und ein Schulkind und verletzten acht weitere Menschen, fünf davon schwer. Für die Schützen bestand keine Gefahr. Die kritische Situation vor dem Haus war vorbei, einige in den Hof eingedrungene Schutzbündler waren wieder weg und die Todesschützen wussten es und traten sofort die Flucht durch den Hof an, wie die gerichtliche Rekonstruktion der Ereignisse ergab.
Evidentes Fehlurteil
Sie wollten wahrscheinlich nicht töten, sondern dürften in einer Mischung von Panik und ohnmächtiger Wut gehandelt haben. Drei Personen wurden wegen öffentlicher Gewalttätigkeit unter besonders gefährlichen Verhältnissen angeklagt. Ihr Freispruch am 14. Juli stellte die sozialdemokratische Führung vor ein doppeltes Dilemma. Reformistisch, parlamentarisch und demokratisch in der praktischen Politik, "hatte sie im täglichen politischen Kampf ihre Massenpropaganda nicht selten auf einen Klassenkampfbegriff ,im Heugabelsinn', wie sich Karl Renner auf dem sozialdemokratischen Parteitag von 1927 ausdrückte, eingestellt. Dadurch unterblieb im politischen Bewußtsein ihrer Anhänger die Bildung einer klaren Vorstellung vom Wesen der Demokratie" (Botz).
Das Fehlurteil war selbst in den Augen der Justiz so evident, dass sie den Freigesprochenen mit der Begründung, der Verdacht sei keineswegs entkräftet worden, die Haftentschädigung verweigerte. Doch der Freispruch war von Laienrichtern gefällt worden und das konservative Bürgertum schien nur auf einen Anlass zum Angriff auf die Geschworenengerichte zu warten: "Wie den Protest gegen das Schwurgerichtsurteil äußern und zugleich die Schwurgerichtsbarkeit nicht mit dem Odium des Versagens belasten?" Dass die Schuldfrage von sieben Mitgliedern der "Geschwornenbank" bejaht und nur von fünf verneint worden war, konnte man damals noch nicht wissen, das Abstimmungsergebnis war geheim. Doch für einen Schuldspruch war eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Eine fortschrittliche Regelung, geeignet, tragischen Justizirrtümern vorzubeugen, führte zu einer der großen Tragödien in der Geschichte der Republik.
In der nächsten Furche:
Die Explosion
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!