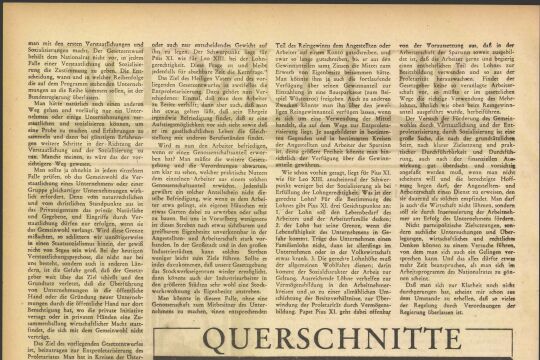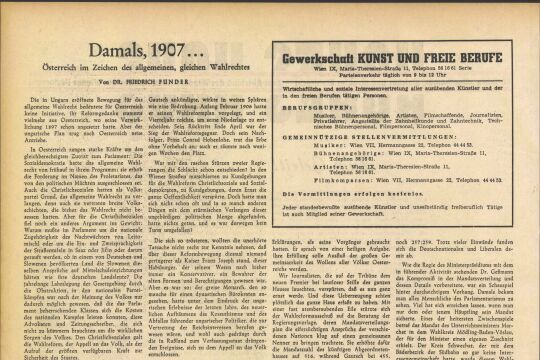Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Geschichte einer Malaise
Kurz nach dem Ersten Weltkrieg entstand aus der Feder eines der bekanntesten Karikaturisten von damals eine Serie drastischer Einzeldarstellungen vom Entstehen der Ersten Republik: Man sieht, wie die landhungrigen Nachfolgestaaten der Monarchie über die Landkarte Österreichs herfallen und sie in Fetzen reißen. Zuletzt bleibt nur mehr das „Fuzerl“ Restösterreich übrig — und obenauf der Wasserkopf Wien.
Kurz nach dem Ersten Weltkrieg entstand aus der Feder eines der bekanntesten Karikaturisten von damals eine Serie drastischer Einzeldarstellungen vom Entstehen der Ersten Republik: Man sieht, wie die landhungrigen Nachfolgestaaten der Monarchie über die Landkarte Österreichs herfallen und sie in Fetzen reißen. Zuletzt bleibt nur mehr das „Fuzerl“ Restösterreich übrig — und obenauf der Wasserkopf Wien.
Der Vorwurf: „Wasserkopf Wien“ ist seither, wenn auch in anderen Wortprägungen, in Gebrauch geblieben und unlängst noch hörte man Programme für ein „Gesundschrumpfen“ der Bundeshauptstadt. Rein zahlenmäßig belegt, scheint der Vergleich mit dem Wasserkopf eine gewisse Berechtigung zu haben, denn mehr als jeder vierte Österreicher wohnt in Wien. Daran ist aber nichts besonders. Denn: Auch in Dänemark, Ungarn, Griechenland oder Japan ist jeweils jeder dritte oder vierte Staatsbürger des betreffenden Landes in der Hauptstadt beheimatet. Aber keinem Dänen, Griechen, Ungarn, Japaner würde es einfallen, die Hauptstadt seines Landes in einem abfälligen Sinn als den Wasserkopf, als die fatale Malaise seines Heimatlandes hinzustellen. Ganz im Gegenteil.
Keine Geringerer als Adolf Hitler hat mit dem Gespür des Mannes aus der Provinz und mit dem Haß des aus Wien verstoßenen Versagers die Abneigung gegen den Kopf, der Wien nun einmal ist, erfaßt und nach der politischen Raison des NichtWieners ausgenützt. In seinen Tischgesprächen meinte Hitler in einer Zeit, in der selbst der Gebrauch der Ersatzbezeichnung „Ostmark“ von amtswegen verboten war, es sei „für die Ostmark das Richtige gewesen“, den „Zentralstaat (nämlich Österreich) auf Kosten Wiens zu zerschlagen“. Mit einem Mal seien so zahlreiche Reibungsflächen verschwunden und „jeder Gau sei fortan glücklich gewesen, sein eigener Herr zu sein“. Worauf Hitler reflektierte, war die unbestreitbare Tatsache, daß für viele Föderalisten (nicht nur in Österreich) die Distanzierung vom Ganzen wichtiger ist als der unerläßliche Beitrag der Teile für das Ganze. In den unlängst erschienenen Anekdoten um den Landeshauptmann Josef Krainer wird diesem folgendes Abschiedswort an einen in die Bundespolitik abgestellten steirischen Mandatar in den Mund gelegt: „Eigentlich bist jetzt kein Steirer mehr, und ich müßt' dich völlig abschreiben. Aber ich weiß, es muß halt sein, daß wer hinausgeht nach Wien.“ Se non e vero, e ben trovato. Wahr ist, daß erst unlängst der sozialistische Verkehrsminister Frühbauer, der keineswegs auf der Abschußliste der
Oppositionsparteien steht, ein unstillbares Heimweh nach Kärnten bekundete, und ebenso möchte der Unterrichtsminister Sinowatz einen Stellungswechsel vom Minoriten-platz ins heimatliche Burgenland vollziehen. Wie 1918 die Arbeiterräte es vielfach waren, die aktiv die Ausfuhr von Nahrungsmitteln aus den Ländern nach Wien verhinderten, wobei ihnen die Bauern Unterstützung liehen, ist auch heute die Sympathie für Wien zu Zeiten da und dort in den Bundesländern eher mäßig. Hier ist nicht Raum genug, die Ursprünge dieses Ressentiments gegen Wien in der weiter /.urück-liegenden Vergangenheit aufzuspüren. Gewiß ist, daß der Umsturz von 1918/19 alte Distanzierungen vergrößert hat. Wie die Sozialdemokratische Arbeiterpartei zum Schaden der res publica die junge Republik als „ihre“ Republik reklamieren wollte, hat sie auch Wien dadurch geschadet, daß sie die von ihr verwaltete Hauptstadt der Republik als „Rotes Wien“ zu einer Enklave im nicht-sozialistischen Österreich machte.
Daß Wien einmal zum Schlüsselpunkt der bleibenden Macht der Sozialdemokratie in Österreich werden sollte, haben deren Strategen in der Stunde des Sieges. 1918/19 zunächst gar nicht geahnt. Man muß die damaligen Folgen der „Arbeiter-Zeitung“ durchlesen, um zu erfahren, daß für diese Strategen der allgemeine Umsturz der Verhältnisse im Vordergrund ihres Interesses stand — und nicht die Last der Verwaltung der von Hunger und Verfall bedrohten Hauptstadt. So fiel- der Sozialdemokratie der fortan dominierende Einfluß auf die Wiener Stadtverwaltung wie ein „Nebenprodukt“
im Umsturz des Ganzen zu. Sie hatten anfänglich gar keine Kommunalpolitiker von Rang zur Hand und der spätere Gesundheitsstadtrat Professor Tandler sowie der Finanzstadtrat Breitner, beide spätere Leuchten des „Roten Wien“, waren nach Herkunft und Stellung alles eher als Sozialdemokraten. Was den Sozialdemokraten mit einem Schlag in die Hand fiel, das waren zahlreiche gutgeschulte Beamte, die überliefen, und fast 60 Prozent der Mitglieder des christlichsozialen Lehrervereins, die vom Fleck weg zu den Kadern Otto Glöckls stießen.
Als ein Vierteljahrhundert vorher die Christlichsozialen in Wien den Bürgermeisterstuhl eroberten, war das ganz anders gewesen. Noch in seinem politischen Testament vom Jahre 1907 hat Doktor Lueger seinen Parteifreunden aufgetragen, nicht die Staatspolitik, sondern die „klaglose Fortführung der Verwaltung der Reichshauptstadt“ immer als das Wichtigste anzusehen. Lueger wurde die Geheimratswürde und somit das sonst nur k. k. Ministern (unter Umständen) vorbehaltene Prädikat „Exzellenz“ verliehen; indessen hätte ihn nichts bewegen können, den Bürgermeisterstuhl mit einem Ministersessel zu vertauschen. In dem Maße, in dem die Lueger-Partei in die Rolle der ersten staatstragenden Partei in Österreich hineinwuchs und sie, sowie ihre Nachfolger, diese Funktion bis 1970 bekleideten, nahm die verbleibende Kraft und wohl auch das politische Verständnis für die ursprüngliche Funktion und die Kontrolle der Verhältnisse in der Hauptstadt Wien ab. Mommsen beschreibt in seiner römischen Geschichte, wie die im antiken Rom konzentrierte Kraftfülle immer mehr von den Aufgaben des Reiches absorbiert wurde und für die „Stadt“ selbst nur mehr wenige Potenzen zu deren ideeller und materieller Selbstbehauptung und Erneuerung übrig blieben.
Als die Christlichsozialen 1919 den Wiener Bürgermeisterposten verloren und sie, sowie ihre Nachfolger, fortan einer kompakten Mehrheit von Sozialdemokraten und Sozialisten gegenüberstanden, kam in den endlosen, kräfteraubenden, hinhaltenden Gofccfafen ge§en..,dic „rote . Ubermacht“ immer mehr die I Mentalität (a»if, es sei überhaupt nicht möglich, den Gegner aus dem Feld zu schlagen. Politische Kämpfe, Wie sie in anderen Großstädten stattfanden und stattfinden, bestärkten diese Mentalität. So wurde es (um einen sportlichen Vergleich zu gebrauchen) bei den christlichen Demokraten Brauch, ins Rathaus nur ihre 1-b-Mannschaft zu schicken, während in der Bundespolitik die 1-a-Mannschaft ihre Rolle spielte. Es ist bekannt, daß sowohl in der Ersten als auch in der Zweiten Republik nicht wenige prominente christliche Politiker es ausdrücklich ablehnten „ins Wiener Rathaus zu ziehen“.
Dieser Stand der Dinge kam gewissen Erwartungen in den Bundesländern entgegen. An wem hätten wilde Bergvölker ihre Aggressionen besser auslassen können als am „Roten Wien“? Nicht auszudenken, was man hätte anstellen müssen, wenn auf dem Bürgermeisterstuhl kein Repräsentant dieses „Roten Wien“ gesessen wäre. Langsam verschmolz die mäßige Sympathie für Wien mit der politischen Konfrontation zur politisch-weltanschaulich anders strukturierten Bundeshauptstadt zu einem Komplex. Und während einerseits die Ländervertreter längst am Sitz der Zentralstellen die Kontrolle über den „Zentralismus“ übernommen hatten, blieb anderseits dennoch die Kritik am „Wiener Zentralismus“ Stehsatz in Blättern, die nur noch der Ausländer als Provinzblätter ansprechen darf. 38 Jahre mußten nach, dem Tode des gebürtigen Wieners Ignaz Seipel vergehen, bis wieder ein gebürtiger Wiener, nämlich Bruno Kreisky, Bundeskanzler wurde.
Während Ende der fünfziger Jahre die Strategen der ÖVP noch für den Fall des Falles einen Rückzug vom Ballhausplatz in die Büros der Landeshauptleute zu planen begannen, sah die Linke Reichshälfte ihre Hoffnungsgebiete längst nicht mehr allein in Wien. Franz Kreuzer, vom Sessel des Chefredakteurs der „AZ“ an den „Schalthebel der Nachrichtenpolitik des reformierten Fernsehens“ übersiedelt, hat gegen Ende der Ära Klaus die Chancen, welche die Telekratie den Sozialisten eröffnet hat, erkannt: Durch den „renovierten, informationsbewußten Rundfunk“ sind die Sozialisten auf dem Lande an „potentielle sozialistische Wählerschichten herangekommen, an die die Parteipropaganda der sozialistischen Partei nicht herangekommen wäre“. Wenn man wolle, schließt Kreuzer wörtlich, könne man ruhig sagen, daß die ÖVP-Re-gierung durch die Rundfunkreform ein „Opfer am Altar des Vaterlandes“ gebracht habe.
Josef Klaus hat dieses Opfer in seinen 1971 erschienenen Erinnerungen insoferne bestätigt, als er den Sozialisten Kreuzer ausdrücklich seiner freundschaftlichen Verbundenheit versichert.
Am 21. Oktober 1973 wird in Wien .eüef Gemeinderatswahl- stattfinden. Die SPÖ zweigte eine ihrer „großen Hoffnungen“, Leopold Gratz, von der Bundespolitik ab und transferierte sie in die Landes- und Gemeindepolitik. Will sie damit jenen Föderalismus komplettieren, der unlängst in der SPÖ en vogue kam und der zuweilen an der Präpotenz des „Roten Wien“ Anstoß nahm — oder soll Gratz in Wien die „zweite Linie“ ausheben, an der ein Rückfall der
SPÖ nach Verlust der Alleinherrschaft im Bund zum Halten gebracht werden könnte? Von den hohen Funktionen, Ämtern und Mandaten, die die SPÖ binnen weniger Jahre an Gratz verliehen hat, blieb ihm zuletzt die Führung der sozialistischen Akademiker. Wie am Ende der liberalen Stadtherrschaft, soll der blanke Intellektuelle die dreimalige Auswechslung der Person des Bürgermeisters und die Vernachlässigung einer „klaglosen Verwaltung der Hauptstadt“ vergessen machen. Geschichte wiederholt sich nicht — aber sie ist Gegenwart.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!