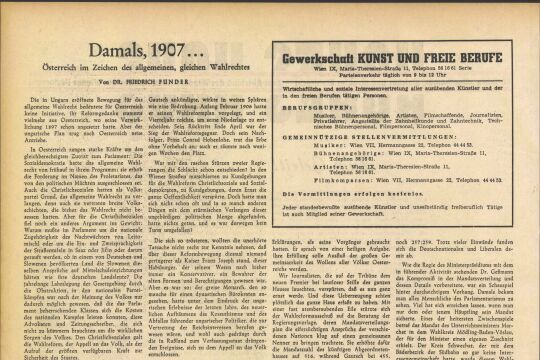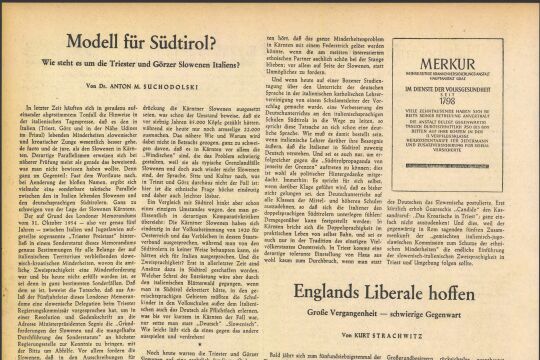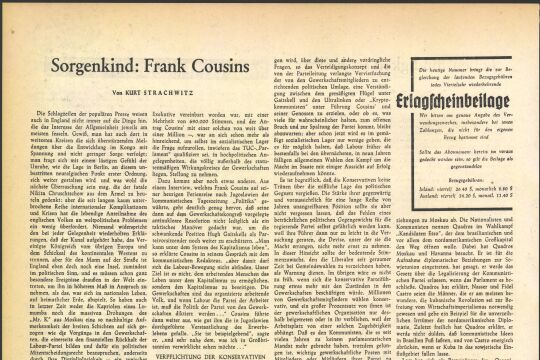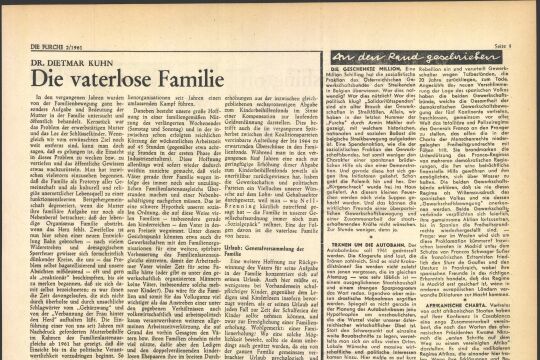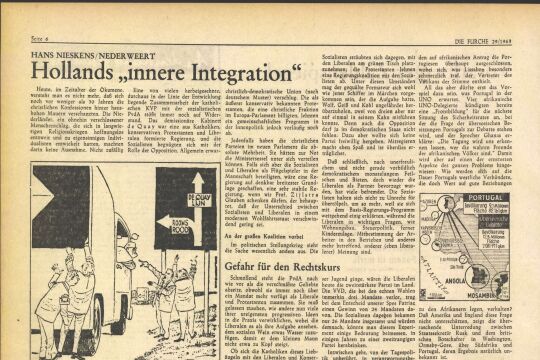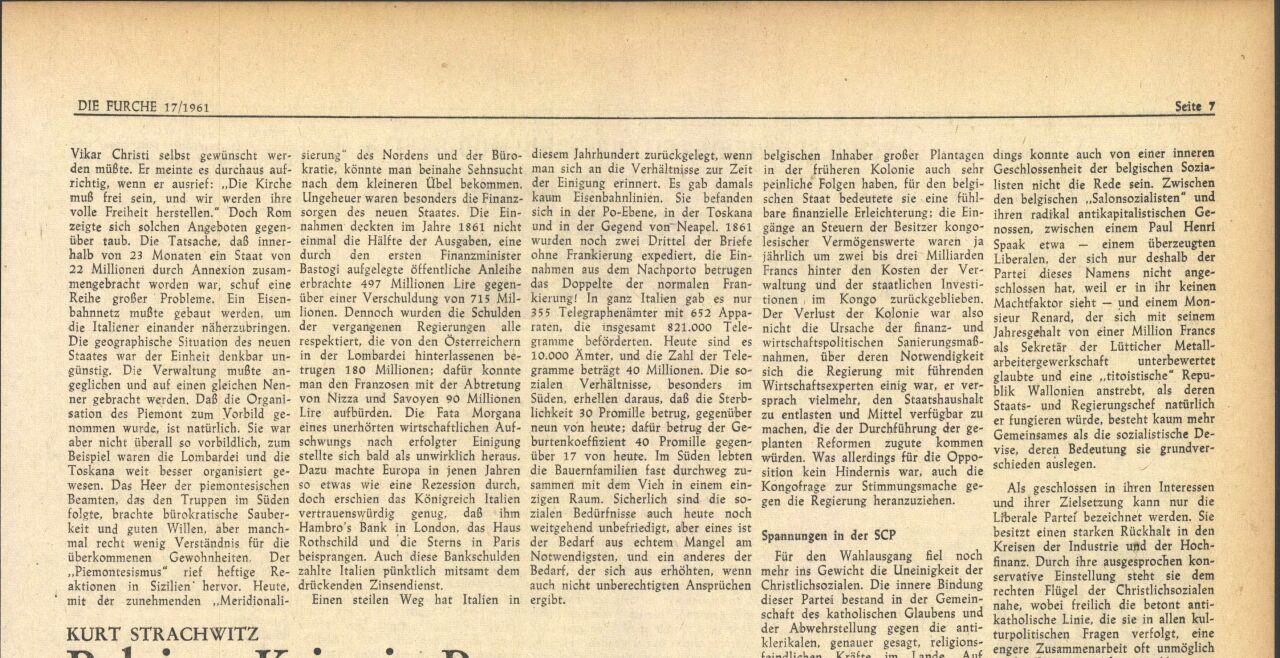
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Belgien: Krise in Permanenz
Hätte sich Premierminister Eyskens die schon längst erhobene Forderung der sozialistischen Opposition zu eigen gemacht und den König unmittelbar nach Beendigung des Streiks zur Auflösung des Parlaments bewogen, so wäre die christlichso.ziale- liberäle Regierungskoalition aller Wahrscheinlichkeit nach verstärkt aus den Neuwahlen hervorgegangen. Als die Wählerschaft fast drei Monate später, am 26. März, zur Urne gerufen wurde, hatte sich die Lage verändert. Der Streik, der Belgien an den Rand des Bürgerkrieges gebracht und der belgischen Wirtschaft einen viele Milliarden betragenden Schaden zugefügt hatte, gehörte bereits der Geschichte an. Gewiß wurde die Stimmenabgabe mancher durch die Erinnerung an jene turbulenten Wochen beeinflußt, aber entscheidend für die Verschiebung im parlamentarischen Kräfteverhältnis waren andere Momente. Der Besitz des Kongo war dem belgischen Volk nie recht ans Herz gewachsen, und seine Preisgabe daher zunächst auch nicht ein Schritt, der in den breiten Massen eine der Regierung ungünstige Reaktion hervorgerufen hätte. Aber was sich dann in der unabhängig gewordenen, ehemaligen Kolonie ereignete, die dort an Belgiern verübten Greuel, die Berichte der als arme Flüchtlinge in ihre Heimat zurückgekehrten Landsleute, die scharfen Zensuren, die Bel gien wegen seiner Kolonialpolitik von allen Seiten über sich ergehen lassen mußte und seine fast vollständige Isolierung im Kreis der Vereinten Nationen, das alles hat dazu beigetragen, dem an sich schon reichlich unpopulären Spar- und Reformprogramm der Regierung Eyskens noch mehr Gegner zu verschaffen. Tatsächlich bestand zwischen diesem Programm und dem in einer plötzlichen Panikstimmung erfolgten Abzug aus dem Kongo — ausgelöst vielleicht durch das blutige Drama in Algerien — kein innerer Zusammenhang. Mochte die Proklamierung der kongolesischen Eigenstaatlichkeit für die Aktionäre der Sociėtė Miniere du Haut Katanga und für die belgischen Inhaber großer Plantagen in der früheren Kolonie auch sehr peinliche Folgen haben, für den belgischen Staat bedeutete sie eine fühlbare finanzielle Erleichterung; die Eingänge an Steuern der Besitzer kongolesischer Vermögenswerte waren ja jährlich um zwei bis drei Milliarden Francs hinter den Kosten der Verwaltung und der staatlichen Investitionen im Kongo zurückgeblieben. Der Verlust der Kolonie war also nicht die Ursache der finanz- und wirtschaftspolitischen Sanierungsmaßnahmen, über deren Notwendigkeit sich die Regierung mit führenden Wirtschaftsexperten einig war, er versprach vielmehr, den Staatshaushalt zu entlasten und Mittel verfügbar zu machen, die der Durchführung der geplanten Reformen zugute kommen würden. Was allerdings für die Opposition kein Hindernis war, auch die Kongofrage zur Stimmungsmache gegen die Regierung heranzuziehen.
Spannungen in der SCP
Für den Wahlausgang fiel noch mehr ins Gewicht die Uneinigkeit der Christlichsozialen. Die innere Bindung dieser Partei bestand in der Gemeinschaft des katholischen Glaubens und der Abwehrstellung gegen die antiklerikalen, genauer gesagt, religionsfeindlichen Kräfte im Lande. Auf wirtschafts- und sozialpolitischem Gebiet hingegen standen die christlichen Gewerkschaften — mit einer Million Mitgliedern zahlenmäßig ungefähr gleich stark wie die sozialistischen, wenn auch ziemlich bedeutungslos im Bergbau und in der Schwerindustrie — dem rechten Flügel der Sozialisten um vieles näher, als den stockkonservativen Kreisen der eigenen Partei. Dazu kam, daß der von linkssozialistischen Gewerkschaftsführern inszenierte Streik, an dem sich christliche Gewerkschafter nur in sehr geringem Maß und nur unter Druck beteiligt hatten, von manchem Christlichsozialen zum Anlaß genommen wurde, um die Gewerkschaftsbewegung als Ganzes zu verurteilen; was natürlich nicht dazu beigetragen hat, die Spannungen innerhalb der Partei zu mildern. Aller dings konnte auch von einer inneren Geschlossenheit der belgischen Sozialisten nicht die Rede sein. Zwischen den belgischen „Salonsozialisten“ und ihren radikal antikapitalistischen Genossen, zwischen einem Paul Henri Spaak etwa - einem überzeugten Liberalen, der sich nur deshalb der Partei dieses Namens nicht angeschlossen hat, weil er in ihr keinen Machtfaktor sieht — und einem Monsieur Renard, der sich mit seinem Jahresgehalt von einer Million Francs als Sekretär der Lütticher Metallarbeitergewerkschaft unterbewertet glaubte und eine „titoistische“ Republik Wallonien anstrebt, als deren Staats- und Regierungschef natürlich er fungieren würde, besteht kaum mehr Gemeinsames als die sozialistische Devise, deren Bedeutung sie grundverschieden auslegen.
Als geschlossen in ihren Interessen und ihrer Zielsetzung kann nur die Liberale Partei bezeichnet werden. Sie besitzt einen starken Rückhalt in den Kreisen der Industrie und der Hochfinanz. Durch ihre ausgesprochen konservative Einstellung steht sie dem rechten Flügel der Christlichsozialen nahe, wobei freilich die betont antikatholische Linie, die sie in allen kulturpolitischen Fragen verfolgt, eine engere Zusammenarbeit oft unmöglich macht. So war vor dem 26. März von einigen- christlichsozialen Führern, die dem Premierminister Eyskens ungenügende Festigkeit gegenüber der sozialistischen Streikbewegung zum Vorwurf machten, die Parole ausgegeben worden, beim Wahlgang nicht die Kandidaten der eigenen Partei, sondern nur „verläßliche“ Konservative, das sollte heißen die Kandidaten des liberalen Koalitionspartners, zu unterstützen. Der Erfolg dieser Weisung war gering. Von den 63.000 Stimmen, die die Liberalen zusätzlich gewannen — eines ihrer bisher innegehabten 21 Mandate ging trotzdem verloren —, mag wohl ein Teil aus dem christlichsozialen Lager gekommen sein; überwiegend bei dem Verlust von 283.000 Stimmen, den die Partei Dr. Eyskens' zu verzeichnen hatte, war aber offenbar der Umstand, daß viele christlichsoziale „Malkontenten“, sofern sie ihr Votum nicht für die Flämische Volksunion oder die Unabhängigen oder die Splittergruppe der sogenannten Nationalen Sammlungsbewegung abgaben, lieber einen ungültigen Stimmzettel in die Urne warfen, als den Liberalen Schützenhilfe zu leisten. Die Sozialisten anderseits hatten keine Ursache, sich einem Gefühl ungetrübter Freude darüber hinzugeben, daß die Christlichsoziale Partei mit einer Einbuße von acht ihrer bisherigen 104 Sitze im Abgeordnetenhaus als einzige geschwächt aus dem Wahlkampf hervorgegangen war. Der sozialistische Stimmenzuwachs war minimal, wogegen die Kommunisten ihren Anhang um mehr als 60 Prozent vermehrt hatten und jetzt mit fünf, statt wie früher mit zwei Abgeordneten in die Kammer einzogen.
Rein zahlenmäßig hätte die christlichsozial-liberale Koalition trotz dr erlittenen Mandatsverluste weiter an der Macht bleiben können. Mit 114 von insgesamt 21-2 Sitzen in der Kammer hätte sie, die Aufrechterhaltung der Parteidisziplin vorausgesetzt, noch immer über eine hinreichende Mehrheit verfügt. Aber, wie sich schon während der Wahlkampagne gezeigt hatte, war diese Voraussetzung bei der SCP nicht mit Sicherheit gegeben; mit ein Grund für den christlichsozialen
Parteivorsitzenden, Theo Lėfėvre, gegen Professor Eyskens, der zwar ein hervorragender Nationalökonom ist, aber wenig politisches Fingerspitzengefühl besitzt, Stellung zu nehmen und sich für eine Koalition mit den Sozialisten an Stelle der Liberalen einzusetzen. Ausschlaggebend für Lefevre und schließlich auch für den anfangs uneinigen und zögernden Parteivorstand war die Erwägung, daß es vorzuziehen sei, die Sozialisten, die erfahrungsgemäß keine Bedenken trugen, auf die Straße zu gehen, um der Mehrheit gegebenenfalls mit Gewalt ihren Willen aufzuzwingen, als Mitträger staatlicher Verantwortung in der Regierung zu haben, statt inner- und außerhalb des Parlaments einen Kampf ohne Ende mit ihnen austragen zu müssen.
Damit ist freilich nicht gesagt, wie die schwerwiegenden und zum Teil auch ideologisch bedingten Differenzen überwunden werden sollen, die sich innerhalb eines christlichsozial-sozia- listischen Koalitionskabinetts einstel len müssen. Das Spar- und Reformprogramm, über das die Regierung Eyskens letzten Endes zu Fall gekommen ist, wird, wenn auch mit gewissen Abänderungen oder Milderungen, von jeder, wie immer zusammengesetzten Regierung durchgeführt werden müssen, soll die belgische Wirtschaft auf eine gesunde Basis gestellt und unter den durch die EWG gestalteten Bedingungen konkurrenzfähig gemacht werden. Das bedeutet, daß, vor allem auf sozialpolitischem Gebiet, einige Tabus beseitigt werden müssen. Dazu kommen regionale, die Parteigrenzen vielfach überschneidende Spannungen; namentlich gegeben einerseits durch Unzufriedenheit in den wirtschaftlich rückläufigen Gebieten Walloniens, und anderseits durch die Abneigung der wirtschaftlich aufsteigenden Flamen, auf Kosten ihres weiteren Fortschritts zur Stützung der Wallonen beizutragen. So ergibt sich kein Bild, aus dem auf die baldige Überwindung der latenten Krise Belgiens zu schließen wäre.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!