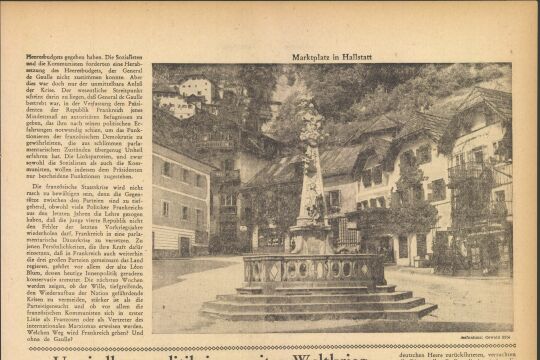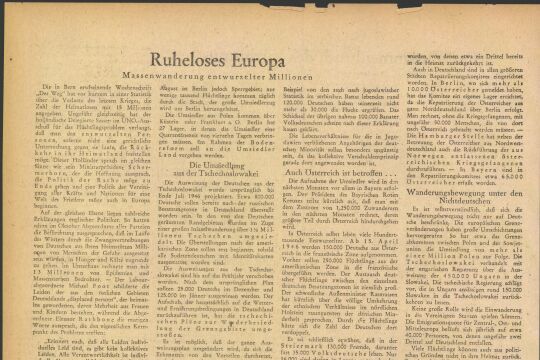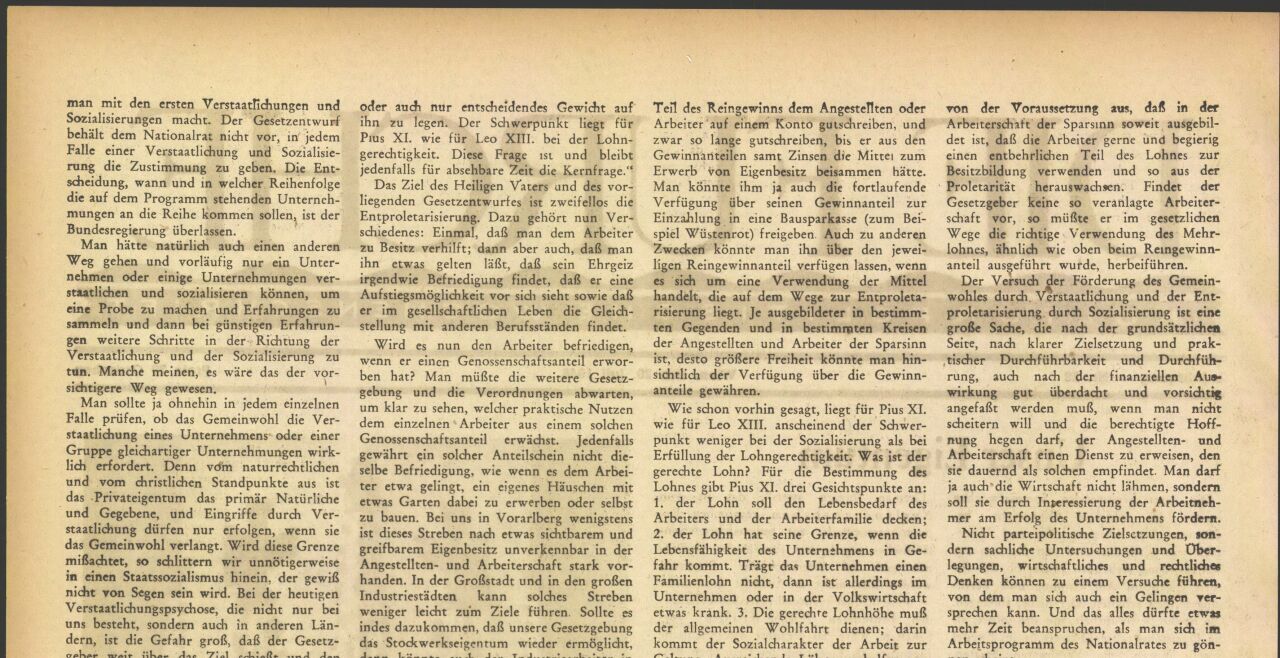
Auf dem Zentralfriedhof in Wien wurde in der vorigen Woche in Anwesenheit hoher staatlicher und diplomatischer Funktionäre ein Denkmal enthüllt, das die Namen von 63 Tschechen verewigen soll, die in Wien während der Hitler-Herrschaft getötet wurden. Dies ist nach der russischen Siegessäule das zweite Ehrenmal — abgesehen von vielen Straßen und Plätzen, die die Namen berühmter Heerführer und Staatsmänner des zweiten Weltkrieges festhalten —, mit dem auf Wiener Boden die ehrfürchtige Erinnerung an große Taten und heroische Opfer dieser Zeit festgehalten wird. Bescheiden, allzu bescheiden wie wir sind, ist bisher noch nichts in Wien öffentlich unternommen worden, um der bodenständigen Leistung, etwa der ehrenreichen österreichischen Widerstandsbewegung und dem Andenken an ihre Blutopfer ein bleibendes Gedenken zu weihen. Nicht einmal ein Denkmalkomitee, das für die Zukunft vorsorgt, ist in unserer komiteegesegneten Zeit schon gebildet worden.
Als vor einigen Wochen junge Kämpfer der Widerstandsbewegung darangingen, zur Ehrung eines toten Kameraden eine bescheidene Gedenktafel an jenem Haus anzubringen, in dem er einer tückischen Kugel zum Opfer fiel, da konnte das nur in aller Heimlichkeit und ohne Aufsehen geschehen. Schon die Herstellung der Tafel war schwierig, aufgemacht mußte sie in der Nacht werden, um nicht den Anschein einer Kundgebung zu erwecken. In den frühen Morgenstunden — es war an einem Sonntag — versammelten sich die nächsten Freunde und Verwandten des Toten in kleinen Gruopen beim Haustor, der kurze Nachruf für den Gefallenen wurde im düsteren, lichtlosen Hausflur gehalten, da für eine Feier auf der Straße keine Genehmigung erreicht werden konnte. Vorübergehende wunderten sich, was das woM für eine geheimnisvolle verbotene Versammlung sei. Keine Hymne erklang, als mit einer schnellen Bewegung, um kein Aufsehen zu erregen, das schwarze Tuch von der Bronzeplakette weggezogen wurde, die in kurzen Worten aussprach: „Hier starb für Österreich ...“ Dann zerstreuten sich die wenigen, die gekommen waren. Vielleicht ist die Tafel schon wieder entfernt worden, vielleicht 'hängt sie noch dort, von wenigen nur gekannt, von dem Passanten, der sie mit zufälligem Blick streift, sicher mißverstanden.
Das war bisher alles. Kein erzerner Adler überschattet noch mit seinen Schwingen die Namen der Toten, die für die Freiheit Österreichs starben, und an keiner Ausfallstraße der Großstadt kündigt ein Stein das „Die hospes Spartae ...“
Von den vielen schlechten Einfällen, mit denen Berlin seine Verwaltung in Österreich zu würzen pflegte, war der, den tausendjährigen Namen unseres Landes verschwinden zu machen, bekanntlich der ärgste. Er ist der gebührenden Lächerlichkeit verfallen. Spötter schrieben deshalb auf Briefe nach der Hauptstadt Bayerns: „München in Ober-Oberdonau“ und bei Briefen nach Württemberg „Oberst-Ober-dohau“. Jemanden als „Oberdonauer“ anzusprechen, konnte man nur im Vertrauen auf die bekannte Gutmütigkeit des Ober-österrcicliers wagen Daß die Spuren dieser nazistischen Umtaufe trotzdem noch nicht völlig verschwunden sind, ist ein Kuriosum. Erst recht, da dies gerade bei dem Namen eines Landes zutrifft, das wie Oberösterreich immer mit Recht auf seine Eigenart stolz war und in seinem Namen den Ausdruck bodenständiger Kraft und wurzelhaftcr Echtheit seines Volkstums sah. Das Kuriosum fahrt weitum spazieren: Alle in Oberösterreich beheimateten Kraftwagen tragen auf ihren Nummerntafeln — auch auf den funkelnagelneuen — noch immer das ominöse Zeichen: OD. Also Namensfälschung ganz sowie vordem. Gibt es fünfzehn Monate nach der Befreiung noch nicht soviel Farbe, um eine Bezeichnung auszulöschen, die sich die Oberösterreicher nicht gefallen zu lassen brauchen?
Konrad Heiden erzählt in seinem Buch „Adcjii Hitler“, wie es den; Nationalsozialisten bei der Reichstagswahl vom 5. März 1933 trotz der äußeren demokratischen Form der Wahl möglich war, für ihre Partei eine absolute Mehrheit zu erzielen. Hilfe dazu bot die bestehende Einrichtung der sogenannten Wahlkarten: wer am Wahltag nicht in der Gemeinde seines Wohnsitzes weilte, konnte sich eine Wahlkarte ausstellen lassen und mit dieser dann wählen, wo er wollte. Diese demokratische Einrichtung, geschaffen, um keine Stimme verlorengehen zu lassen, wurde von der nationalsozialistischen Partei zu einem Wahlschwindel großen Stils ausgenützt. Dutzende von Wahlkarten wurden an viele Tausende von verläßlichen Parteimitgliedern durch ebenso verläßlich NS-Bürger-meister ausgefolgt und mit diesen gingen dann diese so oft Zur Urne, als sie Wahlkarten besaßen.
Tempora mutantur! Ferdinand P e-r'o'utka, der bekannteste lebende tschechische Publizist, Mitglied der Volkssoziali-sten, der „Benesch-Partei“, gibt in Nummer 12 seiner Wochenzeitschrift „Dnesek“ („Heute“) eine kurze Schilderung, wie es unter anderem zu dem großen Wahlsieg der Kommunisten in den ehemals sudetendeutschen Gebieten bei den letzten Parlamentswahlen der Tschechoslowakei kam. Die ehemals den Deutschen gehörenden, jetzt beschlagnahmten Güter und sonstigen Besitzungen wurden durch das Landwirtschaftsministerium an Tschechen verteilt. An der Spitze des Ministeriums stand ein kommunistischer Minister. Verständlich, daß Voraussetzung für Erhalt eines Grundbesitzes der Nachweis der Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei war und ebenso begreiflich, daß die Beteilten jener Partei ihre Stimme gaben, der sie den neuen Besitz verdankten. Eine scheinbar geringe, aber doch wirksame Beeinflussung der Wahl.
Anders dagegen liegen die Verhältnisse in Polen. Nach der erfolgten Abstimmung, die eine überwältigende Mehrheit für die Regierung und eine Niederlage der Bauernpartei brachte, erklärte deren Führer Miko-lajczik, der langjährige polnische Ministerpräsident der Emigration, das Wahlergebnis sei eine glatte Fälschung. Die abgegebenen Stimmen seien einfach falsch gezählt worden, Kontrollorgane seiner Partei, die bei der Zählung dabei waren, haben dies nicht verhindern können. Bei einer gerechten Wahl hätte er 85 Prozent erhalten müssen. Eine Ansicht, die von verschiedenen Beurteilern als berechtigt erklärt wurde. So berichtete das Wiener sozialistische Organ noch vor der Wahl, daß Miko-lajczik nach objektiver Kenntnis der Lage 60 Prozent und die Sozialisten 20 Prozent, die Kommunisten dagegen nur acht Prozent erhalten dürften. Nicht nur die falsch Zählung der Stimmzettel sind an dem Wahlergebnis schuld: Minister Bevin wurde im Unterhaus gefragt, ob er wisse, daß die Wahlen in Polen unter dem Zeichen des Terrors von Seiten der herrschenden Partei stünden, der sich in Verhaftungen, Auflösungen von Organisationen und sogar Morden äußere? Der Hirtenbrief der polnischen Bischöfe spricht sogar von politischen Morden, die von der — Staatspolizei ausgeführt werden, um das Land in eine bestimmte Richtung hineinzustoßen.
Gegenüber solchen Praktiken mutet die Mitteilung, die Justizminister Dr. Gero bei der letzten Pressekonferenz machte: daß in Österreich ungefähr 3000 Prozesse gegen Wahlschwindler stattfinden, die aber von keiner Partei inszeniert, nur zu Lasten der Schwindler und bald zugunsten der einen oder anderen der drei Parteien ausgeübt wurden, als ein rechtes österreichisches Idyll an.
Der vor einiger Zeit in dem polnischen Ort Kielce stattgefundene Massenmord an Juden ist ein Merkzeichen dafür, welches traurige Erbe aus den letzten Jahren noch unter den Völkern lebendig ist. Nicht nur aus Polen werden Ausschreitungen gegen Juden gemeldet, auch aus der Slowakei und da und dort auch aus Böhmen. Allerdings haben sie in diesen Ländern eine besondere Wurzel.
Die Volkszugehörigkeit in der alten tschechischen Republik wurde nach der Muttersprache bestimmt. Wer deutsch angab, galt als Deutscher. Es ist bekannt, daß die Juden in den historischen Ländern der alten Monarchie fast ausschließlich sich der deutschen Sprache bedienten und al Deutsche gezählt wurden, während in der Slowakei die Juden durch ihr Bekenntnis zur ungarischen Muttersprache als Magyaren angesehen wurden. Die Volkszählung von 1930 gilt heute als Nachweis, welche Volkszugehörigkeit der einzelne in der Vergangenheit besaß. Danach wird vielfach festgelegt, unter welche Kategorie der Staatsbewohner fällt, ob er als Tscheche und Slowake zur Staatsnation gehört oder als Deutscher und Magyare zu jenen, die unter eine Sonderbehandlung geraten. Und daraus ergeben sich heute für die Betroffenen tragische Vermengungen: Juden, die unter den Nationalsozialisten in die KZ gewandert waren und alles verloren hatten, Mischlinge, die sieben Jahre ein Leben der Verachtung und Gefährdung gelebt, weil sie trotz der angegebenen Muttersprache nicht als Deutsche oder Ungarn galten, wurden wieder in neue Lager gesteckt, oder verfielen mindestens der Gefahr, ausgewiesen zu werden, nur deshalb, weil sie im Jahre 1930 deutsch oder ungarisch als Muttersprache angegeben haben und sie deshalb jetzt als Deutsche oder Ungarn galten. Der Nationalismus hat viel Unglück über die Menschheit gebracht. Hier ist er bis zum Widersinn gediehen.
Für die Banater Schwaben, die im Herbst 1944, als die deutsche Rumänienfront zusammenbrach, mit den deutschen Truppen gegen Westen zogen und vom Ende des Krieges zumeist in Süddeutschland und Österreich erreicht wurden, trat gegen Ende des Vorjahres eine neue Phase auf ihrer Flucht ein. Unter der Leitung des Senators Dr. Reitter war in Rastatt am Rhein eine Umsiedlungskommission gebildet worden,deren Aufgabe es war, die Schwaben für ein Umsiedlung nach Frankreidi vorzubereiten. Die Vorfahren eines kleineren Teiles von ihnen stammte ja aus dem französischen Elsaß. Alle zuständigen französischen Stellen waren für das Projekt gewonnen worden, die — unter der Voraussetzung, daß die große Masse der Schwaben damit einverstanden sei — den Siedlern einen Raum südlich Orleani zuwiesen. Bauern und Handwerker sollten Haus, Felder und Gärten als Eigentum erhalten und auch die Intelligenz bei ihren Landsleuten verbleiben. Die Banater Kriegsgefangenen, die im Rahmen der deutschen Armeen gekämpft hatten, wurden zur Freilassung vorgesehen. Jedwede Domizilsänderungen von Schwaben in Mitteleuropa oder Rumänien sollten unterbleiben, da es sich um zukünftige französische Staatsbürger handelte. Welche Kräfte da gewirkt haben, daß ein großer Teil der noch im Banat Wohnenden eine Umsiedlung nach Frankreich ablehnte und dann zu Beginn dieses Jahres die Verhandlungen mit der französir sehen Regierung zum Scheitern kamen, ist noch nicht völlig aufgeklärt.
Vor kurzem ist man von Seiten der Schwaben an die Regierungen von Kanada, Argentinien, Brasilien und Chile mit Vorschlägen zur Einwanderung in diese Länder herangetreten, die kolonisatorische Eignung, Erfahrung und Lehtung der Schwaben werden dabei ins Treffen geführt. Bisher hat lediglich der brasilianische Botschafter in London einen günstigen Vorbescheid erteilt. Vielleicht wird eines Tages wirklich ein neuer Schwabenzug sich in Bewegung setzen, nur diesmal nicht von West nach Ost, wie einst, als sie an die Grenzen des Balkans wanderten, sondern von Ost nach West, über das weite Meer.