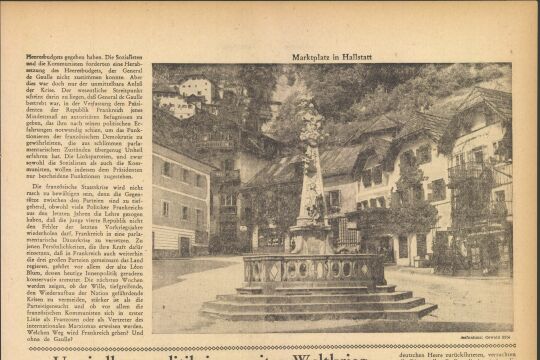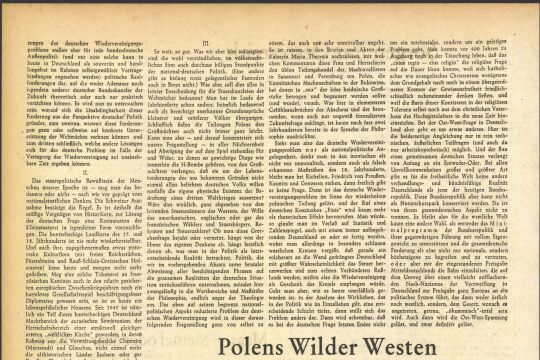In endloser Weite dehnt sich die süd-bessarabisdie Steppe, vom tiefblauen Himmel überspannt, der sich über die fruditbare Ebene mit ihren sanft ineinander übergehenden Hügelketten wölbt. Im Osten und Westen von Dnjestr und Pruth begrenzt, fällt“ die ehemals rumänische Provinz nach dem Süden mit einer oft bizarr geformten Steilküste zum Schwarzen Meer ab. Hier in der Nähe bunt belebter Badeorte gedeihen in südlicher Fülle die berühmten Weine von Schabo und Raskajetz am Liman von Akker-man. Gegen den Norden zu besitzt das Land keine natürliche Grenze, sondern schließt an die ehemals österreichische Bukowina an. Hier verliert sich der ausgesprochene Steppencharakter, die Landschaft wird durch höhere Erhebungen und den Wechsel zwischen Wald und Feld belebt.
In dieses und die angrenzenden Schwarz-meergebiete der fruchtbaren Schwarzerde, dem „Lande der guten Erde und des schlechten Himmels“, weil auftretende Trockenperioden in manchen Jahren schlimme Mißernten verursachen können, wanderten, von Katharina der Großen und Alexander I. in das Land gerufen, deutsche Siedler aus Württemberg, Bayern, Baden, dann auch aus Polen und Ungarn (Schwaben, Pfälzer) sowie der Schweiz ein und gründeten ab 1814 die ersten Mutterkolonien, darunter die frühesten und bekanntesten, Borodino und Tarutino. Diese und andere Dorfnamen, wie etwa Beresina, Kulm, Paris, bergen die Erinnerung an den russischen Feldzug Napoleons.
Nicht um Bevölkerungspolitik nach 'Quantitätsgrundsätzen ging es, nur tüchtige Landwirte, Weinbauern und Handwerker wurden von den russischen Werbern angenommen und in das Land gebracht, denn diese Schwarzmeerzonen sollten in erster Linie russische Bauern aufnehmen. Der in das Land gerufene deutsche Siedler war ausersehen, ihm bei Aufbau und Nutzung desselben als Vorbild zu dienen. Etwa 8000 Kolonisten wandern so zu Beginn dieser ersten Siedlungsperiode in das Land und erhalten rund 142.000 Desjatinen Bodenfläche (= 143.000 Hektar) zugeteilt. Trotz der gewährten Privilegien, wie Befreiung vom Militärdienst, Steuerfreiheit 10 bis 30 Jahre, der zugesicherten eigenen Sdiul- und Kirchenverwaltung und trotz der großzügigen Landausstattung einer Familie mit einer 60 Hektar großen „Wirtschaft“, war es ein hartes, mühseliges Brot, das diese ersten Kolonisten im ungewohnten Klima, ohne Hilfsmittel an Geräten, auf ungerodetem Steppengrasland aßen. Aber sie überwanden alle Not und auftretenden Krankheiten und wandelten mit zäher Arbeit und Gemein-schaftshilfe die ihnen zugewiesenen Gebiete in eine blühende, ertragreiche Landschaft um. Feste, saubere Dörfer mit den Bauformen ihrer Stammheimat wuchsen aus dem Boden, die Seelenzahl stieg rasch infolge der hohen Geburtenzahl, die 1859 auf 1000 Einwohner 65,3 Geburten nennt (allerdings bis 1938 auf 26,5 fällt), so daß bis zum Abschluß der ersten Siedlungsperiode, die mit 1842 angenommen wird, 24 Mutterkolonien entstanden sind.
In der zweiten Siedlungsperiode, die sich bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges erstreckt, erfolgt die Gründung zahlreicher Tochtergemeinden, meist durch Ankauf und Parzellierung des Latifündienbesitzes russischer Adeliger, so daß eine Übersicht aus dem Jahre 1938
24 Mutterkolonien mit 44.900 Einwohnern 118 Tochterlolonien mit 38.100 Einwohnern 142 deutsche Dörfer mit 83.000 Einwohnern angibt. Von Arbeit und Schweiß, von Erfolgen und Rückschlägen, aber immer alles Negative zäh überwindend, künden diese Zahlen.
Die als dritte Siedlungsperiode bezeichnete Phase nach dem Weltkriege — Bessara-bien ist inzwischen durch die Pariser Friedensverträge an Rumänien gefallen —, wo Landlose aus der rumänischen Agrarreform sechs Hektar zugewiesen erhalten, kenn-zeidinet mit der Bildung der sogenannten „Hektargemeinden“ keine erfreuliche Entwicklung. Hier tritt in der sonst durchgehend fest und wohlhabend gefügten bäuerlichen Struktur erstmalig die Bildung eines landwirtschaftlichen Proletariats auf, das infolge der unter den dortigen klimatischen und extensiven Verhältnissen unzureichenden Landausstattung nur kümmerlich fristet. Verstärkt wird dieser Zustand außerdem noch durch den Eintritt verschlechterter wirtschaftlicher Bedingungen seit der Eingliederung in das rumänische Königreich. Das wertvolle Absatzgebiet mit der Zentrale Odessa ist weggefallen und die bessarabische Produktion begegnet mit steigenden Absatzschwierigkeiten der Überproduktion des Regats. Aber zu Beginn des zweiten Weltkrieges sind immerhin rund 400.000 Hektar im Besitze der bessarabien-deutschen Kolonisten, im Kreise Akkerman zum Beispiel haben sie 40 Prozent des Ackerlandes.
Neben der Landwirtschaft als Fundament entwickelte sich ein bodenständiges, gutes Handwerk. Es steht in engster Beziehung zu den agrarischen Erfordernissen und rekrutiert sich vorwiegend aus Schmieden, Wagnern, Tischlern, Sattlern usw. Gewisse Spezial-erzeugnisse, wie die der Leiter- und Gabel-madier von Paris und Teplitz gingen auch über den Bereich des engeren Siedlungsgebietes hinaus, ebenso wie sich in den letzten Jahrzehnten unter den gleichen Gesichtspunkten eine ländlich orientierte Industrie im Mühlengewerbe, der Erzeugung landwirtschaftlidier Maschinen, aus ursprünglichen Färbereien entstandener Tuchfabriken erhob und erfreuliche Entwicklungstendenzen zeigte. Dem Handel kam nur eine mäßige Bedeutung zu.
In den Jntelligenzberufen traten vornehmlich Lehrer, Pfarrer, Rechtsanwälte und Ärzte in den Vordergrund, denn die Bessara-biendeutschen besaßen als Kernpunkte einer beachtlichen, meist viel zu wenig gewürdigten kulturellen Entwicklung seit 1844 die Werner-Schule in Sarata, wo Lehrer ausgebildet wurden und seit 1908 ein deutsches Knabengymnasium in Tarutino. Das akademische Studium gravitierte vor 1914, also in der russischen Zeit, nach Dorpat, nach dem ersten Weltkriege zu den rumänischen Hochschulen. Es ist jedoch ein bezeichnendes Merkmal des bessarabischen Lebenskreises, daß sich sowohl Handwerker als auch geistige Berufe niemals ganz aus ihrer bäuerlichen Herkunft losrissen und diese in ihren Lebensgewohnheiten niemals zu verleugnen versuchten. In allen diesen Menschen war das Bauernblut viel zu lebendig. Das kam nicht nur erscheinungsmäßig in ihren Typen zum Ausdruck, sondern sie suchten auch in dem von ihnen eingeschlagenen Wirkungsbereich immer die engste Bindung mit dem Lande zu bewahren, was seinen Niederschlag in dem Drange nach Landbesitz und Hofplätzen fand.
Aufrecht und tüchtig, sparsam und von einfachen Lebensgewohnheiten, verläßlich in der menschlichen Haltung, mit ausgeprägtem Familiensinn und religiöser Denkungsart ausgestattet, so lebte diese blühende Volksgruppe des Südostens als bedeutender kultureller und wirtschaftlicher Faktor des Mutterlandes.
Der zweite Weltkrieg beginnt. Nach Abschluß des Polenfeldzuges verkündet Adolf Hitler das Umsiedlungsprogramm und am 5. September 1940 wird dementsprechend der Umsiedlungsvertrag mit der Sowjetunion für diese Volksgruppe unterzeichnet. Ein durch 125 Jahre beharrlicher Arbeit entstandenes, in Prüfung und Erfolg gehärtetes Zentrum südöstlicher Kolonisation und Kultur verläßt geschlossen seine blühenden Dörfer und löst sich in endlose Treckkolonnen auf, die nach Reni und Galatz geleitet werden und dann nach kurzer Donauschifffahrt von Prahovo oder Semlin mit der Bahn die Reise in die Umsiedlungslager von Mittel- und Süddeutschland, nach Schlesien oder das Sudetenland, beziehungsweise auch gleich weiter in die damals eingegliederten Ostgebiete des Warthelandes und Westpreußen antreten.
Und hier beginnt der Leidensweg dieser prächtigen Volksgruppe bis zum bitteren Ende der chaotischen Auflösung bei Kriegs-schiuß. Der Bessarabier wird zu dem heimatlosen Mensch, der in die Zahnräder eines jede Individualität unerbittlich zermahlenden Organisationsapparates für Menschentransporte gerät und mit einer Nummer ausgestattet, künftighin unter die Bezeichnung „Volksdeutscher Umsiedler“ fällt. Diese während des Krieges durch das Hitler-Regime eingeleitete Umsiedlung ist der Beginn einer Völkerwanderung, deren katastrophaler Umfang und Ablauf in allen Konsequenzen und mit aller Deutlichkeit eigentlich erst zum Kriegsende begreifbar wird.
Viele wußten wohl, daß sich solche Aktionen vollziehen, aber den meisten in Mitteleuropa war es in oft erstaunlichem Maße überhaupt neu, daß in diesen oder jenen fernen Gegenden Menschen deutscher Sprachzi'gehörigkeit in geschlossenen Siedlungsgebieten gelebt hatten. Wenn noch eine gewisse Eigentümlichkeit des Dialektes oder eine aus dem landesüblichen Rahmen fallende Tracht vorlag — wie etwa die Wolhynier, die mit ihren schweren, rohen Fellmänteln nnd Pelzmützen etwas hilflos in die ihnen versprochene neue Heimat kamen —, dann passierte es oft, daß diese Menschen selbst bei den für sie eingesetzten offiziellen deutschen Stellen entweder auf Ablehnung und Geringschätzung stießen oder in Verkennung des volkskundlichen Sachverhaltes mit der sonstigen Bevölkerung des Herkunftslandes verwechselt wurden. Man sprach gedankenlos von den „Rumänern“, „Polacken“, „Jugo-lawiern“ usw., was in keinem Falle zutraf.
Ein weiterer Faktor zur Verbitterung dieser Menschen war, daß sie die ihnen bei der Aussiedlung in glühenden Farben angepriesene neue Heimat zunächst oft durch viel unerträgliche Monate, vielfach aber auch über Jahresfrist aus der Perspektive des Lagerlebens und hier insbesondere des gefürchteten bis verhaßten nazistischen Lagerführers kennenlernen mußten. Die negative Auslese, die von den verantwortlichen Stellen gerade hier mit leider nur verschwindend wenigen Ausnahmen getrieben wurde, war erschreckend und legte neue Enttäuschung auf diese Menschen.
Was von dem Glauben an alle Versprechungen, die von den Aussiedlungskomman-den im Herkunftslande bei den meist im Rekordtempo und mit übermäßigem Aufwand an Fähnchen und eitlen Propagandareden durchgeführten Aktionen übrigblieb, das wurde dann durch den Ablauf der An-siedlung zerstört. Fassungslos und mit dem inneren, unausgesprochenen Abscheu eines Menschen im Herzen, der aus der Realität ■der Dinge weiß, daß ein Zurück unmöglich ist und er dem weiteren Geschehen einfach überliefert ist, lernten die Bessarabier die Brutalität der Ansiedlung „im Zuge des brennenden Herdfeuers“ kennen. Zuviel vor der Öffentlichkeit gewaltsam verborgenes Unglück lastete auf diesem riesengroß angelegten Unternehmen, ganz gleich, ob es sich um den kleinen polnischen Bauern eines bisher weltvergessenen Dorfes der durch den Polenfeldzug eingegliederten Ostgebiete handelte, der, ohne sich umsehen zu können, von seiner oft kärglichen Heimstätte vertrieben wurde, um seinen Hof einem Volksdeutschen Umsiedler überlassen zu müssen — oder um die vornehme Stadtwohnung, die ebenso von ihrem Besitzer plötzlich geräumt werden mußte, da in das gerade noch ahnungslos benützte Heim andere Eingewiesene hineingesetzt werden sollten. Unzählig waren die Fälle, wo es unter dem brennenden Eindruck erschütternder Geschehnisse seitens der Anzusiedelnden zu offener Weigerung zur Übernahme solcher Objekte kam und diese von den Ansiedlungsstäben mit den verschiedensten Mitteln, ja Drohungen erzwungen wurde.
Unvergessen soll jener bessarabische Bauer, als Symbol des rechtlichen Denkens seiner Volksgruppe, bleiben, der unter gleichen Verhältnissen in ein kleines polnisches Gut eingewiesen wurde, das sich der Vorbesitzer mit viel Kunstsinn offenbar als ländliches Tuskulum ausgestaltet hatte. Sdiwere, handgetriebene Silbergegenstände, kostbare Vasen und antike Möbel fanden sich in den Räumen. Kurzerhand packte der Bauer alles zusammen, räumte alle Zimmer des Wohnhauses aus, versperrte die angehäuften Raritäten in eine Scheune und meldete dies der Ortsbehörde mit dem kurzen Bemerken, daß er mit diesen Dingen, die ihm nicht gehören, nichts zu tun haben wolle. Er habe früher solche Schätze nicht besessen und wolle sie auch jetzt nicht haben... Das unselige Experiment deutscher Kolonisationspraxis und „Eindeutschung“ fand durch den verlorenen Krieg ein geradezu fürchterliches Ende.
Es kam der Jänner 1945. Während das Krachen des einstürzenden „Tausendjährigen Reiches“ die Luft erschütterte, wanderten im Osten unabsehbare Scharen unglücklicher Menschen, die Neuangesiedelten, die nun weichen mußten, mit wunden Füßen oder auf abgehetzten Pferdefuhrwerken hockend, westwärts. Stumm und im Innern verhärtet gingen die Männer daneben — wieder im Treck — so wie damals, nur daß sie jetzt als die Opfer phantastischer Verblendung dem maßlosen Elend in das Ungewisse entgegenwankten.
Über das ihnen auferlegte Schicksal, geboren aus brutaler Überheblichkeit, hatte vom Anbeginn eine unsichtbare Hand den Text aus Jeremias 3, 25, geschrieben: „Denn worauf wir uns verließen, das ist uns jetzt eitel Schande, und wessen wir uns trösteten, des müssen wir uns jetzt schämen.“