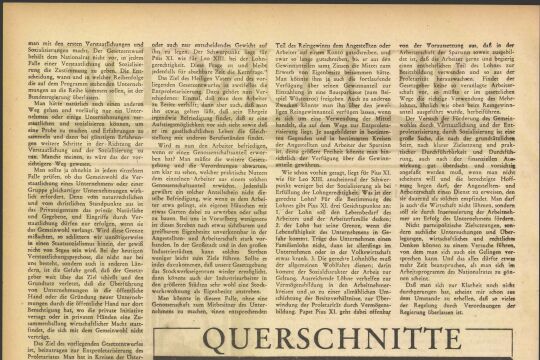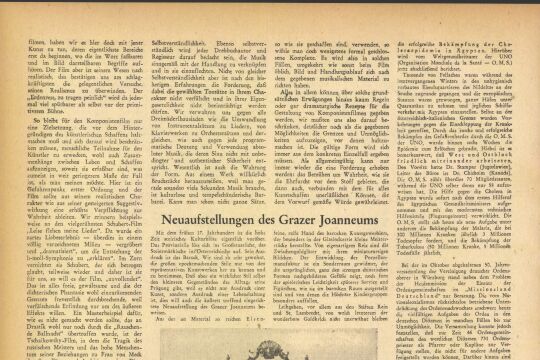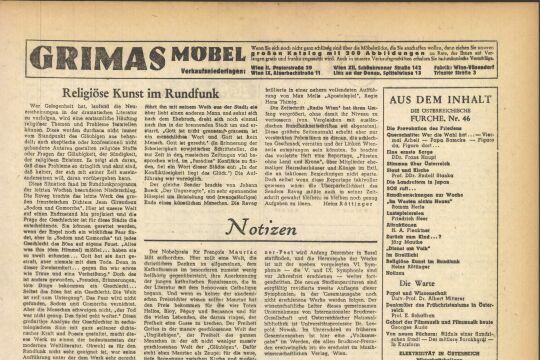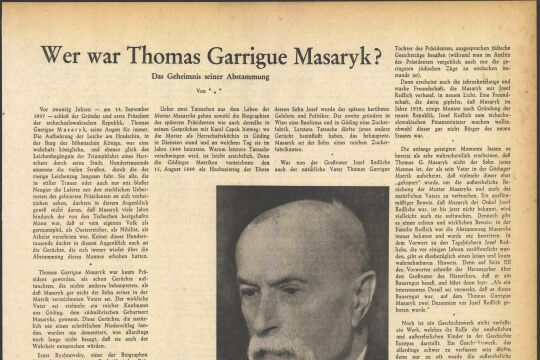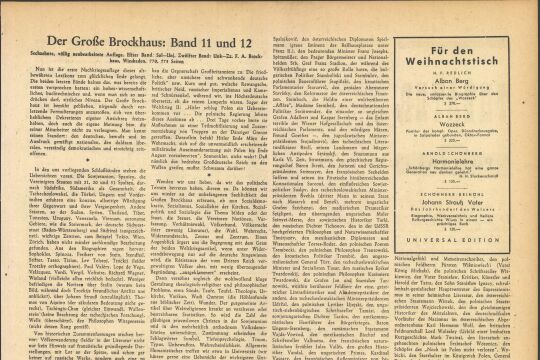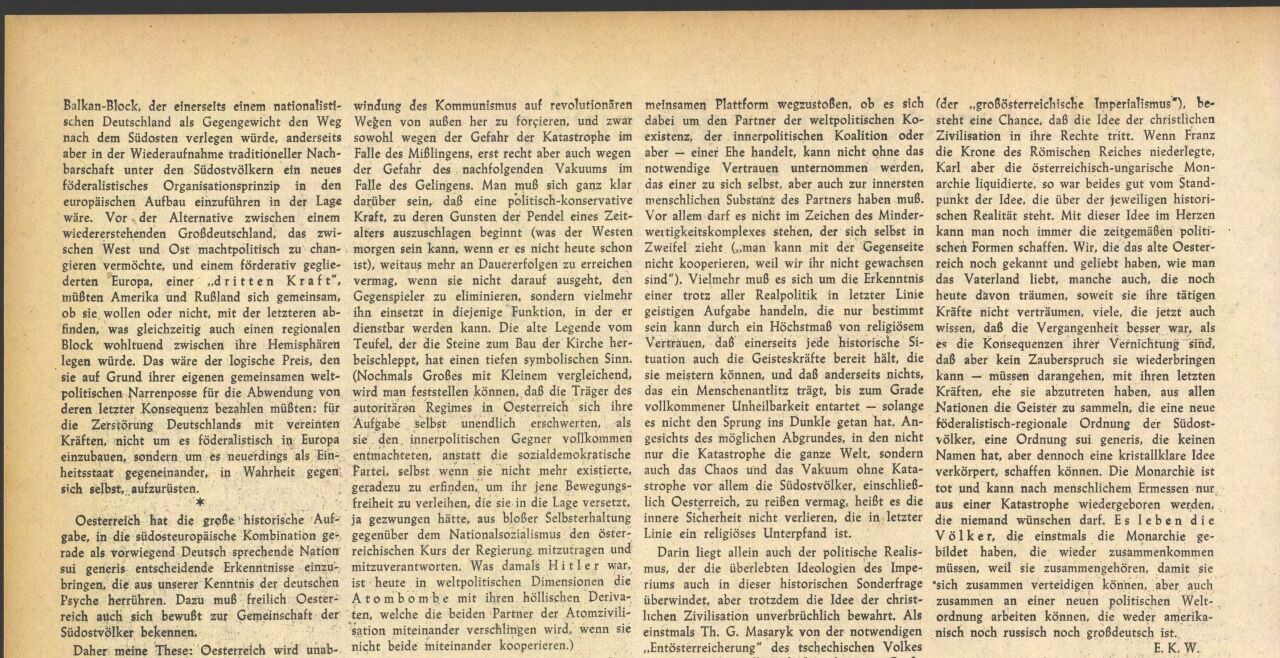
Vor kurzem veröffentlichte die sowjetische Presseagentur TASS eine Meldung, die im freien Europa völlig unbeachtet geblieben ist, auch in Moskau, wo man heute andere Sorgen hat, kein besonderes Aufsehen erregte, um so stärkere Beachtung dagegen in Rumänien fand. Die Meldung besagt, daß die Regierung der Sowjetunion sich entschlossen habe, Rumänien jene Kunstschätze zurückzuerstatten, die während des ersten Weltkrieges Rußland zur Verwahrung übergeben worden waren. Zur Erklärung dieser aus heiterem Himmel erfolgenden Tat führt die Moskauer Meldung an, daß während des letzten Krieges alle Archive und Kunstschätze einschließlich der rumänischen aus Moskau in ungefährdete Gebiete verlagert und nach dem Kriege systematisch gesichtet und geordnet worden seien, mit welcher Arbeit man jetzt fertig sei. Die Moskauer Verlautbarung unterläßt natürlich nicht den Hinweis darauf, daß das „Sowjetvolk“ die rumänischen Kunstschätze, die einen unvorstellbaren künstlerischen und geschichtlichen Wert besitzen, sorgfältig aufbewahrt habe, obwohl die rumänischen „Bojaren und Kapitalisten“ zweimal, 1918 und 1941—1944, Sowjetrußland mit Krieg überzogen und dessen historische und Kunstdenkmäler verwüstet und vernichtet hätten.
Im November 1916, drei Monate nach dem Eintritt Rumäniens in den ersten Weltkrieg an der Seite der Alliierten, näherten sich die deutschen Truppen der rumänischen Hauptstadt. Bukarest wurde von einer kopflosen Verwirrung ergriffen. Vor dem Zugriff durch die „Hunnen“, deren Greueltaten die alliierte Propaganda in den schrecklichsten Farben schilderte, schickte man alles, was der Nation wertvoll war, in etlichen Güterzugsladungen nach Moskau „in .Sicherheit“. Man hatte bald Ursache, diesen übereilten Schritt zu bereuen, um so mehr, als Feldmarschall von Mackensen, der Bukarest und die Walachei fast zwei Jahre lang als ungekrönter König beherrscht hat, sich als ein gerechter Landesvater erwies, dem heute noch die Rumänen aller Stände ein höchst ehrenvolles Gedenken bewahren. In Moskau dagegen führte bald die Revolution zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Rumänien und Rußland, und Anfragen auf diplomatischen Umwegen über den Verbleib der rumänischen Schätze blieben von den neuen Machthabern im Kreml einfach unbeantwortet.
Es waren fürwahr Schätze, die man den Russen anvertraut hatte, Schätze nicht nur für das rumänische Volk, sondern auch für den gesamten wissenschaftlichen und künstlerischen Besitz Europas. Nach Moskau hatte man nicht nur die gesamten Archive geschickt, mit tausen-den jahrhundertealten Dokumenten, eine uner meßliche Fundgrube für den Historiker, sondern auch fast alles, was Rumänien an Werken aller bildenden Künste und Kunsthandwerke .besaß: 13 50 Gemälde, Aquarelle und Graphiken der rumänischen Künstler des 19. Jahrhunderts, darunter fast das Gesamtwerk der den französischen Impressionisten nahezu ebenbürtig an die Seite tretenden Nikolaus Grigorescu, Theodor Aman und Stefan Luchian, die einzigartigen folkloristischen Aquarelle des Siebenbürgers Karl Pop de Satmary und anderes mehr; eine der größten und bedeutendsten numismatischen Sammlungen, unter deren über 35.000 Stück sich nicht nur zahlreiche antike Münzen seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. befanden, sondern auch byzantinische, arabische, türkische und natürlich sämtliche alten Münzen der rumänischen Fürstentümer; 156 rumänische Ikonen aus dem 15. und 16. Jahrhundert; eine Reliquienschrein-decke von 1396, ein herrlicher Orientteppich aus dem Jahre 1514; wundervolle Kirchenornate, edelsteingeschmückte Brokate, Meisterwerke rumänischer Weber aus dem 16. und 17. Jahrhundert; aus den beiden gleichen Jahrhunderten über ein halbes Hundert profane und kirchliche Werke der rumänischen Goldschmiedekunst, neben Kelchen und Kreuzen vor allem höchst bemerkenswerte Bischofsrnitreh, die in der orthodoxen Kirche nicht wie bei uns aus. Brokat, sondern wie Kronen aus edlem Metall sind; und schließlich den Goldschatz von Pietroasa, der so bedeutend ist, daß ihn jedes kleinste Hand- oder Wörterbuch der Kunst anführt. Als Draufgabe packte man noch die ganzen Goldbarren und -münzen der Rumänischen Nationalbank dazu.
Am 9. Juni 1934 unterzeichnete Rumäniens bekannter „Völkerbundschampion“, Außenminister Titulescu, ein Abkommen mit seinem sowjetischen Kollegen Litwinow über die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen. Litwinow verpflichtete sich ohne weiteres, die 1916 verlagerten Schätze herauszugeben. Was die Russen tatsächlich sandten, war ein Normalmeter aus Platin und 1435 Kisten mit Archivmaterial — meist Besitztitel von Gütern, die durch die Bodenreform von 1917—1921 wertlos geworden waren, und, als pikante Draufgabe, eine ganze Reihe gerichtlich hinterlegtet Testamente der führenden Schicht Rumäniens, die imstande gewesen wären, so manche seit zwei Jahrzehnten geregelte bedeutende Hinterlassenschaft völlig umzustürzen — man war klug genug, sie versiegelt in ihren Kisten zu belassen. Wo blieben die Schätze? Die Russen sandten auch noch einen Sarg — die Gebeine des moldauischen Fürsten Dimitri Cantemir, der, 1711 vor den Türken geflohen, 1723 als Gast Peters des Großen in Rußland gestorben war, Mitglied der Berliner Akademie, Verfasser einer „Descriptio Moldaviae“ und einer „Historia de ortu et de-fectione imperii turcici“, zweier damals in Westeuropa als klassisch sehr geschätzter Werke —, einen Sarg, den die Rumänen ebensowenig verlangt hatten wie die Franzosen den des Herzogs von Reichstadt, der ihnen von Hitler geschickt wurde. Wo bleiben die Schätze, fragte Bukarest in Moskau hartnäckig an. Die Russen stellten sich vollkommen taub. Daß die 314 Millionen Goldfranken der Nationalbank in den Revolutionsjahren zweifellos eine willkommene Auffüllung der Moskauer Kriegskasse waren, damit hätte man sich abgefunden. Was aber war mit den Kunstwerken geschehen?
Nun sind sie plötzlich wieder da. Die Wörterbücher der Kunst können ihre Anmerkungen „1916 nach Moskau gebracht, seither verschollen“ berichtigen. Der Goldschatz von Pietroasa bildet nicht nur künstlerisch und geschichtlich den wertvollsten Teil dieser Sammlungen; ihm widerfuhren auch die kuriosesten Schicksale. Seine Irrfahrten in den letzten 40 Jahren sind nur eine Fortsetzung der Mißgeschicke, die ihm in den voraufgegangenen acht Jahrzehnten widerfahren waren.
Gefunden — beschädigt — geraubt
Nordöstlich von Bukarest fallen die Karpaten in einem steilen, 600 Meter Höhenunterschied überwindenden Abhang zur Walachischen Tiefebene ab. Die Hänge, vor 150 Jahren noch bewaldet, sind heute bis hoch hinauf von Wein-und Obstgärten, darüber von Weiden bedeckt. Am messerscharfen Rand von Gebirge und Ebene liegt ein Dorf am andern, darunter auch, 20 Kilometer südwestlich der Stadt Buzau, Pietroasa. In einer von Wind und Wetter ausgewaschenen Felsspalte des darüber gelegenen, 75 5 Meter hohen Berges Istritza stießen 1837 zwei rodende Bauern auf den umfangreichsten aller Goldfunde, die j'e gemacht wurden: 22 Gegenstände, zusammen 75 Kilogramm schwer! Vom kunsthistorischen Wert ihres Fundes hatten die Bauern natürlich keine Vorstellung, aber auch der Metallwert entging ihnen. Sie hielten das Gold für Kupfer und verkauften ihren Fund um 4000 Goldlei einem levantinischen Bauunternehmer, Verussi. Dieser erkannte wohl, daß es sich um Gold handelte, aber über den künstlerischen und geschichtlichen Wert der Schmuckstücke machte auch er sich keine Gedanken. Um sie leichter an den Mann bringen zu können, zerhackte er viele einfach, andere schmolz er ein. Bis man in Bukarest erfuhr, was es da in Buzau zu kaufen gab, war es schon reichlich spät. 1842 konnte der Rest, der noch zusammenzubringen war, zwölf Stücke, seinen Einzug ins Bukarester Antikenmuseum halten. Es waren Schmuckstücke von einzigartiger Schönheit. 1867 wurde der Goldschatz von Pietroasa auf der Pariser Weltausstellung gezeigt und erregte unter den Archäologen der Welt so großes Aufsehen, daß er anschließend auch in London und 1873 auf der Wiener Weltausstellung gezeigt wurde. 1875 erlebte der Schatz eine neue Katastrophe. Ein rumänischer Seminarist, Pantazescu, stahl ihn auf eine Art, mit der er moderne amerikanische Kriminalfilme vorausnahm: Er schlich sich auf den Dachboden des Museums, bohrte in der Nacht ein Loch in die Decke, ließ sich an einer Strickleiter in den Museumssaal hinunter und entwich auf dem gleichen Wege, beladen ausschließlich mit dem Schatz von Pietroasa, wobei er, um die Stücke leichter in seinen Sack stopfen zu können, sie wahllos verbog. Er wurde gleich geschnappt, samt seiner Beute, die aber aus diesem Abenteuer leider wieder etwas lädiert hervorging.
Hatte Pantazescu es auf den Goldwert abgesehen? Oder war er in den Schatz verliebt? Das ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man weiß, wie populär dieser Goldschatz in ganz Rumänien geworden war, welcher fast mythischen Verehrung er sich erfreute, in einem Ausmaß und in einer Art, die westeuropäische archäologische Funde niemals gekannt haben. Auf dem uralten Boden der thrakisch-hellenisch-byzan-tinischen Kultur hat man zu Göttern und Dingen manchmal ein merkwürdig beseeltes Verhältnis. Lind so wie die Athener ihre jungfräuliche Göttin oft nur zutraulich k o r e, das Mädchen, nannten, so sprachen in Rumänien Bojaren wie Bauern von diesem Goldschatz liebevoll nur als von der C 1 0 s c h c a c u p u j i, der „Glucke mit den Kücken“.
Der Streit der Gelehrten
Von woher stammt dieser Schatz, welche Künstler haben ihn gefertigt, wer hat in besessen, wer ihn vergraben? Mit der Geschichte der wissenschaftlichen Erforschung und Bekanntmachung des Schatzes ist untrennbar der Name Alexander Odobescus verbunden, einer liebenswürdigen und für das Rumänien des vergangenen Jahrhunderts typischen Persönlichkeit. Die organische Verbindung der auto-chthonen rumänisch-byzantinischen Kultur mit der kurz vorher entdeckten europäischen, zumal französischen Geistigkeit brachte in einmaliger Häufung Persönlichkeiten von so reizvoller fruchtbarer Vielschichtigkeit hervor, wie das weder vor- noch nachher je der Fall war. Odo-bescu (1834—1895), Sproß einer Bojarenfamilie, studierte jahrelang in Paris und trat dann in den Staatsdienst, als wissenschaftlicher Beamter des Kultusministeriums; 1863 war er vorübergehend selber Kultusminister, daneben in den letzten 20 Jahren seines Lebens Professor für Archäologie an der Universität Bukarest. Der „Glucke mit den Kücken“ hat Odobescu Jahrzehnte seines Lebens gewidmet. Ihr zuliebe ging er o-gar, um Unterlagen und Quellen bei der Hand zu haben, 1880 für fünf Jahre als Gesandtschaftsrat nach Paris.
Natürlich trachtete Odobescu, die Glucke mit den übrigen Schatzfunden in Südost- und Osteuropa in Verbindung zu bringen. Aber das war zu seiner Zeit noch nicht so möglich wie heute. Der 1799 in Groß-St. Nikolaus im Banat (bekannter unter dem ungarischen Namen Nagy-Szent-Miklos, heute gleichfalls zu Rumänien gehörend) gefundene, im Wiener Kunsthistorischen
Museum liegende, populär „Schatz Attilas“ genannte Goldschmuck stammt ohne Zweifel aus einer späteren Zeit, wahrscheinlich aus dem 9. Jahrhundert, und von dem Fund von Schomel-markt in Siebenbürgen (ungarisch Szilägy-Somlyö, rumänisch Simleul Silvaniei) kannte man damals nur den ersten, 1797 gehobenen, gleichfalls in Wien liegenden antiken Teil.
Odobescus dreibändiges Werk Le tresor de Petrossa (die Schreibung des Ortsnamens glich er hier der französischen Aussprache an) ist weit mehr als eine mustergültige archäologische Publikation, sie ist eine regelrechte Geschichte der antiken Goldschmiedekunst und darüber hinaus ein bibliophiles Prachtwerk. Viele Kunsthandbücher führen es heute noch als einzige Literatur zu Pietroasa an. Obwohl Odobescu das Werk, zu dessen Herausgabe er bedeutende eigene Mittel zuschießen mußte, druckfertig hatte, erlebte er nur die Herausgabe des 1. Bandes (Paris 1889, chez Rothschild, 38 plus 514 Seiten, 16 Kunstdrucktafeln, 372 Abbildungen), der den Untertitel Historique — De-scription. Etüde sur l'orfevrerie antique trägt. 1895 schied Odobescu freiwillig aus dem Leben. Den 2. (111 Seiten) und 3. Band (126 Seiten) gab der Bukarester Professor Ionescu-Gion 1896 und 1900 in Leipzig heraus.
Odobescu konzentriert sich nicht auf seinen Stoff, seine unersättliche Neugierde, sein Wissensdurst und seine Erzählkunst lassen ihn ständig abschweifen, und doch schafft er ein Werk, das auch heute noch mit Genuß lesbar ist. Wenn er uns über eine Schale unterrichtet, so begnügt er sjch nicht damit, sie zu beschreiben. Er schildert gleich alle bekannten Schalen dieser Art, bei den Griechen und Römern, den Sassaniden und Byzantinern, bei den Skythen und Germanen, stützt sich nicht nur auf die archäologischen Funde, sondern zieht auch alle literarischen Quellen heran. So verwundert es nicht, daß der erste Band von den zwölf Gegenständen des Schatzes nur die ersten drei beschreibt, die allerdings eine Gruppe für sich bilden und spätantike Arbeiten sind.
Die neun Stücke des Schatzes von Pietroasa, die der zweite Band beschreibt, sind ein großer Brustschmuck, eine Brosche würden wir sagen, in Gestalt eines Sperbers (die „Glucke“), drei Adlerfibeln mit Almandinauflagen (die „Kük-ken“), ein achteckiges und ein zwölfeckiges Henkelkörbchen, ein großer Halskragen mit Anhängern aus Bergkristall, ein kleiner Halskragen und ein schweres Armband.
In seiner Deutung des Goldschatzes, die er im dritten Band bringt, war Odobescu sehr vorsichtig. Er faßte die bis dahin veröffentlichten Meinungen zusammen und erklärte als eigene Schlußfolgerung nur, daß es sich um den Schatz eines germanischen Stammes handeln müsse, wahrscheinlich der Goten, die seit dem 3. Jahrhundert Dazien als Herrenschicht über der auto-chthonen Bevölkerung besetzt hielten.
Zu seiner Zeit jedoch hatte bereits ein Außenseiter die nähere Herkunft des Schatzes zweifellos richtig gedeutet. Rudolf Neumeister, der in den siebziger und achtziger Jahren Pastor der seit dem 17. Jahrhundert bestehenden deutschen evangelischen Gemeinde zu Bukarest und Deutschlehrer am deutschen Gymnasium dieser Kirchengemeinde war, hatte sich ebenfalls gründlich mit dem Schatz beschäftigt. Nach seiner Pensionierung in die Heimat zurückgekehrt, hielt er in Lübeck einen Vortrag, in dem er auf eine Inschrift auf dem Armband (a r m i 11 a — in deutschen Werken oft auch als Halsband bezeichnet) hinwies, die in Runen geschrieben war, wie sie auch Ulfilas in seiner Bibelübersetzung verwendete, und die trotz der Beschädigungen durch Pantazescu als GUT ANIOWA HAILAG zu entziffern war, was wir etwas frei mit „der Goten Besitz und Heiligtum“ übersetzen können. Diesen Schatz konnten nur die Westgoten vergraben haben. 375 waren die Hunnen durch die Kaspische Pforte in Europa eingebrochen und hatten die Ostgoten, deren Reich vom Dnjestr bis an den Kaukasus reichte, unterworfen. Nun bedrohten die mongolischen Steppenreiter auch die Westgoten, die damals ungefähr das heutige Siedlungsgebiet der Rumänen beherrschten, vom Dnjestr bis an die Donau und über • die Karpaten hinüber nach Siebenbürgen. 376 überschritten die Hunnen den Dnjestr. König Athanarich verteidigte sich zunächst hinter dem Sereth, mußte sich aber dann über die Karpaten und Siebenbürgen ins Banat zurückziehen. Auf diesem Rückzug, besser: der Flucht, vor den Hunnen wird Athanarich 376 den Schatz vergraben haben — es ist kaum möglich, eine andere Erklärung zu finden. Neumeisters Deutung, über die einzig eine Lübecker Zeitung berichtete, blieb bis zu seinem Tode unbeachtet. Erst als später der Wiener Archäologe Fr. Bock zu den gleichen Schlußfolgerungen gelangt war, entdeckte man durch Zufall, daß die wissenschaftliche Priorität eigentlich Neumeister gebührte.
Allerdings steht die westgotische, insbesondere die Herkunft von Athanarich, auch wenn sie einen an Sicherheit grenzenden Grad der Wahrscheinlichkeit hat, nicht unumstritten fest. Namentlich manche französischen Kunsthistoriker ziehen bei der Betonung der eindeutig spätantiken Herkunft der Stücke mit iiguraier Ziselierung gleichzeitig auch die gotische Herkunft der anderen in Zweifel. Aber auch der Siebenbürger Sachse Dr. Julius B i e 1 z schrieb kürzlich, westgotische Herkunft komme hur zum Teil in Frage, da einzelne Stücke der pontischen Arbeiten ins 5. Jahrhundert gehörten — ebenfalls, ohne uns zu verraten, worauf sich diese genaue Datierung gründet und wer dann den Schatz vergraben haben soll. Etwa die von der Geschichte unbemerkt einsickernden slawischen Unterwanderer? Denn immerhin ist Dr. Bielz auch heute noch Abteilungsleiter des einst sächsischen, heute verstaatlichten Brukenthal-museums in Hermannstadt in Siebenbürgen, also im allslawischen Einflußbereich.
Der Schatz brachte keinem Glück
Bei den etwas unklaren Vorstellungen, die man sich bei uns über die Verhältnisse im Moskauer Bereich macht, dürfte es aber nicht überflüssig sein, zu betonen, daß Bielzens Meinung keineswegs etwa die von Bukarest vorgeschriebene ist. Andere dortige Deutsche, wie etwa Oskar Walter Cisek, verfochten jetzt ebenso öffentlich die westgotische Herkunft.
Der vierzig Jahre lang vollkommen verschollene Gotenschatz ist seiner Heimat wiedergegeben — wird sich auch die Welt daran erfreuen dürfen? Vorläufig zumindest hat ein westlicher Kunstliebhaber, der zur Besichtigung aufbrechen wollte, noch wenig Aussicht, eine Einreisegenehmigung zu erhalten.
Athanarich, „König der Wisigoten, Richter der Therwingen“ starb, von seinem Volke verstoßen, in der Verbannung am Kaiserhof von Byzanz; Venussi kam vor den Richter, Patazescu ins Gefängnis; Odobescu erschoß sich; Neumeister ward um seinen wissenschaftlichen Ruhm gebracht; von den Hütern des Schatzes in den letzten 30 Jahren dürfte vielleicht mancher einen indirekten Nachruf in der vielzitierten Rede Chruschtschows über die Opfer des Stalinismus erhalten haben; und Oscar Walter Cisek, der als Kind vor der Vitrine mit dem Gotengold von künftigem Ruhm träumte, wird wohl kaum noch für S. Fischer schreiben, da ihn die ESPLA (Staatsverlag für Literatur und Kunst der Volksrepublik Rumänien) vereinnahmt hat.
Gleichwohl, sie alle, denen die Berührung mit dem Schatz vielleicht nicht Glück im landläufigen Sinne gebracht hat, liebten ihn und waren ihm verfallen, und sie werden noch manche Nachfahren finden. Mattrötlich schimmern die goldenen Adler, grell leuchten die Blutstropfen der ins Purpurviolette spielenden Almandine aus dem geheimnisvollen Indien, und üben unvermindert ihren Zauber auf den empfänglichen Menschen aus. Heute wie vor eintausendsechshundert Jahren.