
Altertumswissenschaft im politischen Raum
Politik und Altertumswissenschaft scheinen fürs erste zwei Begriffe, die nicht allzu rege Beziehungen miteinander haben. Gilt doch der Archäologe im allgemeinen als der Gelehrte, der fern von den Fragen der Tagespolitik in längst Vergangenen Zeiten lebt, für die wieder die moderne Politik wenig Verständnis findet. Aber schon Theodor Mommsen, der größte Altertumsforscher, war alles eher als ein stiller, weitabgewandter Stubengelehrter, vielmehr ein leidenschaftlicher Politiker, dem seine politische Überzeugung den Verlust der Leipziger Professur gekostet hat. Jeder Historiker — dazu gehört auch der Altertumsforscher — ist ja irgendwie durch seine persönliche politische Überzeugung in seinen Arbeiten beeinflußt. Und ebensowenig ist die Politik immer nur mit einem geringschätzigen Lächeln an den Arbeiten der Altertumsforschung vorbeigegangen, sondern hat diese, wenn es darauf ankam, freilich nicht immer zum Vorteil einer objektiven Wissenschaft, für ihre Zwecke ausgenützt.
Bei den jungen Völkern Südosteuropas hat der Vergleich mit der großen historischen Vergangenheit ihrer klassischen Nachbarn im Süden schon frühzeitig das Bestreben hervorgebracht, die eigene Geschichte mit der griechisch-römischen irgendwie in Verbindung zu bringen und damit das eigene Nationalgefühl zu stärken. Schon die südslawische Volkssage weiß von besonderen Privilegien Alexanders des Großen für alle Slawen zu berichten, eine Parallele zum sogenannten Privilegium majus Herzog Rudolf des Stifters, der angeblich echte Dokumente aus der Zeit Cäsars oder Neros für seine politischen Ziele zu verwerten suchte. Aber nicht nur um erdichtete oder verfälschte antike Quellen handelt es sich dabei. In Anbetracht der Lückenhaftigkeit des Quellenmaterials ist nichts leichter wie eine einseitige, politisch voreingenommene Deutung und Ergänzung, und das um so eher, je weiter wir in der Vergangenheit zurückschreiten.
Stark politischen Charakter hat daher zuweilen schon die Vorgeschichtsforschung. Früher als die Deutschen haben die Slawen die Vor- und Frühgeschichte zur Stärkung ihres Nationalbewußtseins wie auch für politische Ziele auszuwerten versucht. So sehen wir zum Beispiel bei den Serben den Versuch, die Dynastie der Nemanjice auf Konstantin den Großen zurückzuführen oder den oströmischen Kaiser Justinian und dessen Onkel und Vorgänger Justin zu Slawen zu machen. Bei den griechischen und römischen Klassikern fand sich keine einheitliche Bezeichnung für die Slawen. Das ließ die Humanisten, die es überall liebten, griechisch-römische Namen auf die Völker ihrer Zeit zu übertragen, auch bei den Südslawen nicht ruhen, sie übertrugen den Namen der alten Illyrier zunächst auf die westlichen, sodann auf die übrigen Balkanslawen und schließlich vereinzelt sogar auf die gesamten Slawen. Den südslawischen Patrioten, die seit dem durch die deutsche Romantik geförderten Aufkommen eines slawischen Nationalgefühls immer wieder die Bodenständigkeit ihres Volkes in den Oftalpenländern und am Balkan zu beweisen bemüht waren, bedeutete also das alte Illyrien die Wiege des Slawentums am Nord- und Ostgestade der Adria, eine Anschauung, die 1745 durch die Schaffung einer Hofkommission zur Behandlung der „illyrischen Angelegenheiten“, später „Illyrische Hofdeputation“, beziehungsweise „Illyrische Hofkanzlei“ genannt, sogar Anerkennung durch den österreichischen Staat erfahren hat. Mit der Gründung der „Illyrischen Provinzen“ durch Napoleon nimmt die Gleichsetzung von illyrisch’und slawisch immer mehr zu, besonders seit sie von dem kroatischen Dichter Ludwig Gaj und seinen Mitarbeitern für die südslawischen Einheitsbestrebungen aufgegriffen worden war. Man war dabei von dem Slawentum der alten Illyrier überzeugt, griff in echt romantischer Weise auf das Altertum zurück und fand hier in diesem Volk, das so tapfer seine Freiheit im Kampf gegen Rom verteidigt hatte, die berühmten Vorfahren, die ihren weitgehenden modernen Zielen dienen konnten. Ist der „Illyrismus“ für die südslawische Literatur und vor allem für die Ausbildung eines südslawischen Einheitsbewußtseins von größter Bedeutung, so blieb er andererseits auf die Erforschung des illyrischen Volkstums der Antike ohne jeglichen Einfluß. Mit der immer stärker zunehmenden Sonderausbildung der nationalen Stammesindividualitäten bei den Südslawen verliert er an Bedeutung, die Altertumswissenschaft widerlegt einwandfrei die Gleichsetzung von illyrisch und slawisch.
Die durch den Zusammenbruch der europäischen Türkei und Österreich-Ungarns notwendig gewordene territoriale Neuordnung im südosteuropäischen Raum hat in ähnlicher Weise eine Reihe von Polemiken gezeitigt, in denen sich die beteiligten Parteien mehrfach der Ergebnisse der Altertumsforschung bedient haben.
Im bulgarisch-griechischen Streit um die mazedonisch-thrakischen Gebiete wurde von den Bulgaren, denen sich der Leipziger Romanist G. Weigand in seinem 1924 erschienenen Buche „Ethnographie von Makedonien“ anschloß, darauf hingewiesen, daß die alten Makedonier eine von den Griechen nicht verstandene Sprache gesprochen hätten. Ein Teil der makedonischen Stämme sei thrakisch gewesen, andere wieder, mehr im Westen, mögen zu den Illyriern gehört haben. Demgegenüber wurde von griechischer Seite, besonders von G. N. Hatzidakis, betont, daß die Makedonier sich von alters her als echte Griechen gefühlt haben und auch als Griechen angesehen werden wollten, daß auch die Griechen selbst sie von Anfang an für ihresgleichen gehalten haben. Tatsache ist, daß das makedonische Königstum die alte patriarchalische Form der homerischen Zeit bis zum Schlüsse bewahrt hat. Aber auch die dürftigen Reste der makedonischen Sprache, ihre Religion und Sitten geben der griechischen These recht. Freilich, abgetrennt von dem kulturellen Aufschwung des übrigen Griechentums, sind die Makedonier diesem immer als Barbaren erschienen und haben, wenn auch mit Unrecht, als Stammesfremde gegolten.
Ähnlich wie hier sollte die Altertumswissenschaft auch als Helfer im rumänischungarischen Streit um Siebenbürgen beistehen. Siebenbürgen ist bekanntlich durch die trajanischen Feldzüge von 101 bis 107 nach Christus römisch geworden. Während nun von den Rumänen die These vertreten wird, daß die vorrömische, dakische Bevölkerung Siebenbürgens damals romanisiert worden und auch nach Aufgabe dieser Provinz durch Rom im Lande verblieben sei, die Rumänen demnach als autochthone Bevölkerung Siebenbürgens angesehen werden müsse, wird dies von den ungarischen Altertumsforschern entschieden bestritten. Die alten Daker seien in den trajanischen Kriegen zur Gänze ausgerottet und das Land durch Zuzügler aus allen Teilen des Imperium Romanum neu besiedelt worden. Bei der Räumung Dakiens in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christi habe man aber auch diese Bevölkerung abgezogen, an ihre Stelle seien germanische Gepiden, später Slawen, Ungarn und erst zum Schluß, im Hochmittelalter, Rumänen ins Land eingedrungen. Es spricht aber doch mancherlei dafür, daß weder das eine noch das andere so ganz der Fall war. Wenn das von ungarischer Seite mustergültig vorgelegte Inschriftenmaterial kaum irgendwelche dakische Namen aus römischer Zeit aufweist, so darf dabei eingewendet werden, daß die einheimische Bauernbevölkerung, wie wir das auch in anderen Teilen des römischen Reiches sehen, meist keine schriftlichen Denkmäler hinterlassen hat. Hier dürfte erst eine Untersuchung der ländlichen Nekropolen mit ihrem Weiterleben vorrömischer Bestattungssitten genaueren Einblick gewähren. Aber auch die Räumung Dakiens unter Kaiser Gallienus oder Aurelian bedeutet noch nicht eine gänzliche Evakuierung. Was mit der römischen Oberhoheit aufhörte, war das städtische Leben, die ländliche Bevölkerung dagegen blieb. Was bei der rumänisch-ungarischen Polemik angenehm berührt, ist der hohe wissenschaftliche Ernst und der im großen und ganzen stets faire Ton. Es ist bezeichnend, daß die letzte, 1944 erschienene ungarische Publikation gewidmet ist „den rumänischen Archäologen und Althistorikern, von denen uns nur einige Streitfragen trennen, mit denen uns aber hundert andere gemeinsame wissenschaftliche Probleme verbinden“.
Die Beispiele für eine politische Auswertung archäologischer, beziehungsweise althistorischer Forschungen zu politischen Zwecken ließen sich noch vielfach vermehren, im positiven wie im negativen Sinne. Denn auch die Verleugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse kann politischen Zielen dienen. Hat doch ein angesehener deutscher Prähistoriker — allerdings nicht unter allgemeiner Zustimmung — die Forderung erhoben, daß Erkenntnisse, die im Augenblick für das eigene Volkstum schädlich sind, zunächst zurückgehjlten werden müßten.
Ist bei vielen dieser Bestrebungen ein wirklich wissenschaftlicher Ernst nicht zu verkennen, so gibt es daneben doch auch immer wieder ausgesprochen dilettantische Spekulationen, die zugunsten vorgefaßter Meinungen kritiklos mit den Arbeiten der Altertumsforschung operieren. In diese Linie gehören etwa die verschiedenen Versuche, das Kroatentum aus dem ethnischen Zusammenhang mit den Südslawen zu lösen. An sich sind wissenschaftliche Hypothesen, die eine nichtslawische Abstammung der Kroaten vertreten, keineswegs erst in der Zeit des sogenannten Unabhängigen kroatischen Staates im letzten Kriege geäußert worden. Die gotische Theorie, die die Kroaten von germanischen Goten abstammen läßt, wurde zum Beispiel schon seinerzeit von L. Gumplowicz aufgestellt und noch da und dort im letzten Kriege vertreten, von der ernsten kroatischen Wissenschaft dagegen abgelehnt. Ernster zu nehmen sind die Versuche, die Kroaten als Nachkommen iranisch-kaukasischer Stämme zu deuten. Aber wenn man sie sogar auf einer Felseninschrift des persischen Königs Darius I. vom Jahre 519 vor Christi finden und auf dem Grabmal dieses Königs unter den Untertanen auch die Kroaten an der mit der heutigen angeblich ähnlichen Fußbekleidung erkennen wollte, dann wird man für solche Auswüchse einer „politischen Altertumskunde“ wohl nur ein mitleidiges Lächeln finden.
Mit dem Ende des zweiten Weltkrieges ist es anscheinend in dieser Hinsicht zunächst stiller geworden. Wo Grenzprobleme auftauchen, geht es nicht mehr um mehr oder weniger gleichberechtigte Partner, die ihre historischen Argumente in die Waagschale werfen können. Es sind heute andere Kräfte am Werk, die ihren Forderungen ganz anderen Nachdruck verleihen können. Der Altertumswissenschaft kann es recht sein, wenn sie von der Politik ausgeschaltet bleibt. Gewiß hat ihr diese in der Regel durch Zuwendung reicher finanzieller Mittel, vor allem für Publikationen, die aber weniger der Wissenschaft als der Propaganda dienten, gedankt, doch wie oft hat dabei die Wahrheit, das Ziel wirklicher wissenschaftlicher Arbeit, gelitten. Die einzige wahre politische Aufgabe, die der Altertumswissenschaft, besonders jetzt nach der furchtbaren Katastrophe des zweiten Weltkrieges, gestellt ist, liegt nicht in der schließlich doch problematischen Mithilfe bei der Lösung dieser oder jener territorialen Frage, auch nicht in der weltanschaulichen Ausrichtung im Sinne des herrschenden Regimes, sie ist viel größer und erhabener: die Menschheit wieder emporzuführen zu jener humanita , wie sie das Ideal der größten Denker des Altertums war.















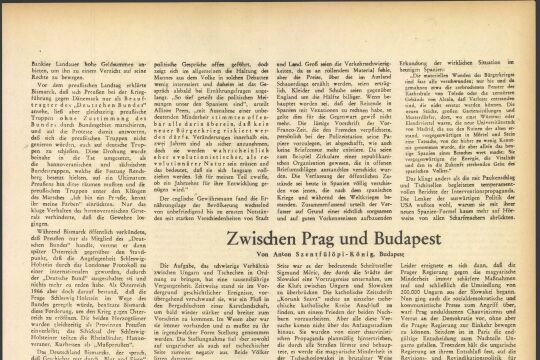

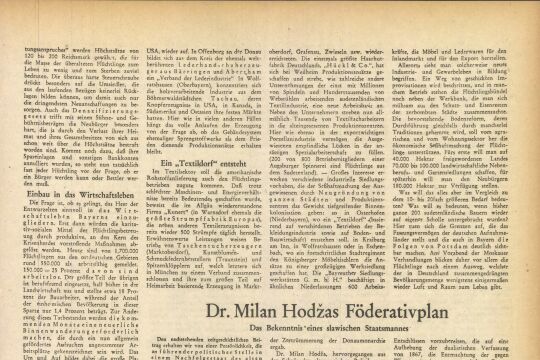












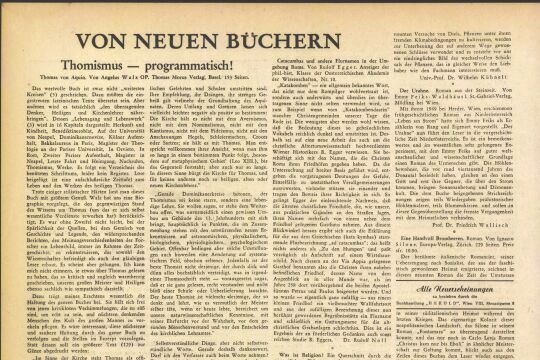




































































.png)
