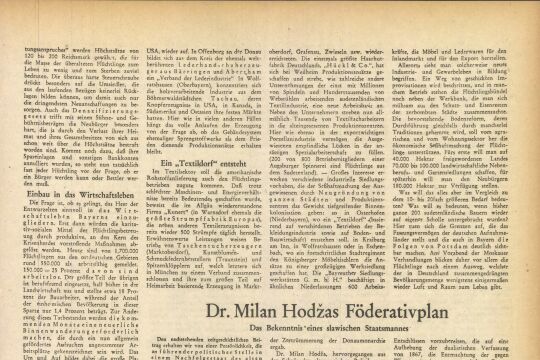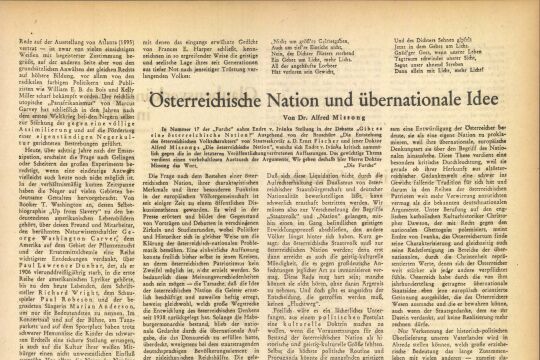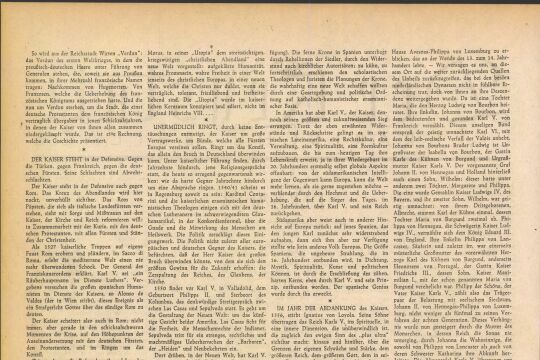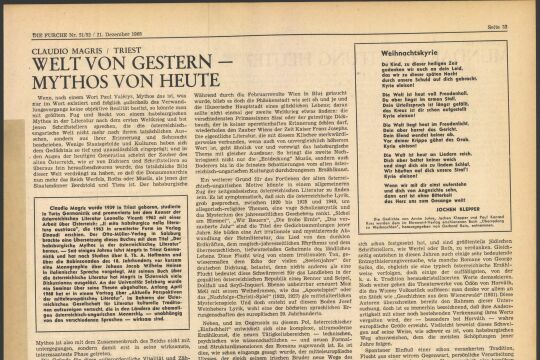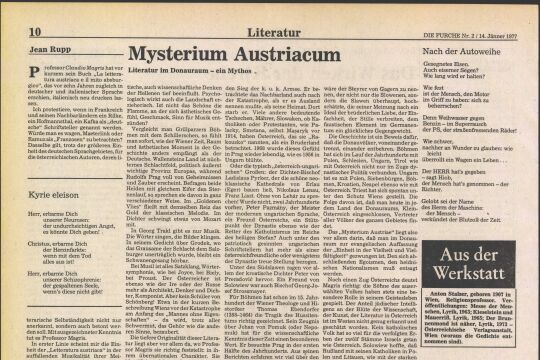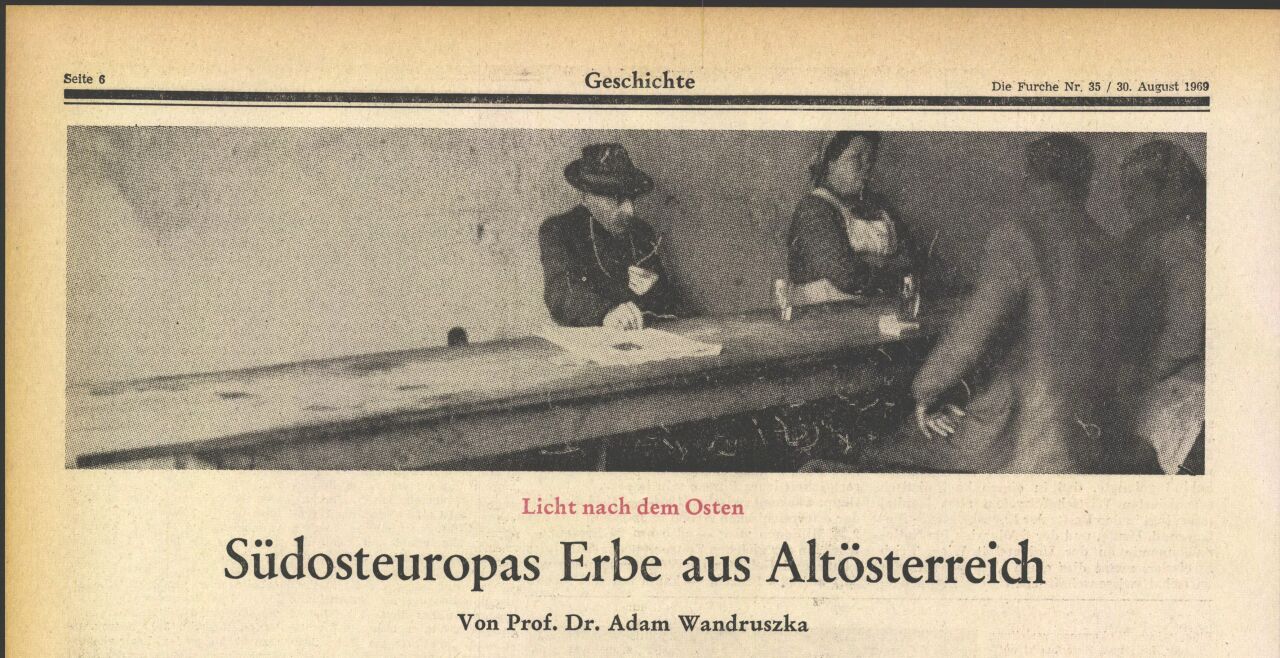
Das geschichtliche Urteil über das habsburgische Vielvölkerreich wird mehr und mehr in Forschung und Darstellung durch Menschen bestimmt, bei denen sich keine persönliche Erinnerung mehr in die Wertung einmischt; sie treten daher an die Probleme der Donaumonarchie mit der gleichen Distanz und Unbefangenheit heran wie an jede andere Frage oder Forschungsaufgabe aus dem Bereich der europäischen Geschichte.
Die „Ausstrahlung“
Die Bedeutung der österreichischen Großmacht und besonders die der beiden „Reichsstädte“ Wien und Triest für die nationale, kulturelle und geistige Entwicklung der Balkanvölker — nicht nur jener, die wie Kroaten, Serben und Rumänen zumindest mit Teilen ihrer Bevölkerung innerhalb der Grenzen des Habsburgerreichs siedelten, sondern auch der Albaner, Griechen und Bulgaren und selbst der Türken kann nicht leicht überschätzt werden. Daß 1791/92 die ersten beiden Zeitungen in serbischer Sprache in Wien erschienen, denen bald die erste ukrainische und die erste neugriechische Zeitung, die 1795 gegründete „Ephe-merie“, folgte, daß nicht erst die Romantik, sondern schon die there-sianische und josephinische Aufklärung, eben im Sinne der „Aufklärung“, der Volksbildung in der Volkssprache, die sprachliche und literarische Erweckungsbewegung der ost- und südosteuropäischen Nationen einleitete und Wien, wo der Slowene Bartholomäus Kopitar, einer der Väter der Sprach- und Literaturwissenschaft der Slawen, als Kustos an der Hofbibliothek wirkte und wo der Serbe Vuk Stefanoviä Karadzic, der Goethe für die serbische Volkspoesie interessierte, 1818 das erste serbische Wörterbuch erscheinen ließ, zugleich auch, seit dem Beginn der Neuzeit und bis zum Untergang der Monarchie und darüber hinaus ein Zentrum und Umschlagplatz für die Kunde und Erforschung des mosko-witschen und des osmanischen Reiches, der Balkanhalbinsel und des Vorderen Orients war, ergab sich aus der Verbindung der geographischen Lage mit der österreichischen Großmachtstellung. Denn diese Großmachtstellung bewirkte, daß die Stadt an der Donau vom Ende des 17. Jahrhunderts an in ihrer Anziehungskraft für die gesellschaftliche und geistige Elite der Völker des östlichen Mittelmeeres Venedig überflügelte, das bis dahin diese Funktion ausgeübt hatte.
Nationalismus?
Auf der anderen Seite wäre es gewiß übertrieben und Ausdruck eines höchst unzeitgemäßen, engstirnigen Neo-Nationalismus, wollte man nun alle geistigen und kulturellen Leistungen, die von den Angehörigen der verschiedenen Nationen des Habsburgerreiches vollbracht wurden, gleichsam auf das Haben-Konto dieses Reiches gutschreiben. Gibt es
doch kaum ein Gebiet, wo derartige Beschlagnahmen und Attributionen problematischer und kontroverser sind als das Gebiet des alten Österreich. So kann man über die Frage, ob man Franz Kafka als österreichischen, böhmischen, deutschen, jüdischen oder etwa gar, völlig unhistorisch, als „tschechoslowakischen“ Schriftsteller etikettieren soll, beliebig lange streiten. Daß der Deutschböhme Joseph Ressel in Triest die Schiffsschraube erfand, erfüllt Österreicher, Sudetendeutsche, Tschechen und Italiener mit Stolz, aber wer von diesen kann ihn nun wirklich mit voller Berechtigung als „einen der Unsrigen“ reklamieren? Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren, und gerade hier erweist sich besonders deutlich die Unmöglichkeit,, geistige und kulturelle Vorgänge und Entwicklungen mit einer quantitativen Methode, durch eine Statistik oder durch bloße kumulierende Aufzählung, zu erfassen und anschaulich zu machen. Gibt es wirklich etwas Gemeinsames, das man als „spezifisch österreichisch“ bezeichnen könnte, das Cesare Bec-carias berühmte bahnbrechende Schrift „Dei delitti e delle pene“, Grillparzers Dramen, den „Nachsommer“, das Werk Sigmund Freuds und den „braven Soldaten Schwejk“ verbindet, nur weil die Verfasser aller dieser Werke Untertanen des „Allerhöchsten Kaiserhauses“ waren? Man pflegt solche Fragen in jüngster Zeit gerne in bejahendem Sinne mit dem Hinweis auf Mensch-
lichkeit, Humanität, Toleranz, als Ergebnis des Zusammenlebens vieler Völker und des dadurch bewirkten gegenseitigen Abschleifens der Kanten und Ecken und der Notwendigkeit wechselseitiger Rücksichtnahme zu beantworten. Das ist sicher teilweise richtig, und man kann vielleicht sagen, daß die Schöpfungen der meisten „Österreicher“ außer der individuellen und der national bedingten Komponente oft noch ein Element enthalten, das auf die besondere Atmosphäre der übernatio-
nalen staatlichen Gemeinschaft hinweist, in der sie entstanden sind. Aber jeder Versuch, dieses Element genauer zu bestimmen und gegenüber den anderen Faktoren abzugrenzen, muß scheitern oder im unverbindlichen und unbestimmten Apercu steckenbleiben. So bleibt vielleicht nur der Weg, stichwortartig einige Fakten und Entwicklungslinien zu skizzieren, an denen sich ein Einfluß der Geschichte der politischen Gemeinschaft auf das geistige und kulturelle Leben demonstrieren läßt.
Der Strom von Westen nach Osten
Da ist zunächst die unbestreitbare Tatsache, daß dieses Staatengebilde von seinen Ursprüngen her, dem Lauf der ponau von Westen nach Osten -entsprechendafimmer wieder neue Ideen, Anregungen und Einrichtungen der Mitte und des Westens Europas nach dem Osten und Südosten vermittelt hat. Die ersten Habsburger, die aus dem Südwesten des Reiches kamen, die burgundische Heirat und Erbschaft Maximilians I., die Tatsache, daß Ferdinand I., den man mit gutem Recht als den eigentlichen Schöpfer der „Donaumonarchie“ durch die Gewinnung der böhmischen und der ungarischen Krone bezeichnen kann, in Spanien erzogen wurde, daß Karl VI. von seinem gescheiterten spanischen Unternehmen reiche Anregungen auf wirtschaftlichem, handelspolitischem und administrativem Gebiet mitbrachte; und zwar nicht nur aus Spanien und Portugal, sondern vor allem auch aus England und den Niederlanden, die Bedeutung des in Frankreich in italienisch-französischer Tradition aufgewachsenen Prinzen Eugen für die „Staatswerdung“ der österrei-schen Monarchie, der Einfluß der Lothringer, die mit dem Gemahl der Maria Theresia ins Land kamen, der Wallonen “ und Flamen aus den „österreichischen Niederlanden“, der „Vorderösterreicher“ vom Oberrhein und der vielen Schwaben, Franken und Rheinländer, von denen Metternich ja nur der Berühmteste und geschichtlich Bedeutendste war, alles ordnet sich durch die Jahrhunderte in diesen großen Zug der west-öst-lichen Vermittlung, dem jedoch immer auch ein gegenläufiger, wenngleich meist schwächerer Zug der östlichen — erst byzantinischen, dann osmanischen — Einflüsse entspricht, die über Österreich aus dem Osten in den Westen gelangen. Darüber darf man allerdings auch den Austausch zwischen Nord und Süd nicht vergessen, die Vermittlung der in Italien entwickelten Formenwelt in den bildenden Künsten, der Musik und der Literatur nach dem Norden, die der norddeutsch-protestantischen Aufklärung, idealistischen Philosophie und Klassik, nach dem Süden, aber etwa auch in der Mitte des 18. Jahrhunderts die Übernahme gewisser in Preußen entwickelter Verwaltungsprinzipien und hundert Jahre später die des Modells der Humboldtschen Universität.
Aus der Offenheit und wechselseiti-
gen Beeinflussung nach und von allen Seiten der Windrose hat sich jene oft allzu „sprichwörtliche“ Kon-zilianz und Toleranz ergeben, die von fremden und einheimischen Kritikern oft als Weichheit und Charakterlosigkeit mißverstanden und angeprangert worden ist — wobei gar nichts geleugnet werden soll, daß diese Gefahr durchaus besteht. Aber das Abschleifen von Ecken und Kanten bedeutet ja noch keineswegs den Verlust von Haltung und Rückgrat. Im Gegenteil, wenn man gerne mit positivem Akzent von der „rauhen Schale und einem weichen Kern“ spricht, so ist umgekehrt die weiche Schale oft mit einem festen Kern verbunden, und diese zweite Möglichkeit entspricht eher dem österreichischen1 Idealtypus.
Das schwer definierbare „Österreichische“
Nun mag sich hier gleich der Einwand erheben, daß sich, zumindest was die geschichtliche Epoche der Donaumonarchie betrifft, ,yder“ oder „die Österreicher“ nicht definieren oder auch nur einigermaßen bestimmen ließen.
Aber es hat diese „Österreicher“ doch gegeben, nicht nur in der Armee und in der Bürokratie, im
hohen Adel und im Großbürgertum, sondern gerade auch in den breiteren Volksschichten. Viele, aber gewiß nicht alle dieser „Österreicher“ waren von gemischter sprachlich-ethnischer Herkunft, wie sie sich aus dem langen Zusammenleben in einem Staatswesen ganz natürlich ergab, andere fühlten sich dieser oder jener der Nationalitäten des Vdelvölkerrei-ches zugehörig, zugleich aber und oft in erster Linie als Österreicher, und das hieß eben, als treue und loyale Diener des „Hauses Österreich“, der habsburgischen Dynastie und des von ihr geschaffenen Staatswesens. Vielen war dieses ihr österreicher-tum entweder selbstverständlich oder gar nicht bewußt, sie bekannten sich im Rahmen der Monarchie zu der einen oder anderen Nationalität
und erfuhren erst nach dem Zusammenbruch der Monarchie, wie sehr sie doch, gleichsam ohne es zu merken, „Österreicher“ gewesen waren; was besonders bei Angehörigen jener Nationalitäten zutraf, die nunmehr in einem Nationalstaat mit Konationalen vereinigt wurden, die nicht in Österreich aufgewachsen, nicht in der „Schule“ der Monarchie in des Wortes weitester Bedeutung groß geworden waren, also etwa bei Polen, Rumänen, Italienern, Südslawen. Für viele von diesen ist es ein heißerstrebtes Ziel geworden, dem neuen Vaterland in der einstigen Reichshauptstadt Wien dienen zu dürfen.
Daß die altösterreicbische Bürokratie mit zu den wertvollsten Erbstücken gehörte, die das untergegangene Staatswesen den Nachfolgestaaten, einschließllich der Republik Österreich, vermachte, ist heute wohl allgemein anerkannt. Wieviel von der Anziehungskraft, die das heutige Österreich und Wien auf die Bewohner der kommunistisch gewordenen Nachfolgestaaten ausübt, auf das Konto des anderen Gesellschafts- und Wirtschaftssystems zu schreiben ist, wieviel auf die historische Erinnerung und den Zauber, den einst die „Kaiserstadt“ für die Bewohner des weiten Reiches besaß, läßt sich nicht messen und berechnen.
Die Schule, die Schule machte
Das österreichische Schulwesen, im Zeitalter Maria Theresias aufgebaut und am Beginn der Ära Franz Josephs erneuert, ist mit Recht, zusammen mit der „in den Staat integrierten“ Medizin, stets als ein besonderer Ruhmestitel der Donaumonarchie angesehen worden. Gerade die besten altösterreichischen Offiziere und Beamten haben ihre Aufgabe als die eines „besseren Volksschullehrers“ aufgefaßt. Wie jeder einmal die Schule verläßt, so haben auch die Völker Südosteuropas die habsburgische „Völkerschule“ verlassen und das berühmte, von Kaiser Karl erlassene und dem Ministerpräsidenten Prof. Max Hus-sarek, einem „Schulmann“ in des Wortes bester Bedeutung, verfaßte und gegengezeichnete „Völkermanifest“ vom 16. Oktober 1918 hat den Charakter eines in der Not der Stunde den die Schule eigenmächtig verlassenden Schülern gleichsam „nachgeworfenen“ Reifezeugnisses erhalten.
Gewiß, hier lauert die Gefahr der Sentimentalität im Rückblick, die Verklärung der Jugendzeit im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Zur Korrektur sei zum Abschluß an ein schönes, zur Gerechtigkeit mahnendes Wort eines der klügsten und liebenswürdigsten Historiker der älteren Generation zitiert, von Heinrich Benedikt, der das Wesen der Donaumonarchie als „Monarchie der Gegensätze“ zu definieren sucht und abschließend schreibt: „Die alte Fabel lehrt, daß erst an der gefallenen Eiche ihre Größe zu erkennen ist.“