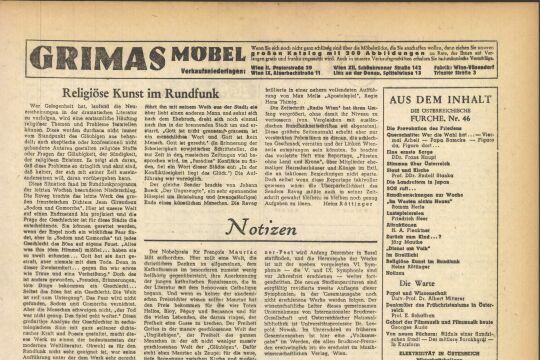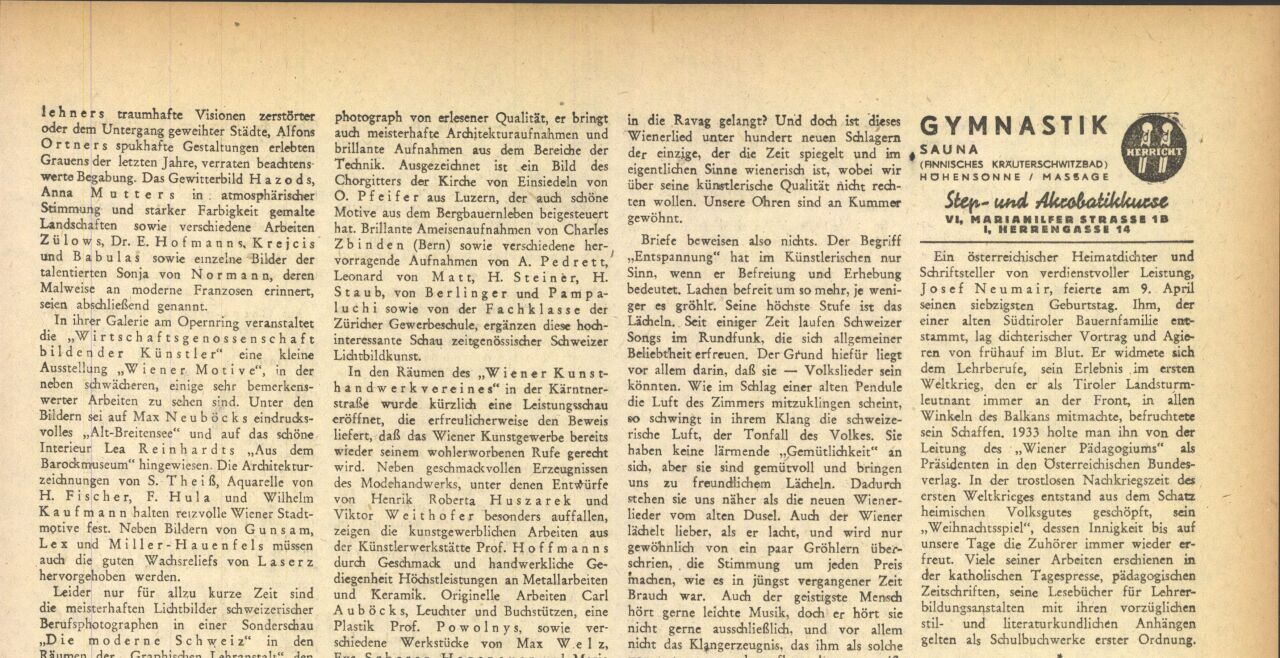
Von allen Berühmtheiten Wiens ist sein Ruf als Stadt der Musik am weitesten verbreitet, am höchsten geschätzt und durch Krieg und Gewalt am wenigsten geschädigt. Wie ein Phönix erhebt sich oft österreichisches Musiziern aus der Asche der materiellen und geistigen Nöte.
„Aber der Phönix präsentierte sich als ordinärer Haushahn.“ An dieses Wort Heines wird der Wiener erinnert, der sich jetzt nach schwerem Tagwerk und leichter Kost zu später Abendstunde ans Radio setzt und Musik hört. Was nützen ihm die Sendungen des Tages und wären sie Nachtigallenchöre! Er kann sie, da er gottlob einen Beruf hat, nicht hören, ist auf die täglich gesendete abendliche Tanzmusik angewiesen. Darin aber äußert sich die weltberühmte Musikstadt so:
Ein Vango im roten Licht, diesem Zauber entgehst du nicht im roten Lidit — oder wenn sie ganz besonders wienerisch kommt:
I hab an Patzen Rausch, daß i 's net fassen kann, und beim Nachhausegehn sing i auf der Straßen dann, usw.
Der Qualität dieser Verse entspricht die Musik genau und meist auch ihre gesangliche Wiedergabe. Es gibt noch weit Ärgeres als die beiden Pröbchen. Ein Schlager wie
In der Nacht ist der Mensch nicht, gern alleine, worauf dann noch zur deutlicheren Erklärung „Sie wissen ja, was ich meine“ kommt, gehört bereits zur Auslese des Gebotenen. Geht dieser Musik einmal der Vorrat aus, wird als Ersatz Opern- und Konzertmusik gesendet. Selten genug. Dann aber flattern die Drohbriefe in die Ravag, darin von den Verfassern die Abstellung dieses Unfugs gefordert wird.
Es wird wohl immer Leute geben, deren sich der Prater nur im Wurstel, Schönbrunn nur im Zwinger offenbart. Sollen aber diese Leute, auch wenn sie, was wir zur Ehre des Wienertums bestreiten, in der Mehrheit sein sollten, das große Wort reden, das Sendeprogramm bestimmen dürfen, das als Spiegel österreichi-schenGeisteslebensseineStrahlen in die Welt wirft? Wir wehren uns gegen das falsche Bild, das über den Wiener kursiert, ihn nur als ewigen Raunzer und weintrunkenen Sybariten kennt; wir haben in den Terrorjahren ein ganz anderes Gesicht gezeigt, und auch in der Gegenwart gewinnt unsere ernste, zeitbewußte, unsere ethische Haltung die Sympathien des Auslandes — in unserer Musik aber haben wir keinen andern Wunsch als den alten Haarbeutel oder den neuen Tango im roten Licht? Und schreiben Beschwerdebriefe, wenn au dem Radio einmal nicht der Haushahn kräht?
Nicht jeder schreibt Briefe. Schwiegen die Schreiber und schrieben die Schweiger, würde die Unzulänglichkeit der musikalischen Sendungen noch viel offenbarer. Es gibt viele ernste Komponisten unserer Heimat, die nie zu Worte kommen, doch kaum einen Schlager, den man uns nicht serviert, als wären sie das Kulturgut und alles andere nur notwendiges Übel: obgleich selten ein überhaupt brauchbarer unter ihnen ist, wie das kürzlich von Ernst Arnold gesungene Wienerlied, dessen launiger Text den Beifall aller Hörer errang und dessen Kehrreim beiläufig mit den Worten schließt:
Ja, der Wiener geht nicht unter, doch er kommt auch nie hinauf.
Ist darüber ein einziger Anerkennungsbrief
In die Ravag gelangt? Und doch ist dieses Wienerlied unter hundert neuen Schlagern der einzige, der die Zeit spiegelt und im eigentlichen Sinne wienerisch ist, wobei wir über seine künstlerische Qualität nicht rechten wollen. Unsere Ohren sind an Kummer gewöhnt.
Briefe beweisen also nichts. Der Begriff „Entspannung“ hat im Künstlerischen nur Sinn, wenn er Befreiung und Erhebung bedeutet. Lachen befreit um so mehr, je weniger es gröhlt. Seine höchste Stufe ist das Lächeln. Seit einiger Zeit laufen Schweizer Songs im Rundfunk, die sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen. Der Grund hiefür liegt vor allem darin, daß sie — Volkslieder sein könnten. Wie im Schlag einer alten Pendule die Luft des Zimmers mitzuklingen scheint, so schwingt in ihrem Klang die schweizerische Luft, der Tonfall des Volkes. Sie haben keine lärmende „Gemütlichkeit“ an sich, aber sie sind gemütvoll und bringen uns zu freundlichem Lächeln. Dadurch stehen sie uns näher als die neuen Wienerlieder vom alten Dusel. Auch der Wiener lächelt lieber, als er lacht, und wird nur gewöhnlich von ein paar Gröhlern überschrien, die Stimmung um jeden Preis machen, wie es in jüngst vergangener Zeit Brauch war. Auch der geistigste Mensch hört gerne leichte Musik, doch er hört sie nicht gerne ausschließlich, und vor allem nicht das Klangerzeugnis, das ihm als solche vorgesetzt zu werden pflegt, denn er weiß, die leichte Muse ist die schwerere Kunst und daher viel seltener als die ernste.
Wir sprechen mit Absicht von der leichten Muse, da sie gut vier Fünftel des Sende-programms ausfüllt. Das eben erscheint uns, bei allem Verständnis für die Unterhaltungsabsicht der Hörer, ein unverhältnismäßiges Übergewicht, zumal „Muse“ dafür eine abwegige Bezeichnung ist. Ins Literarische übertragen, würde diese Praxis die faist ausschließliche Sendung zum Beispiel von Kriminalgeschichten bedeuten. So unterhaltend eine solche Sendung sein kann, kommt säe, ausschließlich verwendet, einer geistigen Lustseuche gleich und ist schlimmer als Langeweile, ist eine Sünde an der Kultur. Außerdem: hinter dieser Praxis steht nicht der größte Teil der Hörer, sondern, wie wir überzeugt sind, sogar ein verhältnismäßig kleiner, der am musikalischen Erbteil Wiens nicht teilhat und dafür die .Brief-schreiber stellt, die trotzdem bei weitem nicht so unzufrieden sind als die überwältigende Mehrzahl der Schweiger. Und wenn im Sendeprogramm schon aus geschäftlichen Gründen jedem Hörer etwas geboten werden soll, dann wäre es an der Zeit, das Übergewicht der Unmusik allmählich ' abzubauen und Spätabendhörer, das ist der allergrößte Teil aller Hörer, an der M u s i k-k u 11 u r Wiens teilnehmen zu lassen im Geiste des Phönix und nicht des Haushahnes.
Franciscu s
Ein österreichischer Heimatdichter und Schriftsteller von verdienstvoller Leistung, Josef Neumai r, feierte am 9. April seinen siebzigsten Geburtstag. Ihm, der einer alten Südtiroler Bauernfamilie entstammt, lag dichterischer Vortrag und Agieren von frühauf im Blut. Er widmete sich dem Lehrberufe, sein Erlebnis im ersten Weltkrieg, den er als Tiroler Landsturmleutnant immer an der Front, in allen Winkeln des Balkans mitmachte, befruchtete sein Sdiaffen. 1933 holte man ihn von der Leitung des „Wiener Pädagogiums“ ab Präsidenten in den österreichischen Bundesverlag. In der trostlosen Nachkriegszeit des ersten Weltkrieges entstand aus dem Schatz heimischen Volksgutes geschöpft, sein „Weihnachtsspiel“, dessen Innigkeit bis auf unsere Tage die Zuhörer immer wieder erfreut. Viele seiner Arbeiten erschienen in der katholischen Tagespresse, pädagogischen Zeitschriften, seine Lesebücher für Lehrerbildungsanstalten mit ihren vorzüglichen stil- und literaturkundlidien Anhängen gelten als Schulbuchwerke erster Ordnung.
Bei den Zürcher Theaterfestwochen in der zweiten Junihälfte wird neben den beiden Bundestheatern auch das „Theater in der Josefstadt“ gastieren. Alle drei Bühnen werden mit je zwei Stücken daran teilnehmen.
Unter dem Titel „Von den Aufgaben der katholischen Philosophie in der Zeit“, veröffentlichte der Schweizer Jesuit Urs von Balthasar in den „Annalen der Philosophisdien Gesellschaft Innerschweiz“ (Herausgeber: Dr. E. Spieß, Eschenz) eine programmatische Studie, in der er aufzeigen will, wie traditionsgebundene Wahrheit mit dem Zeitdenken in Beziehung zu setzen ist. Es ist die Aufgabe des Philosophen — legt Balthasar dar —, alles, was je Wahres gedacht worden, „heimzuholen“ und ihm den im christlidien Raum gebührenden Platz anzuweisen. Das absolute Wort ertönt in tausend Geistessprachen, di* der christliche Denker verstehen und sich ihrer, nach Maßgabe der Zeit- und Weltgestalt, bedienen wird. Der Denker als Christ scheut die Mühe nidit, in den Weltsystemen nach ursprünglicher Wahrheit zu forschen; denn kein Wahrheitselement scheint ihm zu gering. Solche stete Offenheit wird ihn selber vor voreiliger Systematisierung bewahren. In diesem Sinne haben Johannes, Paulus, die Väter und die christlichen Denker des Mittelalters gedacht. Das formale Moment der Begegnung des christlichen Philosophen mit dem modernen Denken ruht in der Einsicht, daß abendländisches Denken aus diristlicher Substanz lebt und daß selbst im säkularisierten Geist der Moderne christlidie Gehalte unerkannt weiterwirken. Zugleich aber muß die entscheidende Erkenntnis walten, daß kein Zeitalter das letzte Wort gesprodien, sondern jedes Neues und Ergänzendes zu sagen hat. Christliches Philosophieren partizipiert in diesem Wachsen, ohne mit dem Vergangenen und Gültigen zu brechen. Es verabsolutiert keine Denkepoche, sei sie patri-stisch oder scholastisch; denn dies geschähe nur auf Kosten der alles durchsäuernden Wahrheit. *
Der Nachricht, daß Erzbischof S t e p i-n a c aus dem Kerker „Lepoglava“, wo er seit seiner Verurteilung untergebracht worden war, in ein Sanatorium überführt worden sei, widerspricht eine Meldung der „Neuen Zürcher Nachrichten“. Da er es abgelehnt habe, ein Gnadengesuch an Marschall Tito zu riditen und ein gerechtes neues Urteil fordere, sei er in den fürchterlichen Kerker „Trakoscan“ gebracht worden; „Trakoscan“ ist ein mittelalterliches Gefängnis in einem ehemaligen Schloß der Grafen Draskovich im Norden Kroatiens.
Marschill Tito soll nach der Zeitschrift „Le Litterraire“ erklärt haben, daß alle Feen- und Geistergeschichten aus dem Buchhandel und den Filmen aus erzieherischen Gründen ferngehalten werden sollen, weil angeblich Märchen und Sagen das Denken der Kinder auf ein utopisches Leben hinlenken. Es darf also nicht mehr geträumt werden und jedes Kind muß sein Glück, wie die holländisdie Zeitung „De Linie“ meint, im täglichen Leben finden.
Der Verband der tschechischen
Partisanen hat in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Nationalverteidigungs-ministerium alle Partisanenausweise und -Legitimationen eingezogen, deren Zahl rund eine Million betrug. Nach eingehender Überprüfung wurden Legitimationen an solche ausgegeben, die tatsächlich am Partisanenkampf teilgenommen haben. Ihre Zahl beträgt 300 0.
Die tschechoslowakischen Gebietsforderungen an Deutschland bezwecken, wie wir tschechischen Blättern entnehmen, eine Verkürzung der gemeinsamen Staatsgrenze, sowie die Beseitigung einiger Verkehrssdiwierigkeiten. Die Tschechoslowakei beansprucht unter anderem: Von Sachsen einen Grenzstreifen im Elstergebirge zwischen dem Ascher Zipfel und der Stadt Graslitz, einschließlich der Eisenbahnlinie, ferner Gebietsteile in der Nähe von Gottesgab bei St. Joachimsthal, insbesondere den Gipfel des Fichtelgebirges, sowie nördlich von Brüx einen Streifen zwischen Katharinaberg, Moldau und Zinnwald. Von Bayern werden einige Stellen im Wondrebtal und sämtliche Berggipfel des Böhmerwaldes auf bayrischer Seite, vor allem Arber, Rachel und Lüsen gefordert. Das gesamte von Deutschland beanspruchte Gebiet hat einen Umfang von 820 Quadratkilometer und zählt etwa 25.000 Einwohner. Dazu kommt die Stadt Zittau samt Umgebung mit 45.000 Bewohnern, die selbst den Wunsch nach Einverleibung in die Tschoslowakei geäußert haben sollen, da sie sich als Nachkommen der vor 300 Jahren dort angesiedelten böhmischen Exulanten fühlen. Die tschechoslowakische Regierung wünscht den Austausch der hier lebenden deutschen Bevölkerung gegen Tschechen und andere Slawen, die in Deutschland wohnen.
Zwei amerikanische Offiziere haben in zwei kleineren Städten Deutschlands unter der mittleren Schuljugend eine Befragung abgehalten, wer nach ihrer Ansicht der größte Mann der Weltgeschichte sei. Die Zeitschrift „The Journal of Abnormal and Social Psychology“ bringt darüber folgende Ergebnisse: Von 391 Jungen und Mädchen antworteten 130, daß sie es nicht wüßten. Am bemerkenswertesten unter den anderen Antworten waren 63 Stimmen für' Roosevelt, 50 für Bismarck, 49 für Friedrich den Großen, 19 für Hitler und 14 für Eisenhower, Napoleon erhielt 3 Stimmen, Christus 2, Churchill und Goethe je eine Stimme. *
Im Jahre 1939 sind nach Schätzungen ungefähr 60 Prozent des nationalen Einkommens dem Zugriff des Fiskus in Frankreich entschlüpft. Die „Temoignage chretien“ erklärt, daß die Situation augenblicklich noch ungünstiger ist. Wenn man also annehme, daß der Prozentsatz heute ungefähr dem Jahre 1939 gleichkomme, dann sind im abgelaufenen Finanzjahr 300 Millionen Francs der Besteuerung entzogen worden. Das kommt, nach Bericht dieser Wochenschrift, dem Betrage gleich, der heute das Defizit des französischen Staates ausmacht.
Nach sehr vorsichtigen Schätzungen haben seit Kriegsbeginn 85 0.0 00 französische Bauern ihren Grund und Boden verlassen. Diese Bewegung nimmt nach den .Berichten der holländischen Zeitung „De Linie“ noch immer zu und man fürchtet, daß sie auch in den nächsten Jahren nicht zum Stillstand kommen wird. *
Auf die religiösen Verhältnisse in den französischen Landgemeinden wirft ein Hirtenbrief des Bischofs von Toul ein bezeichnendes Licht. Dieser stellt in diesem einen Vergleich an gegenüber den Verhältnissen einer Berggemeinde im Jahre 1850, in dem alle Männer an einer Mission teilnahmen mit Ausnahme von dreien, währenddessen im Jahre 1944 im gesamten nur drei Männer in einer Gemeinde von 1400 Seelen teilnahmen. Als eine der schlechtesten Gemeinden wird eine Pfarre von 6000 Seelen erwähnt, in der nur 300 Besucher der Sonntagsmesse gezählt wurden. Allerdings ist “dabei auch zu bedenken, daß auf 10 bis 11 Pfarren drei Priester kommen. *
Seit den letzten' Wahlen haben in Belgien die Linksparteien das Schulproblem wieder in den Vordergrund geschoben, im Zusammenhang mit einer antireligiösen Propaganda. 1939 hatten die staatlichen Schulen 471.143 Schüler; 1944 dagegen 385.491. Damit ist eine Verminderung um 85.652
Schülern eingetreten. Die Privatschulen, welche in ihrer Mehrzahl konfessionell sind, hatten 1939 483.351 Schüler und 1944 479.567 Schüler, also einen Rückgang von 3784 Kindern. Wenn auch sich in diesen Zahlen ein gewisser Rückgang der Geburten zeigt, so ergeben sie doch, daß die konfessionellen Schulen mehr das Vertrauen der Eltern besitzen als die staatlichen. *
Die Delegierten auf der letzten Konferenz der kommunistischen Partei des britischen Empires in London wurden nach Berichten von „De Linie“ dahin informiert, daß die Gesamtzahl der Kommunisten in der ganzen Welt 17,009.000 betrage. Eine Karte, die der Konferenz gezeigt wurde, besagte, daß Sowjetrußland 6,000.000 kommunistische Mitglieder zähle, Italien 2,200.000, China 2,000.000, die Vereinigten Staaten 74.000 und Großbritannien 43.000 Mitglieder habe. *
Die türkische Volkspartei, welche auf dem Prinzip des Laizismus steht und die Stütze des gegenwärtigen kemalistischen Systems darstellt, tritt jetzt in einer Erklärung dafür ein, daß die Eltern ihren Kindern religiösen Privatunterricht erteilen lassen dürfen. Doch soll dieser außerhalb der Schulräume erfolgen.
*
Bei der Sitzung des Gorki-Instituts für Weltliteratur in Moskau wurde in verschiedenen Referaten ein Überblick und eine Kritik der im Jahre 1946 erschienenen Schriftwerke in der Sowjetunion gegeben. In der Prosaliteratur sind nach einem Bericht von Subotzkij die besten Bücher „Reisegenossen“ und „Weggenossen“ von Panowa. Im_ allgemeinen fehlt es in diesem Jahr an wirklich vorbildlicher Literatur, wie sie von dem Künstler als einen Lehrer des Lebens zu erwarten und zu fordern sei. Es wird festgestellt, daß im allgemeinen in der Literatur noch nicht der Übergang vom Krieg und seinem Menschentyp zu dem des Friedens und der Arbeit gefunden wurde. Bei den Heimkehrererzählungen herrschen vor allem Schilderungen, Töne und Empfindungen der Rückkehr zur Familie vor. Ähnlicherweise ist auch im Gebiet der Versdichtung die Auswirkung und das Thema des neuen Lebens erst zu erwarten, zumal da, wie der Bericht ausführt, die führenden Schriftsteller noch nichts Neues in dieser Hinsicht veröffentlicht haben. *
Die Akademie der Wissenschaften der UdSSR in Leningrad hat der Tschechoslowakei eine wertvolle Handschrift geschenkt, nämlich die Bilderchronik des Konzils von Konstanz des Ulrich von Richenthal. Der Kodex wurde der Staats- und Universitätsbücherei in Prag übergeben.
Aus China trafen in den letzten Monaten immer neue Nachrichten von zerstörten Missionen ein. Nachdem die französische Mission von Shiensien und die ungarische Mission von Taming vollständig enteignet und die Missionare gefangen genommen oder zur Flucht gezwungen worden waren, traf im vergangenen Dezember und Jänner die Mission der österreichischen Jesuiten in K i n g s h i e n das gleiche Los. — Auf Java haben die aufständischen Eingeborenen sechs holländische Jesuiten ermordet und auf den Karolinen-, Mariannen- und Marshall-Inseln sind fast alle Missionare — über zwanzig — entweder von den Japanern ermordet worden oder bei Bombenangriffen umgekommen. In M a n i 1 a, auf den Philippinen, sind das Seminar, die Universität und das berühmte meteorologische Observatorium, durchaus Werke der Mission, zerstört worden. In China lassen der Bürgerkrieg und die schwere Not weitere schlimme Nachrichten erwarten.
• *
Die Herz-Jesu-Missionäre in Salzburg veröffentlichen einen Bericht über ihre Missionen, in dem die Heimsuchungen auf Neuguinea geschildert werden. Von den 60 Patres wurden 15 von den Japanern ermordet, 1 durch Fliegerangriffe getötet und 5 starben im japanischen Konzentrationslager. Von den 53 Brüdern wurde einer von den Japanern ermordet, 4 durch Fliegerangriffe getötet, 11 starben in Konzentrationslagern. Neun europäische und neun eingeborene Schwestern fanden gleichfalls einen gewaltsamen Tod. Eingeborene Hilfskräfte wurden nach diesem Bericht reihenweise geköpft. Missionsstationen, die Tausende von Katholiken zählten, sind bis auf 200 bis 250 ausgerottet.