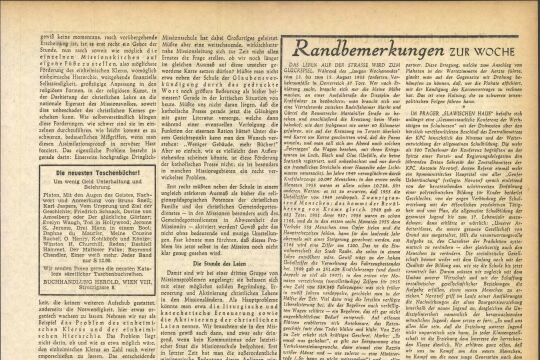Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Randhemerkungen zur woche
EIN POLITISCHES ZWISCHENSPIEL: Die Bundesleitung der „Jungen Front“ hat
Abschied von der österreichischen Volkspartei und damit wahrscheinlich vom politischen Leben überhaupt genommen. Denn was jetzt kommt, ist unschwer zu erraten: Der Versuch, als politische Splittergruppe zu leben, ein Sichfortbringen von einem Tag zum anderen, ein Nicht-leben-, aber auch Nicht-sterben-Können und — was noch viel betrüblicher ist—die Versuchung, in undurch. sichtige politische Kombinationen verstrickt zu werden ... Ist das wirklich das Ende eines mit viel Sympathie begrüßten Versuches? Als vor genau zwei Jahren die „Junge Front“ das erstemal an die Öffentlichkeit trat, wurde ihr Ruf nach Sammlung und politischer Aktivierung der jungen Generation im Rahmen der ersten Regierungspartei mit Freude und mit großen Erwartungen aufgenommen. Würde es gelingen, die vielen aufgeschlossenen jungen Menschen dieses Landes, die Jungarbeiter und Studenten genau so wie die Landjugend, anzusprechen und ihren gemeinsamen Wunsch nach einer Politik frei von den Barrikaden der Vergangenheit mit Erfolg zu verdolmetschen? Die Erwartungen waren groß. Zu groß vielleicht. Um so größer aber deshalb die Enttäuschung, die folgte. Entscheidende Fehler geschahen am fieginn, und sie waren nicht einmal auf das Konto dieser jungen politischen Gruppe zu buchen. Als die „Junge Front“ sich im politischen Leben meldete, war nämlich Wahlzeit. Die Nationalratswahlen 1949 standen vor der Tür. Die Versuchung war groß, dem Rat gewiegter Taktiker nachzugeben, in deren Plan jene Gruppe, die junge Menschen und neue Ideen dem öffentlichen Leben zur Verfügung stellen sollte, keine andere Aufgabe hatte, als den Flankenschutz der ersten Regierungspartei nach rechts zu bilden, ein Auffangbecken für alle jene zu sein, die an das Lager der „Unabhängigen“ verlorenzugehen drohten. Diese einseitige Belastung war zu groß. Sie mußte zwangsläufig Widerspruch in den eigenen Reihen hervorrufen. Die Geister der Vergangenheit, einmal beschworen, meldeten sich überall... Schon damals und nicht erst heute verfiel die schöne Idee einer wirklichen Front der jungen Menschen dieses Landes. Was später kam, waren Versuche einer Korrektur dieser Fehler, im einzelnen nicht immer erfolglos, aber im gesamten doch nicht ausreichend. Die „Junge Front“ wurde eine Gruppe im politischen Spiel — nicht schlechter, aber auch nicht besser als viele andere. Die Mängel, in organisatorischer Hinsicht vor allem, blieben nicht unbekannt. Sie mögen wohl auch entscheidend die nunmehr erfolgten Entschlüsse der neuen Parteiführung beeinflußt haben. Bedauerlich an ihnen ist, daß sie nicht zwischen den zentrifugalen, aus dem Parteirahmen hinausdrängenden Kräften und jenen, die ihren Willen zu loyaler und auch sehr nützlicher Mitarbeit unter Beweis gestellt haben, deutlicher unterschieden. Ungern sieht man nämlich Menschen, die ihrer Weltanschauung nach durchaus in das Lager der ersten Regierungspartei gehören und die dieser bestimmt keine Schande bereitet haben, in die Wüste ziehen.
EIN NOTRUF, DER NICHT ÜBERHÖRT WERDEN DARF, ist von den konfessionellen Privatkrankenhäusern ergangen. Es war nicht der erste — wiederholt haben die privaten Krankenanstalten in den vergangenen Jahren schon ihre prekäre Lage aufgezeigt —, aber wohl der dringlichste. Jetzt, nach der neuerlichen Lohn- und Preisbewegung, geht es einfach nicht weiter. Die Situation ist bekannt: alle österreichischen Krankenanstalten arbeiten mit Verlust. Die öffentlichen Krankenanstalten verzeichneten bisher an täglichen Selbstkosten pro Patient 54 S, die privaten Krankenhäuser durchschnittlich nur 37 S. Hievon bezahlen die Krankenkassen an die öffentlichen Anstalten lediglich 28.80 S, an die Privatkrankenhäuser sogar nur 24 S. — Während die öffentlichen Krankenanstalten aber die Differenz aus ö ff entlich en M i 11 e In zugeschossen bekommen, sind die privaten Spitäler gezwungen, die Mittel zur Deckung des Fehlbetrages aus der eigenenVermögenssubstanz aufzubringen. Diese finanziellen Reserven sind nun erschöpft, auf keinen Fall vertragen sie vermehrte, aus dem neuen Lohn- und Preisabkommen erwachsende Unkosten. Eine Schließung einer Reihe von Anstalten rückt bedrohlich nahe, wenn nicht Hilfe zur rechten Zeit erfolgt. Dabei stehen nicht nur allein in Wien der Verlust von 3500 Spitalsbetten auf dem Spiel, sondern der Verzicht gerade auf jene Heil- und Pflegeanstalten, denen noch keiner von den Tausenden von Kranken — gleichgültig welcher Religion und Weltanschauung —, die hier Genesung fanden, Anerkennung und höchstes Lob versagt hat. Daher kann die Antwort auf den Appell, den zehn Wiener Spitäler an das Sf zialministerium und an das Finanzministerium gerichtet haben und in dem sie
neben einer ausreichenden Soforthilfe die Einberufung einer Enquete zur grundsätzlichen Klärung ihrer Stellung und ihrer Situation verlangen, nicht schwer fallen. •
EIN KALENDARISCHER VERMERK — vom 10. zum 14. Juli fand in Berlin der Deutsche Evangelische Kirchentag 19 51 statt — läßt kaum etwas ahnen von' der weit über innerdeutsche Bezüge hinausgehenden, ins Europäische, ja Gesamt-christliche ausholenden Bedeutung dieser Kundgebung. In der hochpolitischen Hitze dieses Sommers trafen sich also, in Ost- und Westberlin, zu gemeinsamem Bekenntnis, zu gemeinsamer Aussprache in Gegenwart von Spitzen der ost- und westdeutschen Regierung einige hunderttausend Menschen (allein die Schlußveranstaltung im Olympiastadion vereinigte weit über 200.000!) Menschen — das heißt evangelische Christen, die ihre großen Sorgen, ihre Ängste und Bedrückungen hier im Angesicht der ganzen (Ost- und West-) Welt aussagten — und um eine Überwindung in Glaube, Hoffnung und Liebe rangen. — Das Tagungsthema ließ nichts an Aktualität und Spannung missen: die Parole „Wir sind doch alle Brüder“ wurde nicht als Schlagwort ausgemünzt, sondern, und zwar vierfach, als Stoff ernstester Beratungen, Aussprachen, Gewissenserforschungen: wir sind doch Brüder — in der Kirche, in der Familie, im Volk, bei der Arbeit. — Einige Worte, hinter denen sich alle Schrecknisse und Greuel, aber auch alle Verheißungen dieser geschichtlichen Stunde bergen. — Ein Aufschrei aus vielen tausend Kehlen über die Gewalttaten, die man dem Gewissen, den Kindern, den Schülern, allen irgendwie im öffentlichen Leben Ostdeutschlands Stehenden ebenso wie dem einfachen Arbeiter dortselbst antut: bezeugt hier, am Kirchentag, durch eben diese Menschen selbst, denen die hier erlebte Gemeinschaft die Kraft zu diesem offenen Bekenntnis gab. •
DER MORD AN KÖNIG ABDULLAH von Jordanien ist binnen kurzem das zweite Attentat, das die ohnedies heillos verstrickte Orientpolitik kaleidoskopartig zu verändern droht. Erst hatte die Ermordung des iranischen Premiers Razmara den Auftakt zum Ausbruch des ölkonflikts gegeben, der für die westliche, vor allem die britische Position im Vorderen Orient eine so schwere Belastung bedeutet. Und nun ist die festeste Stütze der britischen Politik im JVahen Osten, einer der zähesten und gewandtesten Kämpfer auf diesem Schachbrett, unter den Kugeln eines Attentäters gefallen. Abdullahs Einfluß im arabischen Raum war groß. Seine vom britischen General Glubb-Pascha organisierte „Arabische Legion“ war die einzige wirklich schlagkräftige Truppe der Arabischen Liga. Mit Erfolg hat sie gegen die israelische Armee gefochten. Sie gewann Abdullah als .Anteil am Erbe nach dem Mandatsland Palästina eine Erweiterung seines bisherigen Wüstenreiches um mehr als das Doppelte und damit zugleich die Neustadt von Jerusalem. Dieser Erfolg trug ihm allerdings die Feindschaft der unterlegenen arabischen Mitpartner ein. Aber gestützt auf die nahe verwandtschaftliche Bindung zum irakischen Königshause und gedeckt durch ein stillschweigendes Einvernehmen mit Israel, verfolgte Abdullah zielsicher seinen Hauptplan weiter: die Errichtung eines großen haschemitischen Reiches in Vorderasien unter Einschluß von Syrien, die seinem Vater Hussein mißlungen war. Je heftiger die britische Suezkanalzone von Ägypten angefochten wurde, um so wichtiger wurden für die britischen Interessen die Militärflugplätze von Amann (Jordanien) und Habbanieh (Irak), auf die England, solange Abdullah an der Macht lebte, sicher rechnen durfte. Mit seinem ältesten Sohn war König Abdullah überwarfen, sein zweiter, englandfreundlicher Sohn wird ihm folgen. Kein günstiger Auftakt für die Wahrung einer Kontinuität, an der dem
Westen heute doppelt gelegen sein muß. •
EINSTIGE RECHTE DER SPANISCHEN KÖNIGE, die heute dem geltenden kanonischen Recht widersprechen würden, werden zur Motivierung der Ansprüche der republikanischen Regierung Boliviens auf ein allgemeines staatliches Patronat über die Kirche, auf Ernennung von Bischöfen und anderen kirchlichen Dignt-tären ins Treffen geführt. Die von der Regierung erlassenen Gesetze sind von solcher Schärfe, daß ein Hirtenbrief des Gesamtepiskopats des Landes erklärt, die Kirche befinde sich in einem Zustande der „Versklavung“, die Kommunisten von Ungarn und der Tschechoslowakei erschienen neben der Regierung von La Paz „wia Amateure“. Von den vier Millionen Einwohnern des Landes sind 3,850.000 Katholiken.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!